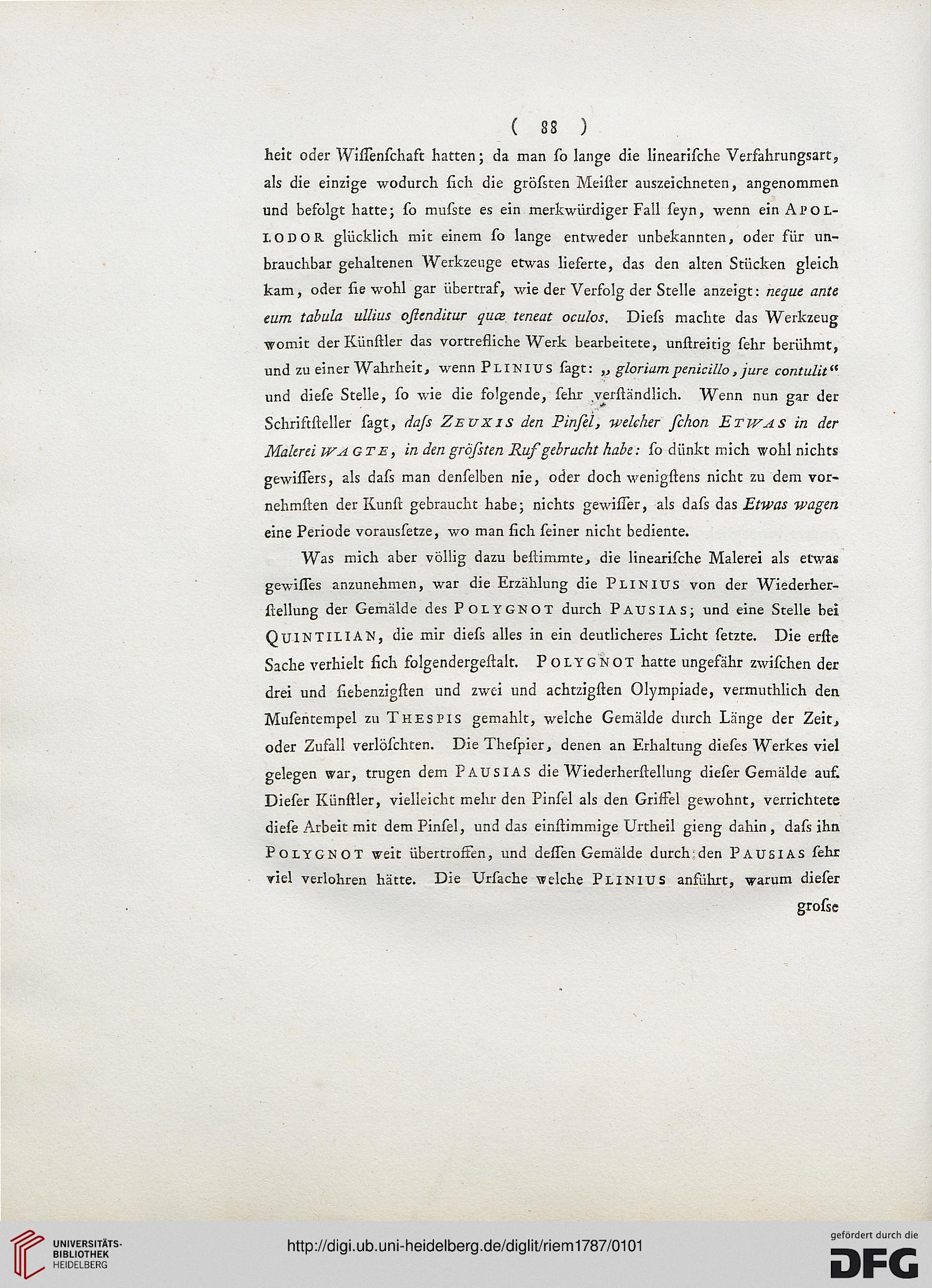( 88 )
heit oder Wislenschaft hatten; da man so lange die linearische Verfahrungsart,
als die einzige wodurch sich die grössten Meister auszeichneten, angenommen
und befolgt hatte; so musste es ein merkwürdiger Fall seyn, wenn ein Al'OL-
IODOR glücklich mit einem so lange entweder unbekannten, oder für un-
brauchbar gehaltenen Werkzeuge etwas lieferte, das den alten Stücken gleich
kam, oder sie wohl gar übertraf, wie der Verfolg der Stelle anzeigt: neque ante
eum tabula ullius oßenditur quce tmeat oculos. Diess machte das Werkzeug
•womit der Künstler das vortressiche Werk bearbeitete, unstreitig sehr berühmt,
und zu einer Wahrheit, wenn PLINIUS sagt: „ gloriampeniciUo, jure contulit"
und diese Stelle, so wie die folgende, sehr verständlich. Wenn nun gar der
Schriftsteller sagt, daß Zeuxis den Pinsel, welcher fchon Etwas in der
Malerei wa. gte , in den grössten Rus gebrückt habe: so dünkt mich wohl nichts
gewissers, als dass man denselben nie, oder doch wenigstens nicht zu dem vor-
nehmsten der Kunst gebraucht habe; nichts gewisser, als dass das Etwas wagen
eine Periode voraussetze, wo man sich seiner nicht bediente.
Was mich aber völlig dazu beslimmte, die linearische Malerei als etwas
gewisses anzunehmen, war die Erzählung die Pliniüs von der Wiederher-
stellung der Gemälde des POLYGNOT durch PAUSIAS; und eine Stelle bei
QuiNTILIAN, die mir diess alles in ein deutlicheres Licht setzte. Die erste
Sache verhielt sich folgendergestalt. Polygnot hatte ungefähr zwischen der
drei und siebenzigsten und zwei und achtzigsten Olympiade, vermuthlich den
Musentempel zu Thespis gemahlt, welche Gemälde durch Länge der Zeit,
oder Zufall verlöschten. Die Thespier, denen an Erhaltung dieses Werkes viel
gelegen war, trugen dem PAUSIAS die Wiederherstellung dieser Gemälde auf.
Dieser Künstler, vielleicht mehr den Pinsel als den Griffel gewohnt, verrichtete
diese Arbeit mit dem Pinsel, und das einstimmige Urtheil gieng dahin, dass ihn
POLYGNOT weit übertreffen, und dessen Gemälde durch den PAUSIAS sehr
riel verlohren hätte. Die Ursache welche PLINIUS anführt, warum dieser
grossc
heit oder Wislenschaft hatten; da man so lange die linearische Verfahrungsart,
als die einzige wodurch sich die grössten Meister auszeichneten, angenommen
und befolgt hatte; so musste es ein merkwürdiger Fall seyn, wenn ein Al'OL-
IODOR glücklich mit einem so lange entweder unbekannten, oder für un-
brauchbar gehaltenen Werkzeuge etwas lieferte, das den alten Stücken gleich
kam, oder sie wohl gar übertraf, wie der Verfolg der Stelle anzeigt: neque ante
eum tabula ullius oßenditur quce tmeat oculos. Diess machte das Werkzeug
•womit der Künstler das vortressiche Werk bearbeitete, unstreitig sehr berühmt,
und zu einer Wahrheit, wenn PLINIUS sagt: „ gloriampeniciUo, jure contulit"
und diese Stelle, so wie die folgende, sehr verständlich. Wenn nun gar der
Schriftsteller sagt, daß Zeuxis den Pinsel, welcher fchon Etwas in der
Malerei wa. gte , in den grössten Rus gebrückt habe: so dünkt mich wohl nichts
gewissers, als dass man denselben nie, oder doch wenigstens nicht zu dem vor-
nehmsten der Kunst gebraucht habe; nichts gewisser, als dass das Etwas wagen
eine Periode voraussetze, wo man sich seiner nicht bediente.
Was mich aber völlig dazu beslimmte, die linearische Malerei als etwas
gewisses anzunehmen, war die Erzählung die Pliniüs von der Wiederher-
stellung der Gemälde des POLYGNOT durch PAUSIAS; und eine Stelle bei
QuiNTILIAN, die mir diess alles in ein deutlicheres Licht setzte. Die erste
Sache verhielt sich folgendergestalt. Polygnot hatte ungefähr zwischen der
drei und siebenzigsten und zwei und achtzigsten Olympiade, vermuthlich den
Musentempel zu Thespis gemahlt, welche Gemälde durch Länge der Zeit,
oder Zufall verlöschten. Die Thespier, denen an Erhaltung dieses Werkes viel
gelegen war, trugen dem PAUSIAS die Wiederherstellung dieser Gemälde auf.
Dieser Künstler, vielleicht mehr den Pinsel als den Griffel gewohnt, verrichtete
diese Arbeit mit dem Pinsel, und das einstimmige Urtheil gieng dahin, dass ihn
POLYGNOT weit übertreffen, und dessen Gemälde durch den PAUSIAS sehr
riel verlohren hätte. Die Ursache welche PLINIUS anführt, warum dieser
grossc