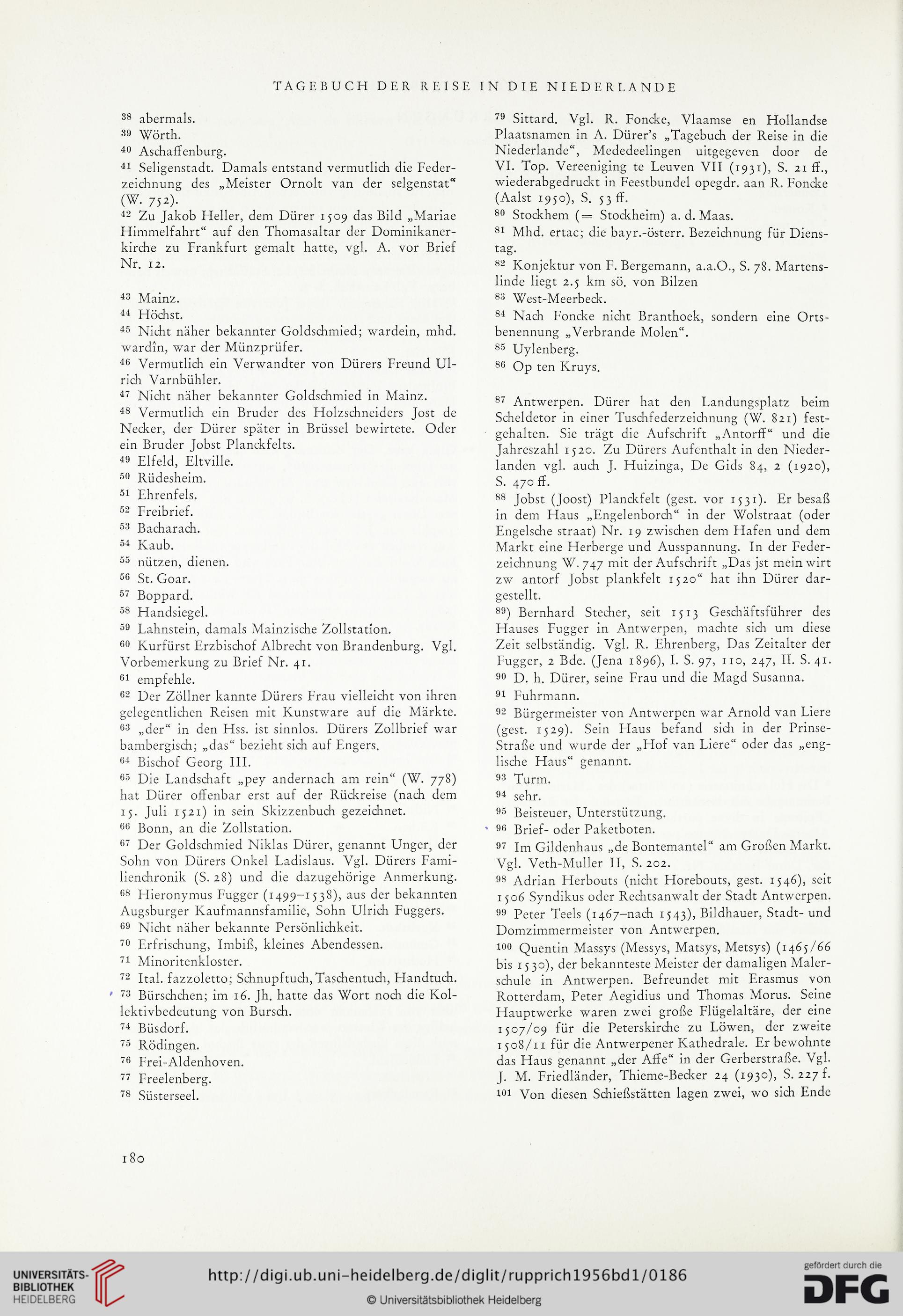TAGEBUCH DER REISE IN DIE NIEDERLANDE
38 abermals.
39 Wörth.
40 Aschaffenburg.
41 Seligenstadt. Damals entstand vermutlich die Feder-
zeichnung des „Meister Ornolt van der selgenstat“
(W. 752).
42 Zu Jakob Heller, dem Dürer 1509 das Bild „Mariae
Himmelfahrt“ auf den Thomasaltar der Dominikaner-
kirche zu Frankfurt gemalt hatte, vgl. A. vor Brief
Nr. 12.
43 Mainz.
44 Höchst.
45 Nicht näher bekannter Goldschmied; wardein, mhd.
wardin, war der Münzprüfer.
46 Vermutlich ein Verwandter von Dürers Freund Ul-
rich Varnbühler.
47 Nicht näher bekannter Goldschmied in Mainz.
48 Vermutlich ein Bruder des Holzschneiders Jost de
Necker, der Dürer später in Brüssel bewirtete. Oder
ein Bruder Jobst Planckfelts.
49 Eifeld, Eltville.
50 Rüdesheim.
51 Ehrenfels.
52 Freibrief.
53 Bacharach.
54 Kaub.
55 nützen, dienen.
56 St. Goar.
57 Boppard.
58 Handsiegel.
59 Lahnstein, damals Mainzische Zollstation.
60 Kurfürst Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Vgl.
Vorbemerkung zu Brief Nr. 41.
61 empfehle.
62 Der Zöllner kannte Dürers Frau vielleicht von ihren
gelegentlichen Reisen mit Kunstware auf die Märkte.
63 „der“ in den Hss. ist sinnlos. Dürers Zollbrief war
bambergisch; „das“ bezieht sich auf Engers.
64 Bischof Georg III.
65 Die Landschaft „pey andernach am rein“ (W. 778)
hat Dürer offenbar erst auf der Rückreise (nach dem
15. Juli 1521) in sein Skizzenbuch gezeichnet.
66 Bonn, an die Zollstation.
67 Der Goldschmied Niklas Dürer, genannt Unger, der
Sohn von Dürers Onkel Ladislaus. Vgl. Dürers Fami-
lienchronik (S. 28) und die dazugehörige Anmerkung.
68 Hieronymus Fugger (1499-1538), aus der bekannten
Augsburger Kaufmannsfamilie, Sohn Ulrich Fuggers.
69 Nicht näher bekannte Persönlichkeit.
70 Erfrischung, Imbiß, kleines Abendessen.
71 Minoritenkloster.
72 Ital. fazzoletto; Schnupftuch, Taschentuch, Handtuch.
' 73 Bürschchen; im 16. Jh. hatte das Wort noch die Kol-
lektivbedeutung von Bursch.
74 Büsdorf.
75 Rödingen.
76 Frei-Aldenhoven.
77 Freelenberg.
78 Süsterseel.
79 Sittard. Vgl. R. Foncke, Vlaamse en Hollandse
Plaatsnamen in A. Dürer’s „Tagebuch der Reise in die
Niederlande“, Mededeelingen uitgegeven door de
VI. Top. Vereeniging te Leuven VII (1931), S. 21 ff.,
wiederabgedruckt in Feestbundei opegdr. aan R. Foncke
(Aalst 1950), S. 53 ff.
80 Stockhem (= Stockheim) a. d. Maas.
81 Mhd. ertac; die bayr.-österr. Bezeichnung für Diens-
tag.
82 Konjektur von F. Bergemann, a.a.O., S. 78. Martens-
linde liegt 2.5 km sö. von Bilzen
83 West-Meerbeck.
84 Nach Foncke nicht Branthoek, sondern eine Orts-
benennung „Verbrande Molen“.
85 Uylenberg.
86 Op ten Kruys.
87 Antwerpen. Dürer hat den Landungsplatz beim
Scheldetor in einer Tuschfederzeichnung (W. 821) fest-
gehalten. Sie trägt die Aufschrift „Antorff“ und die
Jahreszahl 1520. Zu Dürers Aufenthalt in den Nieder-
landen vgl. auch J. Huizinga, De Gids 84, 2 (1920),
S. 470 ff.
88 Jobst (Joost) Planckfeit (gest. vor 1531). Er besaß
in dem Haus „Engelenborch“ in der Wolstraat (oder
Engelsche straat) Nr. 19 zwischen dem Hafen und dem
Markt eine Herberge und Ausspannung. In der Feder-
zeichnung W. 747 mit der Aufschrift „Das jst mein wirt
zw antorf Jobst plankfelt 1520“ hat ihn Dürer dar-
gestellt.
89) Bernhard Stecher, seit 1513 Geschäftsführer des
Hauses Fugger in Antwerpen, machte sich um diese
Zeit selbständig. Vgl. R. Ehrenberg, Das Zeitalter der
Fugger, 2 Bde. (Jena 1896), I. S. 97, 110, 247, II. S. 41.
90 D. h. Dürer, seine Frau und die Magd Susanna.
91 Fuhrmann.
92 Bürgermeister von Antwerpen war Arnold van Liere
(gest. 1529). Sein Haus befand sich in der Prinse-
Straße und wurde der „Hof van Liere“ oder das „eng-
lische Haus“ genannt.
93 Turm.
94 sehr.
95 Beisteuer, Unterstützung.
' 96 Brief- oder Paketboten.
97 Im Gildenhaus „de Bontemantel“ am Großen Markt.
Vgl. Veth-Muller II, S. 202.
98 Adrian Herbouts (nicht Horebouts, gest. 1546), seit
1506 Syndikus oder Rechtsanwalt der Stadt Antwerpen.
99 Peter Teels (1467-nach 1543), Bildhauer, Stadt- und
Domzimmermeister von Antwerpen.
100 Quentin Massys (Messys, Matsys, Metsys) (1465/66
bis 1530), der bekannteste Meister der damaligen Maler-
schule in Antwerpen. Befreundet mit Erasmus von
Rotterdam, Peter Aegidius und Thomas Morus. Seine
Hauptwerke waren zwei große Flügelaltäre, der eine
1507/09 für die Peterskirche zu Löwen, der zweite
1508/11 für die Antwerpener Kathedrale. Er bewohnte
das Haus genannt „der Affe“ in der Gerberstraße. Vgl.
J. M. Friedländer, Thieme-Becker 24 (1930), S. 227 f.
101 yon diesen Schießstätten lagen zwei, wo sich Ende
180
38 abermals.
39 Wörth.
40 Aschaffenburg.
41 Seligenstadt. Damals entstand vermutlich die Feder-
zeichnung des „Meister Ornolt van der selgenstat“
(W. 752).
42 Zu Jakob Heller, dem Dürer 1509 das Bild „Mariae
Himmelfahrt“ auf den Thomasaltar der Dominikaner-
kirche zu Frankfurt gemalt hatte, vgl. A. vor Brief
Nr. 12.
43 Mainz.
44 Höchst.
45 Nicht näher bekannter Goldschmied; wardein, mhd.
wardin, war der Münzprüfer.
46 Vermutlich ein Verwandter von Dürers Freund Ul-
rich Varnbühler.
47 Nicht näher bekannter Goldschmied in Mainz.
48 Vermutlich ein Bruder des Holzschneiders Jost de
Necker, der Dürer später in Brüssel bewirtete. Oder
ein Bruder Jobst Planckfelts.
49 Eifeld, Eltville.
50 Rüdesheim.
51 Ehrenfels.
52 Freibrief.
53 Bacharach.
54 Kaub.
55 nützen, dienen.
56 St. Goar.
57 Boppard.
58 Handsiegel.
59 Lahnstein, damals Mainzische Zollstation.
60 Kurfürst Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Vgl.
Vorbemerkung zu Brief Nr. 41.
61 empfehle.
62 Der Zöllner kannte Dürers Frau vielleicht von ihren
gelegentlichen Reisen mit Kunstware auf die Märkte.
63 „der“ in den Hss. ist sinnlos. Dürers Zollbrief war
bambergisch; „das“ bezieht sich auf Engers.
64 Bischof Georg III.
65 Die Landschaft „pey andernach am rein“ (W. 778)
hat Dürer offenbar erst auf der Rückreise (nach dem
15. Juli 1521) in sein Skizzenbuch gezeichnet.
66 Bonn, an die Zollstation.
67 Der Goldschmied Niklas Dürer, genannt Unger, der
Sohn von Dürers Onkel Ladislaus. Vgl. Dürers Fami-
lienchronik (S. 28) und die dazugehörige Anmerkung.
68 Hieronymus Fugger (1499-1538), aus der bekannten
Augsburger Kaufmannsfamilie, Sohn Ulrich Fuggers.
69 Nicht näher bekannte Persönlichkeit.
70 Erfrischung, Imbiß, kleines Abendessen.
71 Minoritenkloster.
72 Ital. fazzoletto; Schnupftuch, Taschentuch, Handtuch.
' 73 Bürschchen; im 16. Jh. hatte das Wort noch die Kol-
lektivbedeutung von Bursch.
74 Büsdorf.
75 Rödingen.
76 Frei-Aldenhoven.
77 Freelenberg.
78 Süsterseel.
79 Sittard. Vgl. R. Foncke, Vlaamse en Hollandse
Plaatsnamen in A. Dürer’s „Tagebuch der Reise in die
Niederlande“, Mededeelingen uitgegeven door de
VI. Top. Vereeniging te Leuven VII (1931), S. 21 ff.,
wiederabgedruckt in Feestbundei opegdr. aan R. Foncke
(Aalst 1950), S. 53 ff.
80 Stockhem (= Stockheim) a. d. Maas.
81 Mhd. ertac; die bayr.-österr. Bezeichnung für Diens-
tag.
82 Konjektur von F. Bergemann, a.a.O., S. 78. Martens-
linde liegt 2.5 km sö. von Bilzen
83 West-Meerbeck.
84 Nach Foncke nicht Branthoek, sondern eine Orts-
benennung „Verbrande Molen“.
85 Uylenberg.
86 Op ten Kruys.
87 Antwerpen. Dürer hat den Landungsplatz beim
Scheldetor in einer Tuschfederzeichnung (W. 821) fest-
gehalten. Sie trägt die Aufschrift „Antorff“ und die
Jahreszahl 1520. Zu Dürers Aufenthalt in den Nieder-
landen vgl. auch J. Huizinga, De Gids 84, 2 (1920),
S. 470 ff.
88 Jobst (Joost) Planckfeit (gest. vor 1531). Er besaß
in dem Haus „Engelenborch“ in der Wolstraat (oder
Engelsche straat) Nr. 19 zwischen dem Hafen und dem
Markt eine Herberge und Ausspannung. In der Feder-
zeichnung W. 747 mit der Aufschrift „Das jst mein wirt
zw antorf Jobst plankfelt 1520“ hat ihn Dürer dar-
gestellt.
89) Bernhard Stecher, seit 1513 Geschäftsführer des
Hauses Fugger in Antwerpen, machte sich um diese
Zeit selbständig. Vgl. R. Ehrenberg, Das Zeitalter der
Fugger, 2 Bde. (Jena 1896), I. S. 97, 110, 247, II. S. 41.
90 D. h. Dürer, seine Frau und die Magd Susanna.
91 Fuhrmann.
92 Bürgermeister von Antwerpen war Arnold van Liere
(gest. 1529). Sein Haus befand sich in der Prinse-
Straße und wurde der „Hof van Liere“ oder das „eng-
lische Haus“ genannt.
93 Turm.
94 sehr.
95 Beisteuer, Unterstützung.
' 96 Brief- oder Paketboten.
97 Im Gildenhaus „de Bontemantel“ am Großen Markt.
Vgl. Veth-Muller II, S. 202.
98 Adrian Herbouts (nicht Horebouts, gest. 1546), seit
1506 Syndikus oder Rechtsanwalt der Stadt Antwerpen.
99 Peter Teels (1467-nach 1543), Bildhauer, Stadt- und
Domzimmermeister von Antwerpen.
100 Quentin Massys (Messys, Matsys, Metsys) (1465/66
bis 1530), der bekannteste Meister der damaligen Maler-
schule in Antwerpen. Befreundet mit Erasmus von
Rotterdam, Peter Aegidius und Thomas Morus. Seine
Hauptwerke waren zwei große Flügelaltäre, der eine
1507/09 für die Peterskirche zu Löwen, der zweite
1508/11 für die Antwerpener Kathedrale. Er bewohnte
das Haus genannt „der Affe“ in der Gerberstraße. Vgl.
J. M. Friedländer, Thieme-Becker 24 (1930), S. 227 f.
101 yon diesen Schießstätten lagen zwei, wo sich Ende
180