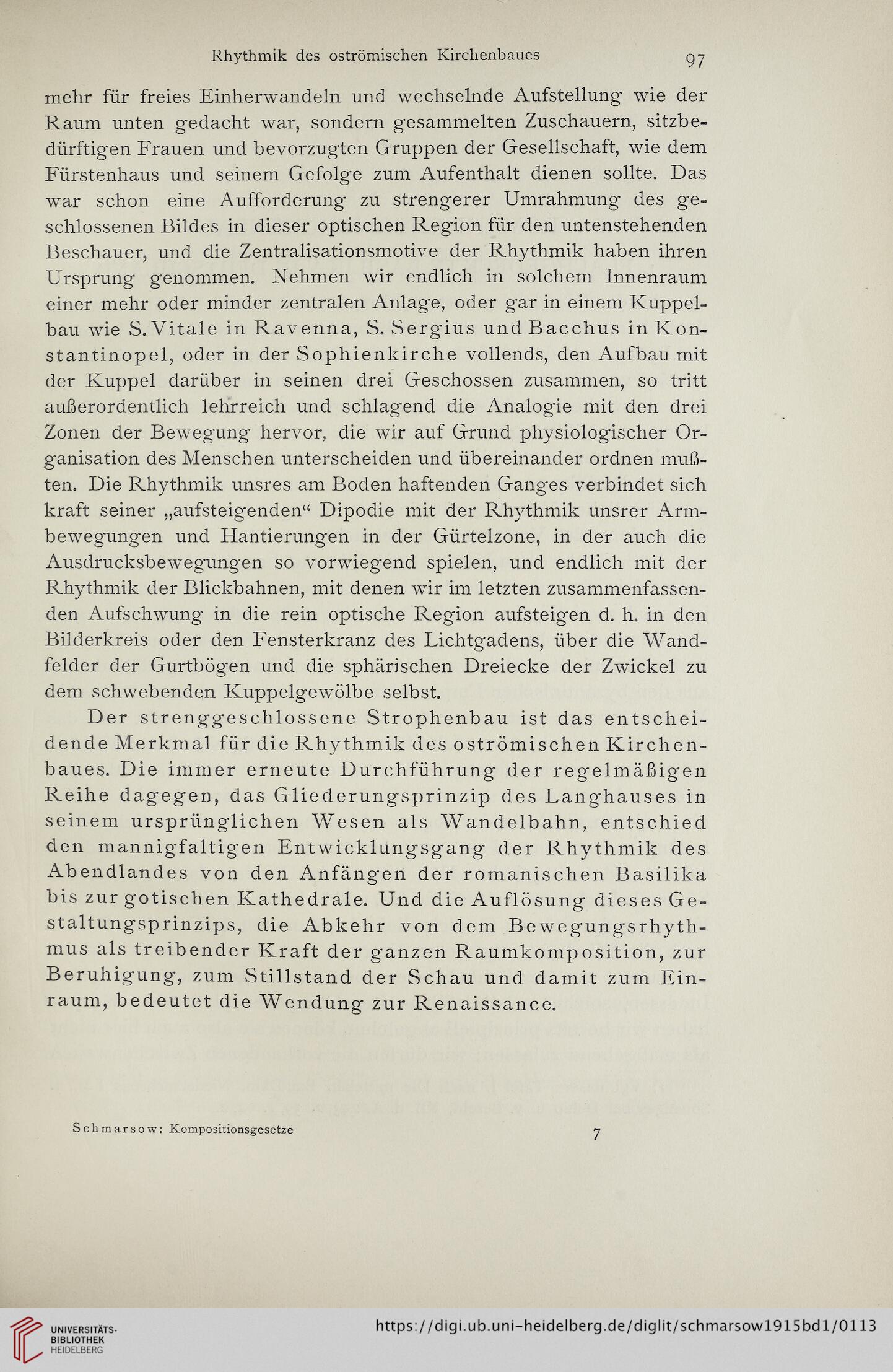Rhythmik des oströmischen Kirchenbaues
97
mehr für freies Einherwandeln und wechselnde Aufstellung wie der
Raum unten gedacht war, sondern gesammelten Zuschauern, sitzbe-
dürftigen Frauen und bevorzugten Gruppen der Gesellschaft, wie dem
Fürstenhaus und seinem Gefolge zum Aufenthalt dienen sollte. Das
war schon eine Aufforderung zu strengerer Umrahmung des ge-
schlossenen Bildes in dieser optischen Region für den untenstehenden
Beschauer, und die Zentralisationsmotive der Rhythmik haben ihren
Ursprung genommen. Nehmen wir endlich in solchem Innenraum
einer mehr oder minder zentralen Anlage, oder gar in einem Kuppel-
bau wie S. Vitale in Ravenna, S. Sergius und Bacchus in Kon-
stantinopel, oder in der Sophienkirche vollends, den Aufbau mit
der Kuppel darüber in seinen drei Geschossen zusammen, so tritt
außerordentlich lehrreich und schlagend die Analogie mit den drei
Zonen der Bewegung hervor, die wir auf Grund physiologischer Or-
ganisation des Menschen unterscheiden und übereinander ordnen muß-
ten. Die Rhythmik unsres am Boden haftenden Ganges verbindet sich
kraft seiner „aufsteigenden“ Dipodie mit der Rhythmik unsrer Arm-
bewegungen und Hantierungen in der Gürtelzone, in der auch die
Ausdrucksbewegungen so vorwiegend spielen, und endlich mit der
Rhythmik der Blickbahnen, mit denen wir im letzten zusammenfassen-
den Aufschwung in die rein optische Region aufsteigen d. h. in den
Bilderkreis oder den Fensterkranz des Lichtgadens, über die Wand-
felder der Gurtbögen und die sphärischen Dreiecke der Zwickel zu
dem schwebenden Kuppelgewölbe selbst.
Der strenggeschlossene Strophenbau ist das entschei-
dende Merkmal für die Rhythmik des oströmischen Kirchen-
baues. Die immer erneute Durchführung der regelmäßigen
Reihe dagegen, das Gliederungsprinzip des Langhauses in
seinem ursprünglichen Wesen als Wandelbahn, entschied
den mannigfaltigen Entwicklungsgang der Rhythmik des
Abendlandes von den Anfängen der romanischen Basilika
bis zur gotischen Kathedrale. Und die Auflösung dieses Ge-
staltungsprinzips, die Abkehr von dem Bewegungsrhyth-
mus als treibender Kraft der ganzen Raumkomposition, zur
Beruhigung, zum Stillstand der Schau und damit zum Ein-
raum, bedeutet die Wendung zur Renaissance.
Schmarsow: Kompositionsgesetze
7
97
mehr für freies Einherwandeln und wechselnde Aufstellung wie der
Raum unten gedacht war, sondern gesammelten Zuschauern, sitzbe-
dürftigen Frauen und bevorzugten Gruppen der Gesellschaft, wie dem
Fürstenhaus und seinem Gefolge zum Aufenthalt dienen sollte. Das
war schon eine Aufforderung zu strengerer Umrahmung des ge-
schlossenen Bildes in dieser optischen Region für den untenstehenden
Beschauer, und die Zentralisationsmotive der Rhythmik haben ihren
Ursprung genommen. Nehmen wir endlich in solchem Innenraum
einer mehr oder minder zentralen Anlage, oder gar in einem Kuppel-
bau wie S. Vitale in Ravenna, S. Sergius und Bacchus in Kon-
stantinopel, oder in der Sophienkirche vollends, den Aufbau mit
der Kuppel darüber in seinen drei Geschossen zusammen, so tritt
außerordentlich lehrreich und schlagend die Analogie mit den drei
Zonen der Bewegung hervor, die wir auf Grund physiologischer Or-
ganisation des Menschen unterscheiden und übereinander ordnen muß-
ten. Die Rhythmik unsres am Boden haftenden Ganges verbindet sich
kraft seiner „aufsteigenden“ Dipodie mit der Rhythmik unsrer Arm-
bewegungen und Hantierungen in der Gürtelzone, in der auch die
Ausdrucksbewegungen so vorwiegend spielen, und endlich mit der
Rhythmik der Blickbahnen, mit denen wir im letzten zusammenfassen-
den Aufschwung in die rein optische Region aufsteigen d. h. in den
Bilderkreis oder den Fensterkranz des Lichtgadens, über die Wand-
felder der Gurtbögen und die sphärischen Dreiecke der Zwickel zu
dem schwebenden Kuppelgewölbe selbst.
Der strenggeschlossene Strophenbau ist das entschei-
dende Merkmal für die Rhythmik des oströmischen Kirchen-
baues. Die immer erneute Durchführung der regelmäßigen
Reihe dagegen, das Gliederungsprinzip des Langhauses in
seinem ursprünglichen Wesen als Wandelbahn, entschied
den mannigfaltigen Entwicklungsgang der Rhythmik des
Abendlandes von den Anfängen der romanischen Basilika
bis zur gotischen Kathedrale. Und die Auflösung dieses Ge-
staltungsprinzips, die Abkehr von dem Bewegungsrhyth-
mus als treibender Kraft der ganzen Raumkomposition, zur
Beruhigung, zum Stillstand der Schau und damit zum Ein-
raum, bedeutet die Wendung zur Renaissance.
Schmarsow: Kompositionsgesetze
7