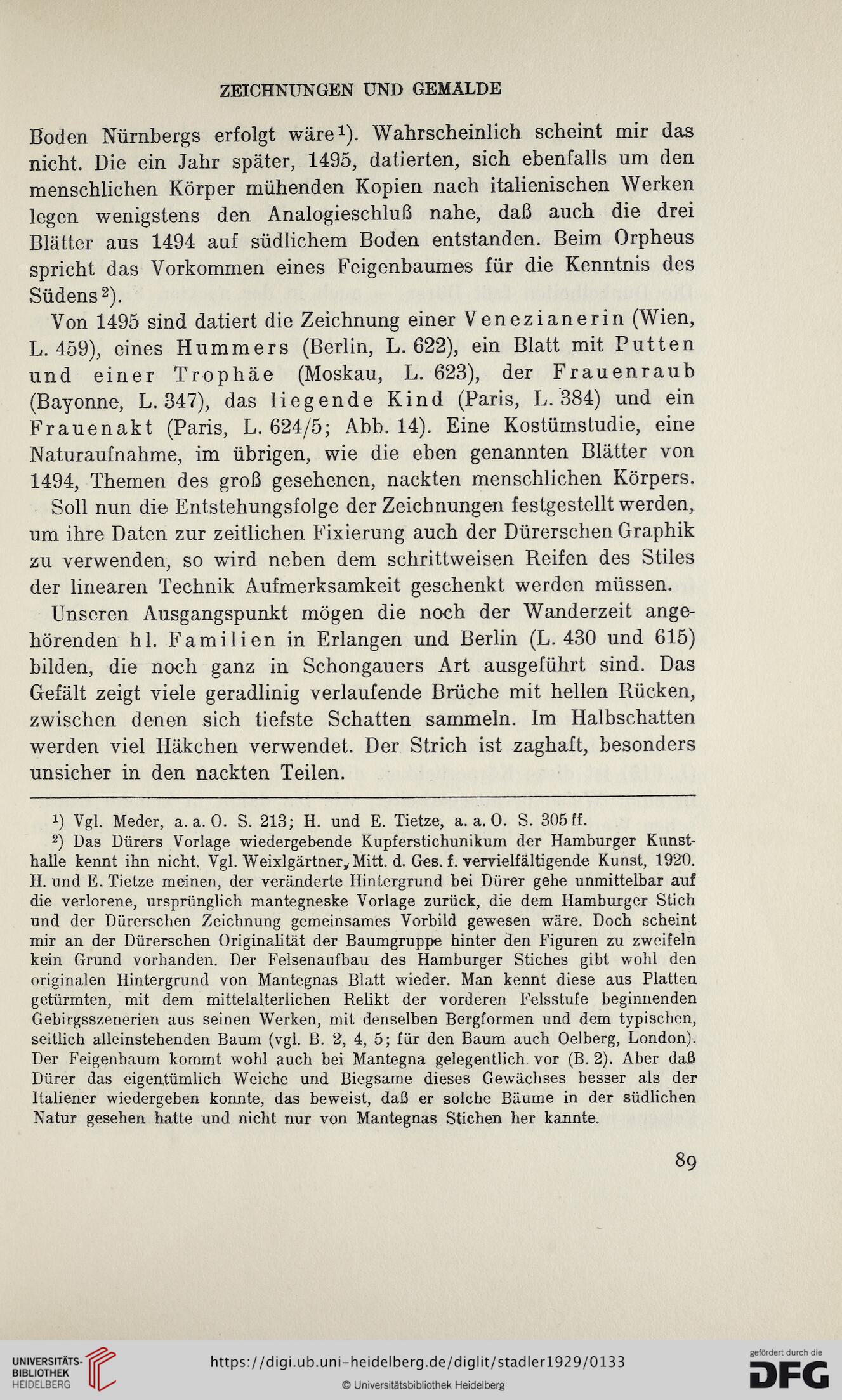ZEICHNUNGEN UND GEMÄLDE
Boden Nürnbergs erfolgt wäre1). Wahrscheinlich scheint mir das
nicht. Die ein Jahr später, 1495, datierten, sich ebenfalls um den
menschlichen Körper mühenden Kopien nach italienischen Werken
legen wenigstens den Analogieschluß nahe, daß auch die drei
Blätter aus 1494 auf südlichem Boden entstanden. Beim Orpheus
spricht das Vorkommen eines Feigenbaumes für die Kenntnis des
Südens 2).
Von 1495 sind datiert die Zeichnung einer Venezianerin (Wien,
L. 459), eines Hummers (Berlin, L. 622), ein Blatt mit Putten
und einer Trophäe (Moskau, L. 623), der Frauenraub
(Bayonne, L. 347), das liegende Kind (Paris, L. 384) und ein
Frauenakt (Paris, L. 624/5; Abb. 14). Eine Kostümstudie, eine
Naturaufnahme, im übrigen, wie die eben genannten Blätter von
1494, Themen des groß gesehenen, nackten menschlichen Körpers.
Soll nun die Entstehungsfolge der Zeichnungen festgestellt werden,
um ihre Daten zur zeitlichen Fixierung auch der Dürerschen Graphik
zu verwenden, so wird neben dem schrittweisen Reifen des Stiles
der linearen Technik Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen.
Unseren Ausgangspunkt mögen die noch der Wanderzeit ange-
hörenden hl. Familien in Erlangen und Berlin (L. 430 und 615)
bilden, die noch ganz in Schongauers Art ausgeführt sind. Das
Gefält zeigt viele geradlinig verlaufende Brüche mit hellen Rücken,
zwischen denen sich tiefste Schatten sammeln. Im Halbschatten
werden viel Häkchen verwendet. Der Strich ist zaghaft, besonders
unsicher in den nackten Teilen.
0 Vgl. Meder, a. a. 0. S. 213; H. und E. Tietze, a. a. 0. S. 305 ff.
2) Das Dürers Vorlage wiedergebende Kupferstichunikum der Hamburger Kunst-
halle kennt ihn nicht. Vgl. Weixlgärtnery Mitt. d. Ges. f. vervielfältigende Kunst, 1920.
H. und E. Tietze meinen, der veränderte Hintergrund bei Dürer gehe unmittelbar auf
die verlorene, ursprünglich mantegneske Vorlage zurück, die dem Hamburger Stich
und der Dürerschen Zeichnung gemeinsames Vorbild gewesen wäre. Doch scheint
mir an der Dürerschen Originalität der Baumgruppe hinter den Figuren zu zweifeln
kein Grund vorhanden. Der Felsenaufbau des Hamburger Stiches gibt wohl den
originalen Hintergrund von Mantegnas Blatt wieder. Man kennt diese aus Platten
getürmten, mit dem mittelalterlichen Relikt der vorderen Felsstufe beginnenden
Gebirgsszenerien aus seinen Werken, mit denselben Bergformen und dem typischen,
seitlich alleinstehenden Baum (vgl. B. 2, 4, 5; für den Baum auch Oelberg, London).
Der Feigenbaum kommt wohl auch bei Mantegna gelegentlich vor (B. 2). Aber daß
Dürer das eigentümlich Weiche und Biegsame dieses Gewächses besser als der
Italiener wiedergeben konnte, das beweist, daß er solche Bäume in der südlichen
Natur gesehen hatte und nicht nur von Mantegnas Stichen her kannte.
89
Boden Nürnbergs erfolgt wäre1). Wahrscheinlich scheint mir das
nicht. Die ein Jahr später, 1495, datierten, sich ebenfalls um den
menschlichen Körper mühenden Kopien nach italienischen Werken
legen wenigstens den Analogieschluß nahe, daß auch die drei
Blätter aus 1494 auf südlichem Boden entstanden. Beim Orpheus
spricht das Vorkommen eines Feigenbaumes für die Kenntnis des
Südens 2).
Von 1495 sind datiert die Zeichnung einer Venezianerin (Wien,
L. 459), eines Hummers (Berlin, L. 622), ein Blatt mit Putten
und einer Trophäe (Moskau, L. 623), der Frauenraub
(Bayonne, L. 347), das liegende Kind (Paris, L. 384) und ein
Frauenakt (Paris, L. 624/5; Abb. 14). Eine Kostümstudie, eine
Naturaufnahme, im übrigen, wie die eben genannten Blätter von
1494, Themen des groß gesehenen, nackten menschlichen Körpers.
Soll nun die Entstehungsfolge der Zeichnungen festgestellt werden,
um ihre Daten zur zeitlichen Fixierung auch der Dürerschen Graphik
zu verwenden, so wird neben dem schrittweisen Reifen des Stiles
der linearen Technik Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen.
Unseren Ausgangspunkt mögen die noch der Wanderzeit ange-
hörenden hl. Familien in Erlangen und Berlin (L. 430 und 615)
bilden, die noch ganz in Schongauers Art ausgeführt sind. Das
Gefält zeigt viele geradlinig verlaufende Brüche mit hellen Rücken,
zwischen denen sich tiefste Schatten sammeln. Im Halbschatten
werden viel Häkchen verwendet. Der Strich ist zaghaft, besonders
unsicher in den nackten Teilen.
0 Vgl. Meder, a. a. 0. S. 213; H. und E. Tietze, a. a. 0. S. 305 ff.
2) Das Dürers Vorlage wiedergebende Kupferstichunikum der Hamburger Kunst-
halle kennt ihn nicht. Vgl. Weixlgärtnery Mitt. d. Ges. f. vervielfältigende Kunst, 1920.
H. und E. Tietze meinen, der veränderte Hintergrund bei Dürer gehe unmittelbar auf
die verlorene, ursprünglich mantegneske Vorlage zurück, die dem Hamburger Stich
und der Dürerschen Zeichnung gemeinsames Vorbild gewesen wäre. Doch scheint
mir an der Dürerschen Originalität der Baumgruppe hinter den Figuren zu zweifeln
kein Grund vorhanden. Der Felsenaufbau des Hamburger Stiches gibt wohl den
originalen Hintergrund von Mantegnas Blatt wieder. Man kennt diese aus Platten
getürmten, mit dem mittelalterlichen Relikt der vorderen Felsstufe beginnenden
Gebirgsszenerien aus seinen Werken, mit denselben Bergformen und dem typischen,
seitlich alleinstehenden Baum (vgl. B. 2, 4, 5; für den Baum auch Oelberg, London).
Der Feigenbaum kommt wohl auch bei Mantegna gelegentlich vor (B. 2). Aber daß
Dürer das eigentümlich Weiche und Biegsame dieses Gewächses besser als der
Italiener wiedergeben konnte, das beweist, daß er solche Bäume in der südlichen
Natur gesehen hatte und nicht nur von Mantegnas Stichen her kannte.
89