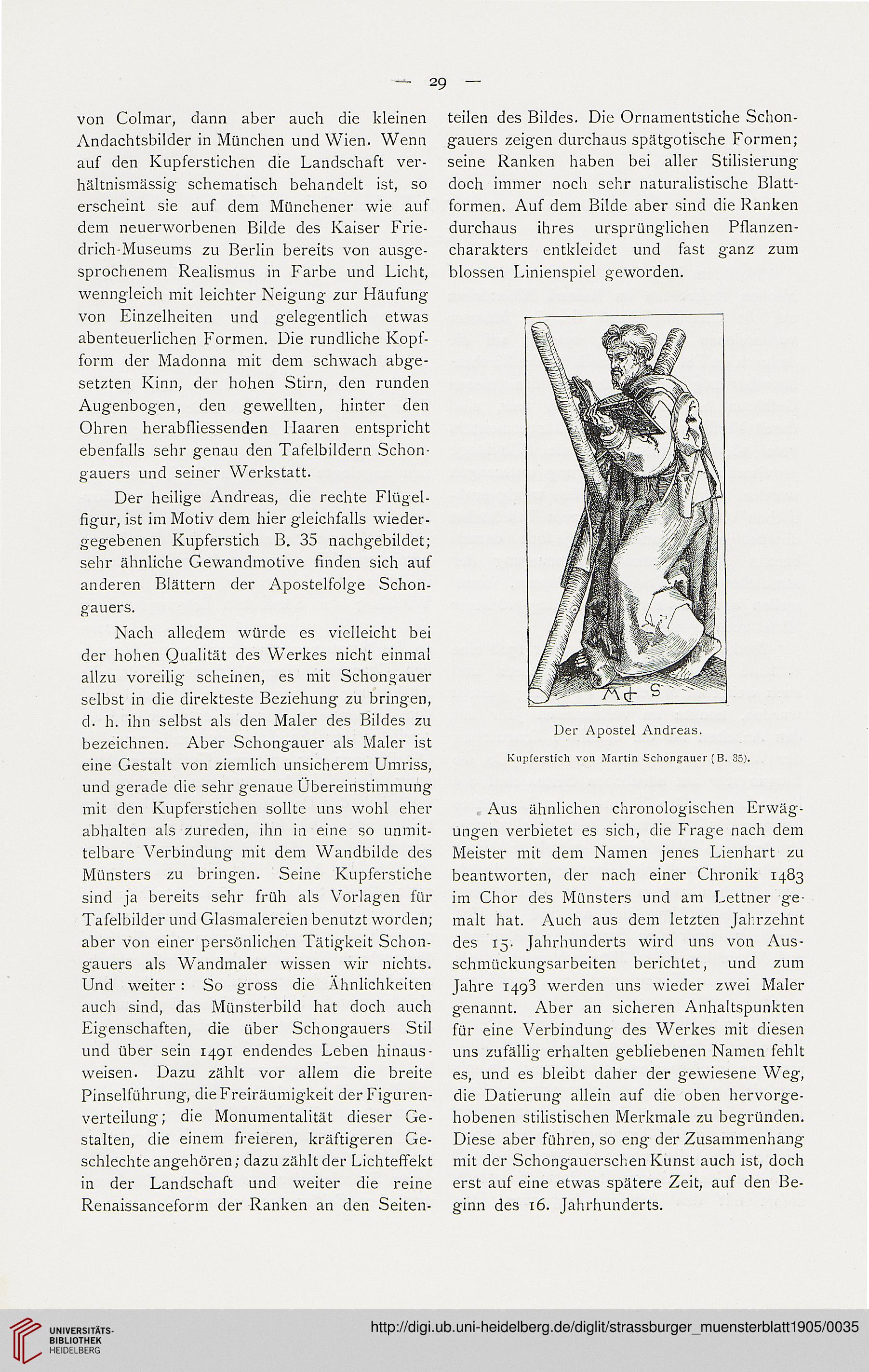— 29
von Colmar, dann aber auch die kleinen
Andachtsbilder in München und Wien. Wenn
auf den Kupferstichen die Landschaft ver-
hältnismässig schematisch behandelt ist, so
erscheint sie auf dem Münchener wie auf
dem neuerworbenen Bilde des Kaiser Frie-
drich-Museums zu Berlin bereits von ausge-
sprochenem Realismus in Farbe und Licht,
wenngleich mit leichter Neigung zur Häufung
von Einzelheiten und gelegentlich etwas
abenteuerlichen Formen. Die rundliche Kopf-
form der Madonna mit dem schwach abge-
setzten Kinn, der hohen Stirn, den runden
Augenbogen, den gewellten, hinter den
Ohren herabfliessenden Haaren entspricht
ebenfalls sehr genau den Tafelbildern Schon-
gauers und seiner Werkstatt.
Der heilige Andreas, die rechte Flügel-
figur, ist im Motiv dem hier gleichfalls wieder-
gegebenen Kupferstich B. 35 nachgebildet;
sehr ähnliche Gewandmotive finden sich auf
anderen Blättern der Apostelfolge Schon-
gauers.
Nach alledem würde es vielleicht bei
der hohen Qualität des Werkes nicht einmal
allzu voreilig scheinen, es mit Schongauer
selbst in die direkteste Beziehung zu bringen,
d. h. ihn selbst als den Maler des Bildes zu
bezeichnen. Aber Schongauer als Maler ist
eine Gestalt von ziemlich unsicherem Umriss,
und gerade die sehr genaue Übereinstimmung
mit den Kupferstichen sollte uns wohl eher
abhalten als zureden, ihn in eine so unmit-
telbare Verbindung mit dem Wandbilde des
Münsters zu bringen. Seine Kupferstiche
sind ja bereits sehr früh als Vorlagen für
Tafelbilder und Glasmalereien benutzt worden;
aber von einer persönlichen Tätigkeit Schon-
gauers als Wandmaler wissen wir nichts.
Und weiter: So gross die Ähnlichkeiten
auch sind, das Münsterbild hat doch auch
Eigenschaften, die über Schongauers Stil
und über sein 1491 endendes Leben hinaus -
weisen. Dazu zählt vor allem die breite
Pinselführung, die Freiräumigkeit der Figuren-
verteilung; die Monumentalität dieser Ge-
stalten, die einem freieren, kräftigeren Ge-
schlechte angehören; dazu zählt der Lichteffekt
in der Landschaft und weiter die reine
Renaissanceform der Ranken an den Seiten-
teilen des Bildes. Die Ornamentstiche Schon-
gauers zeigen durchaus spätgotische Formen;
seine Ranken haben bei aller Stilisierung
doch immer noch sehr naturalistische Blatt-
formen. Auf dem Bilde aber sind die Ranken
durchaus ihres ursprünglichen Pflanzen-
charakters entkleidet und fast ganz zum
blossen Linienspiel geworden.
Der Apostel Andreas.
Kupferstich von Martin Schongauer (B. 35).
Aus ähnlichen chronologischen Erwäg-
ungen verbietet es sich, die Frage nach dem
Meister mit dem Namen jenes Lienhart zu
beantworten, der nach einer Chronik 1483
im Chor des Münsters und am Lettner ge-
malt hat. Auch aus dem letzten Jahrzehnt
des 15. Jahrhunderts wird uns von Aus-
schmückungsarbeiten berichtet, und zum
Jahre 1493 werden uns wieder zwei Maler
genannt. Aber an sicheren Anhaltspunkten
für eine Verbindung des Werkes mit diesen
uns zufällig erhalten gebliebenen Namen fehlt
es, und es bleibt daher der gewiesene Weg,
die Datierung allein auf die oben hervorge-
hobenen stilistischen Merkmale zu begründen.
Diese aber führen, so eng der Zusammenhang
mit der Schongauerschen Kunst auch ist, doch
erst auf eine etwas spätere Zeit, auf den Be-
ginn des 16. Jahrhunderts.
von Colmar, dann aber auch die kleinen
Andachtsbilder in München und Wien. Wenn
auf den Kupferstichen die Landschaft ver-
hältnismässig schematisch behandelt ist, so
erscheint sie auf dem Münchener wie auf
dem neuerworbenen Bilde des Kaiser Frie-
drich-Museums zu Berlin bereits von ausge-
sprochenem Realismus in Farbe und Licht,
wenngleich mit leichter Neigung zur Häufung
von Einzelheiten und gelegentlich etwas
abenteuerlichen Formen. Die rundliche Kopf-
form der Madonna mit dem schwach abge-
setzten Kinn, der hohen Stirn, den runden
Augenbogen, den gewellten, hinter den
Ohren herabfliessenden Haaren entspricht
ebenfalls sehr genau den Tafelbildern Schon-
gauers und seiner Werkstatt.
Der heilige Andreas, die rechte Flügel-
figur, ist im Motiv dem hier gleichfalls wieder-
gegebenen Kupferstich B. 35 nachgebildet;
sehr ähnliche Gewandmotive finden sich auf
anderen Blättern der Apostelfolge Schon-
gauers.
Nach alledem würde es vielleicht bei
der hohen Qualität des Werkes nicht einmal
allzu voreilig scheinen, es mit Schongauer
selbst in die direkteste Beziehung zu bringen,
d. h. ihn selbst als den Maler des Bildes zu
bezeichnen. Aber Schongauer als Maler ist
eine Gestalt von ziemlich unsicherem Umriss,
und gerade die sehr genaue Übereinstimmung
mit den Kupferstichen sollte uns wohl eher
abhalten als zureden, ihn in eine so unmit-
telbare Verbindung mit dem Wandbilde des
Münsters zu bringen. Seine Kupferstiche
sind ja bereits sehr früh als Vorlagen für
Tafelbilder und Glasmalereien benutzt worden;
aber von einer persönlichen Tätigkeit Schon-
gauers als Wandmaler wissen wir nichts.
Und weiter: So gross die Ähnlichkeiten
auch sind, das Münsterbild hat doch auch
Eigenschaften, die über Schongauers Stil
und über sein 1491 endendes Leben hinaus -
weisen. Dazu zählt vor allem die breite
Pinselführung, die Freiräumigkeit der Figuren-
verteilung; die Monumentalität dieser Ge-
stalten, die einem freieren, kräftigeren Ge-
schlechte angehören; dazu zählt der Lichteffekt
in der Landschaft und weiter die reine
Renaissanceform der Ranken an den Seiten-
teilen des Bildes. Die Ornamentstiche Schon-
gauers zeigen durchaus spätgotische Formen;
seine Ranken haben bei aller Stilisierung
doch immer noch sehr naturalistische Blatt-
formen. Auf dem Bilde aber sind die Ranken
durchaus ihres ursprünglichen Pflanzen-
charakters entkleidet und fast ganz zum
blossen Linienspiel geworden.
Der Apostel Andreas.
Kupferstich von Martin Schongauer (B. 35).
Aus ähnlichen chronologischen Erwäg-
ungen verbietet es sich, die Frage nach dem
Meister mit dem Namen jenes Lienhart zu
beantworten, der nach einer Chronik 1483
im Chor des Münsters und am Lettner ge-
malt hat. Auch aus dem letzten Jahrzehnt
des 15. Jahrhunderts wird uns von Aus-
schmückungsarbeiten berichtet, und zum
Jahre 1493 werden uns wieder zwei Maler
genannt. Aber an sicheren Anhaltspunkten
für eine Verbindung des Werkes mit diesen
uns zufällig erhalten gebliebenen Namen fehlt
es, und es bleibt daher der gewiesene Weg,
die Datierung allein auf die oben hervorge-
hobenen stilistischen Merkmale zu begründen.
Diese aber führen, so eng der Zusammenhang
mit der Schongauerschen Kunst auch ist, doch
erst auf eine etwas spätere Zeit, auf den Be-
ginn des 16. Jahrhunderts.