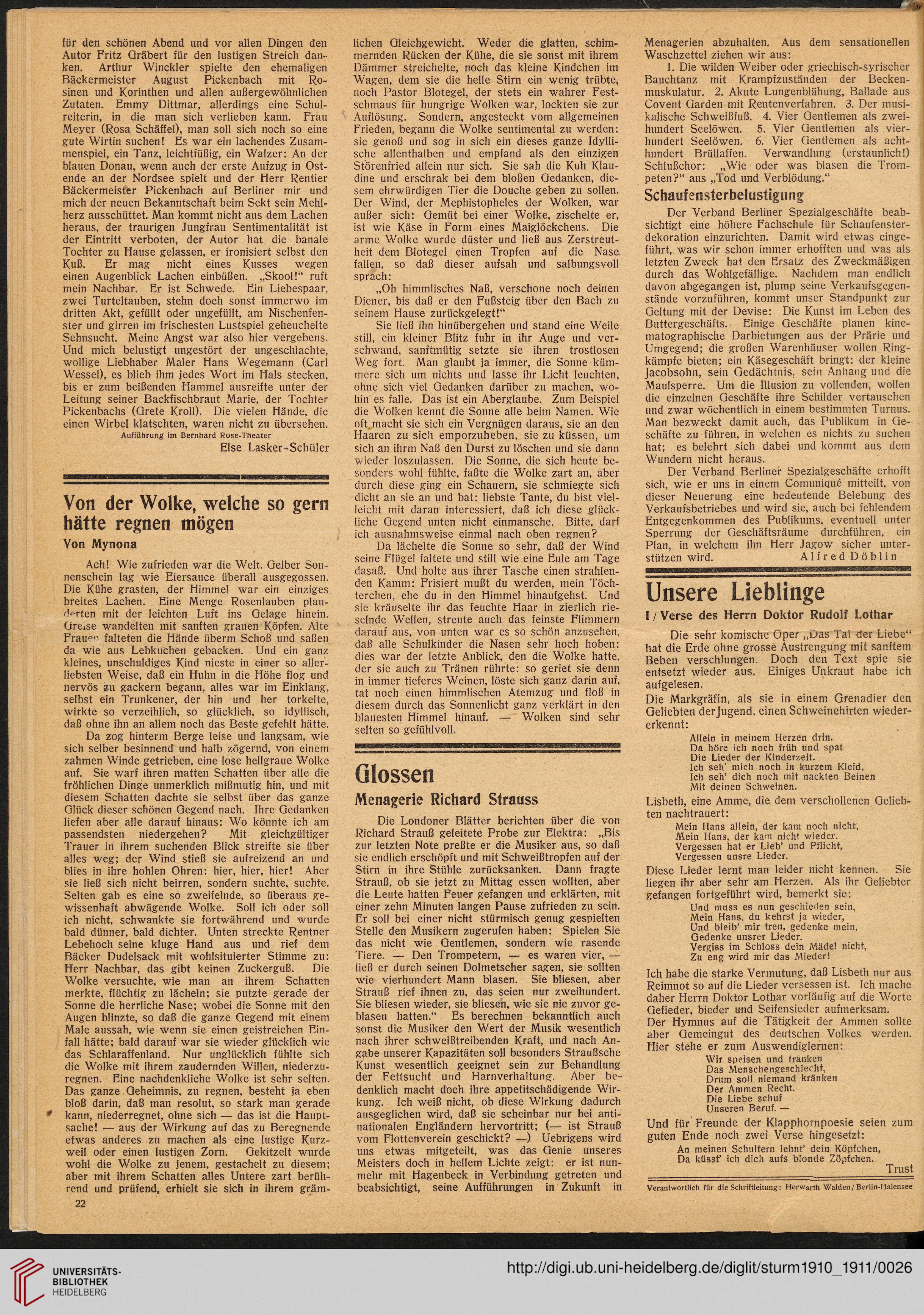für den schönen Abend und vor allen Dingen den
Autor Fritz Qräbert für den lustigen Streich dan-
ken. Arthur Winckler spielte den ehemaligen
Bäckermeister August Pickenbach mit Ro-
sinen und Korinthen und allen außergewöhnlichen
Zutaten. Emmy Dittmar, allerdings eine Schul-
reiterin, in die man sich verlieben kann. Frau
Meyer (Rosa Schäffel), man soll sich noch so eine
gute Wirtin suchen! Es war ein lachendes Zusam-
menspiel, ein Tanz, leichtfüßig, ein Walzer: An der
blauen Donau, wenn auch der erste Aufzug in Ost-
ende an der Nordsee spielt und der Herr Rentier
Bäckermeister Pickenbach auf Berliner mir und
mich der neuen Bekanntschaft beim Sekt sein Mehl-
herz ausschüttet. Man kommt nicht aus dem Lachen
heraus, der traurigen Jungfrau Sentimentalität ist
der Eintritt verboten, der Autor hat die banale
Tochter zu Hause gelassen, er ironisiert selbst den
Kuß. Er mag nicht eines Kusses wegen
einen Augenbiick Lachen einbüßen. „Skool!“ ruft
mein Nachbar. Er ist Schwede. Ein Liebespaar,
zwei Turteltauben, stehn doch sonst immerwo im
dritten Akt, gefüllt oder ungefüllt, am Nischenfen-
ster und girren im frischesten Lustspiel geheuchelte
Sehnsucht. Meine Angst war also hier vergebens.
Und mich belustigt ungestört der ungeschlachte,
wollige Liebhaber Maler Hans Wegemann (Carl
Wessel), es blieb ihm jedes Wort im Hals stecken,
bis er zum beißenden Hammel ausreifte unter der
Leitung seiner Backfischbraut Marie, der Tochter
Pickenbachs (Qrete Kroll). Die vielen Hände, die
einen Wirbel klatschten, waren nicht zu übersehen.
Aufführung im Bernhard Rose-Theater
Else Lasker-Schüler
Von der Wolke, welche so gern
hätte regnen mögen
Von Mynona
Ach! Wie zufrieden war die Welt. Qelber Son-
nenschein lag wie Eiersauce überall ausgegossen.
Die Kühe grasten, der Himmel war ein einziges
breites Lachen. Eine Menge Rosenlauben plau-
d^rten mit der leichten Luft ins Qelage hinein.
Qre.se wandelten mit sanften grauen Köpfen. Alte
Frau oti falteten die Hände überm Schoß und saßen
da wie aus Lebkuchen gebacken. Und ein ganz
kleines, unschuldiges Kind nieste in einer so aller-
liebsten Weise, daß ein Huhn in die Höhe flog und
nervös *u gackern begann, alles war im Einklang,
selbst ein Trunkener, der hin und her torkelte,
wirkte so verzeihlich, so glücklich, so idyllisch,
daß ohne ihn an allem noch das Beste gefehlt hätte.
Da zog hinterm Berge leise und langsam, wie
sich selber besinnend und halb zögernd, von einem
zahmen Winde getrieben, eine lose hellgraue Wolke
auf. Sie warf ihren matten Schatten über alle die
fröhlichen Dinge unmerklich mißmutig hin, und mit
diesem Schatten dachte sie selbst über das ganze
Glück dieser schönen Qegend nach. Ihre Qedanken
liefen aber alle darauf hinaus: Wo könnte ich am
passendsten niedergehen? Mit gleichgültiger
Trauer in ihrem suchenden Blick streifte sie über
alles weg; der Wind stieß sie aufreizend an und
blies in ihre hohlen Ohren: hier, hier, hier! Aber
sie ließ sich nicht beirren, sondern suchte, suchte.
Selten gab es eine so zweifelnde, so überaus ge-
wissenhaft abwägende Wolke. Soll ich oder soll
ich nicht, schwankte sie fortwährend und wurde
bald dünner, bald dichter. Unten streckte Rentner
Lebehoch seine kluge Hand aus und rief dem
Bäcker Dudelsack mit wohlsituierter Stimme zu:
Herr Nachbar, das gibt keinen Zuckerguß. Die
Wolke versuchte, wie man an ihrem Schatten
merkte, flüchtig zu lächeln; sie putzte gerade der
Sonne die herrliche Nase; wobei die Sonne mit den
Augen blinzte, so daß die ganze Qegend mit einem
Male aussah, wie wenn sie einen geistreichen Ein-
fall hätte; bald darauf war sie wieder glücklich wie
das Schlaraffenland. Nur unglücklich fühlte sich
die Wolke mit ihrem zaudernden Willen, niederzu-
regnen. Eine nachdenkliche Wolke ist sehr selten.
Das ganze Qeheimnis, zu regnen, besteht ja eben
bloß darin, daß man resolut, so stark man gerade
kann, niederregnet, ohne sich — das ist die Haupt-
sache! — aus der Wirkung auf das zu Beregnende
etwas anderes zu machen als eine lustige Kurz-
weil oder einen lustigen Zorn. Qekitzelt wurde
wohl die Wolke zu jenem, gestachelt zu diesem;
aber mit ihrem Schatten alles Untere zart berüh-
rend und prüfend, erhielt sie sich in ihrem gräm-
22
lichen Gleichgewicht. Weder die glatten, schim-
mernden Rücken der Kühe, die sie sonst mit ihrem
Dämmer streichelte, noch das kleine Kindchen im
Wagen, dem sie die helle Stirn ein wenig trübte,
noch Pastor Blotegel, der stets ein wahrer Fest-
schmaus für hungrige Wolken war, lockten sie zur
Auflösung. Sondern, angesteckt vom allgemeinen
Frieden, begann die Wolke sentimental zu werden:
sie genoß und sog in sich ein dieses ganze Idylli-
sche allenthalben und empfand als den einzigen
Störenfried allein nur sich. Sie sah die Kuh Klau-
dine und erschrak bei dem bloßen Qedanken, die-
sem ehrwürdigen Tier die Douche geben zu sollen.
Der Wind, der Mephistopheles der Wolken, war
außer sich: Gemüt bei einer Wolke, zischelte er,
ist wie Käse in Form eines Maiglöckchens. Die
arme Wolke wurde düster und ließ aus Zerstreut-
heit dem Blotegel einen Tropfen auf die Nase
fallen, so daß dieser aufsah und salbungsvoll
sprach:
„Oh himmlisches Naß, verschone noch deinen
Diener, bis daß er den Fußsteig über den Bach zu
seinem Hause zurückgelegt!“
Sie ließ ihn hinübergehen und stand eine Weile
still, ein kleiner Blitz fuhr in ihr Auge und ver-
schwand, sanftmütig setzte sie ihren trostlosen
Weg fort. Man glaubt ja immer, die Sonne küm-
mere sich um nichts und lasse ihr Licht leuchten,
ohne sich viel Qedanken darüber zu machen, wo-
hin es falle. Das ist ein Aberglaube. Zum Beispiel
die Wolken kennt die Sonne alle beim Namen. Wie
oft macht sie sich ein Vergnügen daraus, sie an den
Haaren zu sich emporzuheben, sie zu küssen, um
sich an ihrm Naß den Durst zu löschen und sie dann
wieder loszulassen. Die Sonne, die sich heute be-
sonders wohl fühlte, faßte die Wolke zart an, aber
durch diese ging ein Schauern, sie schmiegte sich
dicht an sie an und bat: liebste Tante, du bist viel-
leicht mit daran interessiert, daß ich diese glück-
liche Qegend unten nicht einmansche. Bitte, darf
ich ausnahmsweise einmal nach oben regnen?
Da lächelte die Sonne so sehr, daß der Wind
seine Flügel faltetc und still wie eine Eule am Tage
dasaß. Und holte aus ihrer Tasche einen strahlen-
den Kamm: Frisiert mußt du werden, mein Töch-
terchen, ehe du in den Himmel hinaufgehst. Und
sie kräuselte ihr das feuchte Haar in zierlich rie-
selnde Wellen, streute auch das feinste Flimmern
darauf aus, von unten war es so schön anzusehen.
daß alle Schulkinder die Nasen sehr hoch hoben:
dies war der letzte Anblick, den die Wolke hatte,
der sie auch zu Tränen rührte: so geriet sie denn
in immer tieferes Weinen, löste sich ganz darin auf,
tat noch einen himmlischen Atemzug und floß in
diesem durch das Sonnenlicht ganz verklärt in dcn
blauesten Himmel hinauf. — Wolken sind sehr
selten so gefühlvoll.
Glossen
Menagerie Richard Strauss
Die Londoner Blätter berichten über die von
Richard Strauß geleitete Probe zur Elektra: „Bis
zur letzten Note preßte er die Musiker aus, so daß
sie endlich erschöpft und mit Schweißtropfen auf der
Stirn in ihre Stühle zurücksanken. Dann fragte
Strauß, ob sie jetzt zu Mittag essen wollten, aber
die Leute hatten Feuer gefangen und erklärten, mit
einer zehn Minuten langen Pause zufrieden zu sein.
Er soll bei einer nicht stürmisch genug gespielten
Stelle den Musikern zugerufen haben: Spielen Sie
das nicht wie Qentlemen, sondern wie rasende
Tiere. — Den Trompetern, — es waren vier, —
ließ er durch seinen Dolmetscher sagen, sie sollten
wie vierhundert Mann blasen. Sie bliesen, aber
Strauß rief ihnen zu, das seien nur zweihundert.
Sie bliesen wieder, sie bliesen, wie sie nie zuvor ge-
blasen hatten.“ Es berechnen bekanntlich auch
sonst die Musiker den Wert der Musik wesentlich
nach ihrer schweißtreibenden Kraft, und nach An-
gabe unserer Kapazitäten soll besonders Straußsche
Kunst wesentlich geeignet sein zur Behandlung
der Fettsucht und Harnverhaltung. Aber be-
denklich macht doch ihre appetitschädigende Wir-
kung. Ich weiß nicht, ob diese Wirkung dadurch
ausgeglichen wird, daß sie scheinbar nur bei anti-
nationalen Engländern hervortritt; (— ist Strauß
vom Flottenverein geschickt? —) Uebrigens wird
uns etwas mitgeteilt, was das Qenie unseres
Meisters doch in hellem Lichte zeigt: er ist nun-
mehr mit Hagenbeck in Verbindung getreten und
beabsichtigt, seine Aufführungen in Zukunft in
Menagerien abzuhalten. Aus dem sensationellen
Waschzettel ziehen wir aus:
1. Die wilden Weiber oder griechisch-syrischer
Bauchtanz mit Krampfzuständen der Becken-
muskulatur. 2. Akute Lungenblähung, Ballade aus
Covent Qarden mit Rentenverfahren. 3. Der musi-
kalische Schweißfuß. 4. Vier Qentlemen als zwei-
hundert Seelöwen. 5. Vier Qentlemen als vier-
hundert Seelöwen. 6. Vier Gentlemen als acht-
hundert Brüllaffen. Verwandlung (erstaunlich!)
Schlußchor: „Wie oder was blasen die Trom-
peten?“ aus „Tod und Verblödung.“
Schaufensterbelustigung
Der Verband Berliner Spezialgeschäfte beab-
sichtigt eine höhere Fachschule für Schaufenster-
dekoration einzurichten. Damit wird etwas einge-
führt, was wir schon immer erhofften und was als
letzten Zweck hat den Ersatz des Zweckmäßigen
durch das Wohlgefällige. Nachdem man endlich
davon abgegangen ist, plump seine Verkaufsgegen-
stände vorzuführen, kommt unser Standpunkt zur
Geltung mit der Devise: Die Kunst im Leben des
Buttergeschäfts. Einige Qeschäfte planen kine-
matographische Darbietungen aus der Prärie und
Umgegend; die großen Warenhäuser wollen Ring-
kämpfe bieten; ein Käsegeschäft bringt: der kleine
Jacobsohn, sein Gedächtnis, sein Anhang und die
Maulsperre. Um die Illusion zu vollenden, wollen
die einzelnen Qeschäfte ihre Schilder vertauschen
und zwar wöchentlich in einem bestimmten Turnus.
Man bezweckt damit auch, das Publikum in Ge-
schäfte zu führen, in welchen es nichts zu suchen
hat; es belehrt sich dabei und kommt aus dem
Wundern nicht heraus.
Der Verband Berliner Spezialgeschäfte erhofft
sich, wie er uns in einem Comunique mitteilt, von
dieser Neuerung eine bedeutende Belebung des
Verkaufsbetriebes und wird sie, auch bei fehlendem
Entgegenkommen des Publikums, eventuell unter
Sperrung der Geschäftsräume durchführen, ein
Plan, in welchem ihn Herr Jagow sicher unter-
stützen wird. Alfred Döblin
Unsere Lieblinge
I / Verse des Herrn Doktor Rudolf Lothar
Die sehr komische Qper „Das Tal der Liebe“
hat die Erde ohne grosse Austrengung mit sanftem
Beben verschlungen. Doch den Text spie sie
entsetzt wieder aus. Einiges Unkraut habe ich
aufgelesen.
Die Markgräfin, als sie in einem Grenadier den
Geliebten derjugend, einen Schweinehirten wieder-
erkennt:
Allein in raeinem Herzen drin,
Da höre ich noch früh und spat
Die Lieder der Kinderzeit.
lch seh’ mich noch in kurzem Kleid,
Ich seh’ dich noch mit nackten Beinen
Mit deinen Schweinen.
Lisbeth, eine Amme, die dem verschollenen Qelieb-
ten nachtrauert:
Mein Hans allein, der kam noch nicht,
Mein Hans, der kam nicht wieder.
Vergessen hat er Lieb’ und Pflicht,
Vergessen unsre Lieder.
Diese Lieder lernt man leider nicht kennen. Sie
liegen ihr aber sehr am Herzen. Als ihr Geliebter
gefangen fortgeführt wird, bemerkt sie:
Und muss es nun geschieden sein,
Mein Hans, du kehrst ja wieder,
Und bleib’ mir treu, gedenke mein,
Gedenke unsrer Lieder.
Vergiss im Schloss dein Mädel nicht.
Zu eng wird mir das Mieder!
Ich habe die starke Vermutung, daß Lisbeth nur aus
Reimnot so auf die Lieder versessen ist. Ich mache
daher Herrn Doktor Lothar vorläufig auf die Worte
Gefieder, bieder und Seifensieder aufmerksam.
Der Hymnus auf die Tätigkeit der Ammen sollte
aber Qemeingut des deutschen Volkes werden.
Hier stehe er zum Auswendiglernen:
Wir speisen und tränken
Das Menschengeschlecht,
Drum soll niemand kränken
Der Ammen Recht.
Die Liebe schuf
Unseren Beruf. —
Und für Freunde der Klapphornpoesie seien zum
guten Ende noch zwei Verse hingesetzt:
An meinen Schultern lehnt’ dein Köpfchen,
Da küsst’ ich dich aufs blonde Zöpfchen.
___Trust
Verantwortlich fiir die Schriftleitung: Herwarth Walden/Berlin-Halensee
Autor Fritz Qräbert für den lustigen Streich dan-
ken. Arthur Winckler spielte den ehemaligen
Bäckermeister August Pickenbach mit Ro-
sinen und Korinthen und allen außergewöhnlichen
Zutaten. Emmy Dittmar, allerdings eine Schul-
reiterin, in die man sich verlieben kann. Frau
Meyer (Rosa Schäffel), man soll sich noch so eine
gute Wirtin suchen! Es war ein lachendes Zusam-
menspiel, ein Tanz, leichtfüßig, ein Walzer: An der
blauen Donau, wenn auch der erste Aufzug in Ost-
ende an der Nordsee spielt und der Herr Rentier
Bäckermeister Pickenbach auf Berliner mir und
mich der neuen Bekanntschaft beim Sekt sein Mehl-
herz ausschüttet. Man kommt nicht aus dem Lachen
heraus, der traurigen Jungfrau Sentimentalität ist
der Eintritt verboten, der Autor hat die banale
Tochter zu Hause gelassen, er ironisiert selbst den
Kuß. Er mag nicht eines Kusses wegen
einen Augenbiick Lachen einbüßen. „Skool!“ ruft
mein Nachbar. Er ist Schwede. Ein Liebespaar,
zwei Turteltauben, stehn doch sonst immerwo im
dritten Akt, gefüllt oder ungefüllt, am Nischenfen-
ster und girren im frischesten Lustspiel geheuchelte
Sehnsucht. Meine Angst war also hier vergebens.
Und mich belustigt ungestört der ungeschlachte,
wollige Liebhaber Maler Hans Wegemann (Carl
Wessel), es blieb ihm jedes Wort im Hals stecken,
bis er zum beißenden Hammel ausreifte unter der
Leitung seiner Backfischbraut Marie, der Tochter
Pickenbachs (Qrete Kroll). Die vielen Hände, die
einen Wirbel klatschten, waren nicht zu übersehen.
Aufführung im Bernhard Rose-Theater
Else Lasker-Schüler
Von der Wolke, welche so gern
hätte regnen mögen
Von Mynona
Ach! Wie zufrieden war die Welt. Qelber Son-
nenschein lag wie Eiersauce überall ausgegossen.
Die Kühe grasten, der Himmel war ein einziges
breites Lachen. Eine Menge Rosenlauben plau-
d^rten mit der leichten Luft ins Qelage hinein.
Qre.se wandelten mit sanften grauen Köpfen. Alte
Frau oti falteten die Hände überm Schoß und saßen
da wie aus Lebkuchen gebacken. Und ein ganz
kleines, unschuldiges Kind nieste in einer so aller-
liebsten Weise, daß ein Huhn in die Höhe flog und
nervös *u gackern begann, alles war im Einklang,
selbst ein Trunkener, der hin und her torkelte,
wirkte so verzeihlich, so glücklich, so idyllisch,
daß ohne ihn an allem noch das Beste gefehlt hätte.
Da zog hinterm Berge leise und langsam, wie
sich selber besinnend und halb zögernd, von einem
zahmen Winde getrieben, eine lose hellgraue Wolke
auf. Sie warf ihren matten Schatten über alle die
fröhlichen Dinge unmerklich mißmutig hin, und mit
diesem Schatten dachte sie selbst über das ganze
Glück dieser schönen Qegend nach. Ihre Qedanken
liefen aber alle darauf hinaus: Wo könnte ich am
passendsten niedergehen? Mit gleichgültiger
Trauer in ihrem suchenden Blick streifte sie über
alles weg; der Wind stieß sie aufreizend an und
blies in ihre hohlen Ohren: hier, hier, hier! Aber
sie ließ sich nicht beirren, sondern suchte, suchte.
Selten gab es eine so zweifelnde, so überaus ge-
wissenhaft abwägende Wolke. Soll ich oder soll
ich nicht, schwankte sie fortwährend und wurde
bald dünner, bald dichter. Unten streckte Rentner
Lebehoch seine kluge Hand aus und rief dem
Bäcker Dudelsack mit wohlsituierter Stimme zu:
Herr Nachbar, das gibt keinen Zuckerguß. Die
Wolke versuchte, wie man an ihrem Schatten
merkte, flüchtig zu lächeln; sie putzte gerade der
Sonne die herrliche Nase; wobei die Sonne mit den
Augen blinzte, so daß die ganze Qegend mit einem
Male aussah, wie wenn sie einen geistreichen Ein-
fall hätte; bald darauf war sie wieder glücklich wie
das Schlaraffenland. Nur unglücklich fühlte sich
die Wolke mit ihrem zaudernden Willen, niederzu-
regnen. Eine nachdenkliche Wolke ist sehr selten.
Das ganze Qeheimnis, zu regnen, besteht ja eben
bloß darin, daß man resolut, so stark man gerade
kann, niederregnet, ohne sich — das ist die Haupt-
sache! — aus der Wirkung auf das zu Beregnende
etwas anderes zu machen als eine lustige Kurz-
weil oder einen lustigen Zorn. Qekitzelt wurde
wohl die Wolke zu jenem, gestachelt zu diesem;
aber mit ihrem Schatten alles Untere zart berüh-
rend und prüfend, erhielt sie sich in ihrem gräm-
22
lichen Gleichgewicht. Weder die glatten, schim-
mernden Rücken der Kühe, die sie sonst mit ihrem
Dämmer streichelte, noch das kleine Kindchen im
Wagen, dem sie die helle Stirn ein wenig trübte,
noch Pastor Blotegel, der stets ein wahrer Fest-
schmaus für hungrige Wolken war, lockten sie zur
Auflösung. Sondern, angesteckt vom allgemeinen
Frieden, begann die Wolke sentimental zu werden:
sie genoß und sog in sich ein dieses ganze Idylli-
sche allenthalben und empfand als den einzigen
Störenfried allein nur sich. Sie sah die Kuh Klau-
dine und erschrak bei dem bloßen Qedanken, die-
sem ehrwürdigen Tier die Douche geben zu sollen.
Der Wind, der Mephistopheles der Wolken, war
außer sich: Gemüt bei einer Wolke, zischelte er,
ist wie Käse in Form eines Maiglöckchens. Die
arme Wolke wurde düster und ließ aus Zerstreut-
heit dem Blotegel einen Tropfen auf die Nase
fallen, so daß dieser aufsah und salbungsvoll
sprach:
„Oh himmlisches Naß, verschone noch deinen
Diener, bis daß er den Fußsteig über den Bach zu
seinem Hause zurückgelegt!“
Sie ließ ihn hinübergehen und stand eine Weile
still, ein kleiner Blitz fuhr in ihr Auge und ver-
schwand, sanftmütig setzte sie ihren trostlosen
Weg fort. Man glaubt ja immer, die Sonne küm-
mere sich um nichts und lasse ihr Licht leuchten,
ohne sich viel Qedanken darüber zu machen, wo-
hin es falle. Das ist ein Aberglaube. Zum Beispiel
die Wolken kennt die Sonne alle beim Namen. Wie
oft macht sie sich ein Vergnügen daraus, sie an den
Haaren zu sich emporzuheben, sie zu küssen, um
sich an ihrm Naß den Durst zu löschen und sie dann
wieder loszulassen. Die Sonne, die sich heute be-
sonders wohl fühlte, faßte die Wolke zart an, aber
durch diese ging ein Schauern, sie schmiegte sich
dicht an sie an und bat: liebste Tante, du bist viel-
leicht mit daran interessiert, daß ich diese glück-
liche Qegend unten nicht einmansche. Bitte, darf
ich ausnahmsweise einmal nach oben regnen?
Da lächelte die Sonne so sehr, daß der Wind
seine Flügel faltetc und still wie eine Eule am Tage
dasaß. Und holte aus ihrer Tasche einen strahlen-
den Kamm: Frisiert mußt du werden, mein Töch-
terchen, ehe du in den Himmel hinaufgehst. Und
sie kräuselte ihr das feuchte Haar in zierlich rie-
selnde Wellen, streute auch das feinste Flimmern
darauf aus, von unten war es so schön anzusehen.
daß alle Schulkinder die Nasen sehr hoch hoben:
dies war der letzte Anblick, den die Wolke hatte,
der sie auch zu Tränen rührte: so geriet sie denn
in immer tieferes Weinen, löste sich ganz darin auf,
tat noch einen himmlischen Atemzug und floß in
diesem durch das Sonnenlicht ganz verklärt in dcn
blauesten Himmel hinauf. — Wolken sind sehr
selten so gefühlvoll.
Glossen
Menagerie Richard Strauss
Die Londoner Blätter berichten über die von
Richard Strauß geleitete Probe zur Elektra: „Bis
zur letzten Note preßte er die Musiker aus, so daß
sie endlich erschöpft und mit Schweißtropfen auf der
Stirn in ihre Stühle zurücksanken. Dann fragte
Strauß, ob sie jetzt zu Mittag essen wollten, aber
die Leute hatten Feuer gefangen und erklärten, mit
einer zehn Minuten langen Pause zufrieden zu sein.
Er soll bei einer nicht stürmisch genug gespielten
Stelle den Musikern zugerufen haben: Spielen Sie
das nicht wie Qentlemen, sondern wie rasende
Tiere. — Den Trompetern, — es waren vier, —
ließ er durch seinen Dolmetscher sagen, sie sollten
wie vierhundert Mann blasen. Sie bliesen, aber
Strauß rief ihnen zu, das seien nur zweihundert.
Sie bliesen wieder, sie bliesen, wie sie nie zuvor ge-
blasen hatten.“ Es berechnen bekanntlich auch
sonst die Musiker den Wert der Musik wesentlich
nach ihrer schweißtreibenden Kraft, und nach An-
gabe unserer Kapazitäten soll besonders Straußsche
Kunst wesentlich geeignet sein zur Behandlung
der Fettsucht und Harnverhaltung. Aber be-
denklich macht doch ihre appetitschädigende Wir-
kung. Ich weiß nicht, ob diese Wirkung dadurch
ausgeglichen wird, daß sie scheinbar nur bei anti-
nationalen Engländern hervortritt; (— ist Strauß
vom Flottenverein geschickt? —) Uebrigens wird
uns etwas mitgeteilt, was das Qenie unseres
Meisters doch in hellem Lichte zeigt: er ist nun-
mehr mit Hagenbeck in Verbindung getreten und
beabsichtigt, seine Aufführungen in Zukunft in
Menagerien abzuhalten. Aus dem sensationellen
Waschzettel ziehen wir aus:
1. Die wilden Weiber oder griechisch-syrischer
Bauchtanz mit Krampfzuständen der Becken-
muskulatur. 2. Akute Lungenblähung, Ballade aus
Covent Qarden mit Rentenverfahren. 3. Der musi-
kalische Schweißfuß. 4. Vier Qentlemen als zwei-
hundert Seelöwen. 5. Vier Qentlemen als vier-
hundert Seelöwen. 6. Vier Gentlemen als acht-
hundert Brüllaffen. Verwandlung (erstaunlich!)
Schlußchor: „Wie oder was blasen die Trom-
peten?“ aus „Tod und Verblödung.“
Schaufensterbelustigung
Der Verband Berliner Spezialgeschäfte beab-
sichtigt eine höhere Fachschule für Schaufenster-
dekoration einzurichten. Damit wird etwas einge-
führt, was wir schon immer erhofften und was als
letzten Zweck hat den Ersatz des Zweckmäßigen
durch das Wohlgefällige. Nachdem man endlich
davon abgegangen ist, plump seine Verkaufsgegen-
stände vorzuführen, kommt unser Standpunkt zur
Geltung mit der Devise: Die Kunst im Leben des
Buttergeschäfts. Einige Qeschäfte planen kine-
matographische Darbietungen aus der Prärie und
Umgegend; die großen Warenhäuser wollen Ring-
kämpfe bieten; ein Käsegeschäft bringt: der kleine
Jacobsohn, sein Gedächtnis, sein Anhang und die
Maulsperre. Um die Illusion zu vollenden, wollen
die einzelnen Qeschäfte ihre Schilder vertauschen
und zwar wöchentlich in einem bestimmten Turnus.
Man bezweckt damit auch, das Publikum in Ge-
schäfte zu führen, in welchen es nichts zu suchen
hat; es belehrt sich dabei und kommt aus dem
Wundern nicht heraus.
Der Verband Berliner Spezialgeschäfte erhofft
sich, wie er uns in einem Comunique mitteilt, von
dieser Neuerung eine bedeutende Belebung des
Verkaufsbetriebes und wird sie, auch bei fehlendem
Entgegenkommen des Publikums, eventuell unter
Sperrung der Geschäftsräume durchführen, ein
Plan, in welchem ihn Herr Jagow sicher unter-
stützen wird. Alfred Döblin
Unsere Lieblinge
I / Verse des Herrn Doktor Rudolf Lothar
Die sehr komische Qper „Das Tal der Liebe“
hat die Erde ohne grosse Austrengung mit sanftem
Beben verschlungen. Doch den Text spie sie
entsetzt wieder aus. Einiges Unkraut habe ich
aufgelesen.
Die Markgräfin, als sie in einem Grenadier den
Geliebten derjugend, einen Schweinehirten wieder-
erkennt:
Allein in raeinem Herzen drin,
Da höre ich noch früh und spat
Die Lieder der Kinderzeit.
lch seh’ mich noch in kurzem Kleid,
Ich seh’ dich noch mit nackten Beinen
Mit deinen Schweinen.
Lisbeth, eine Amme, die dem verschollenen Qelieb-
ten nachtrauert:
Mein Hans allein, der kam noch nicht,
Mein Hans, der kam nicht wieder.
Vergessen hat er Lieb’ und Pflicht,
Vergessen unsre Lieder.
Diese Lieder lernt man leider nicht kennen. Sie
liegen ihr aber sehr am Herzen. Als ihr Geliebter
gefangen fortgeführt wird, bemerkt sie:
Und muss es nun geschieden sein,
Mein Hans, du kehrst ja wieder,
Und bleib’ mir treu, gedenke mein,
Gedenke unsrer Lieder.
Vergiss im Schloss dein Mädel nicht.
Zu eng wird mir das Mieder!
Ich habe die starke Vermutung, daß Lisbeth nur aus
Reimnot so auf die Lieder versessen ist. Ich mache
daher Herrn Doktor Lothar vorläufig auf die Worte
Gefieder, bieder und Seifensieder aufmerksam.
Der Hymnus auf die Tätigkeit der Ammen sollte
aber Qemeingut des deutschen Volkes werden.
Hier stehe er zum Auswendiglernen:
Wir speisen und tränken
Das Menschengeschlecht,
Drum soll niemand kränken
Der Ammen Recht.
Die Liebe schuf
Unseren Beruf. —
Und für Freunde der Klapphornpoesie seien zum
guten Ende noch zwei Verse hingesetzt:
An meinen Schultern lehnt’ dein Köpfchen,
Da küsst’ ich dich aufs blonde Zöpfchen.
___Trust
Verantwortlich fiir die Schriftleitung: Herwarth Walden/Berlin-Halensee