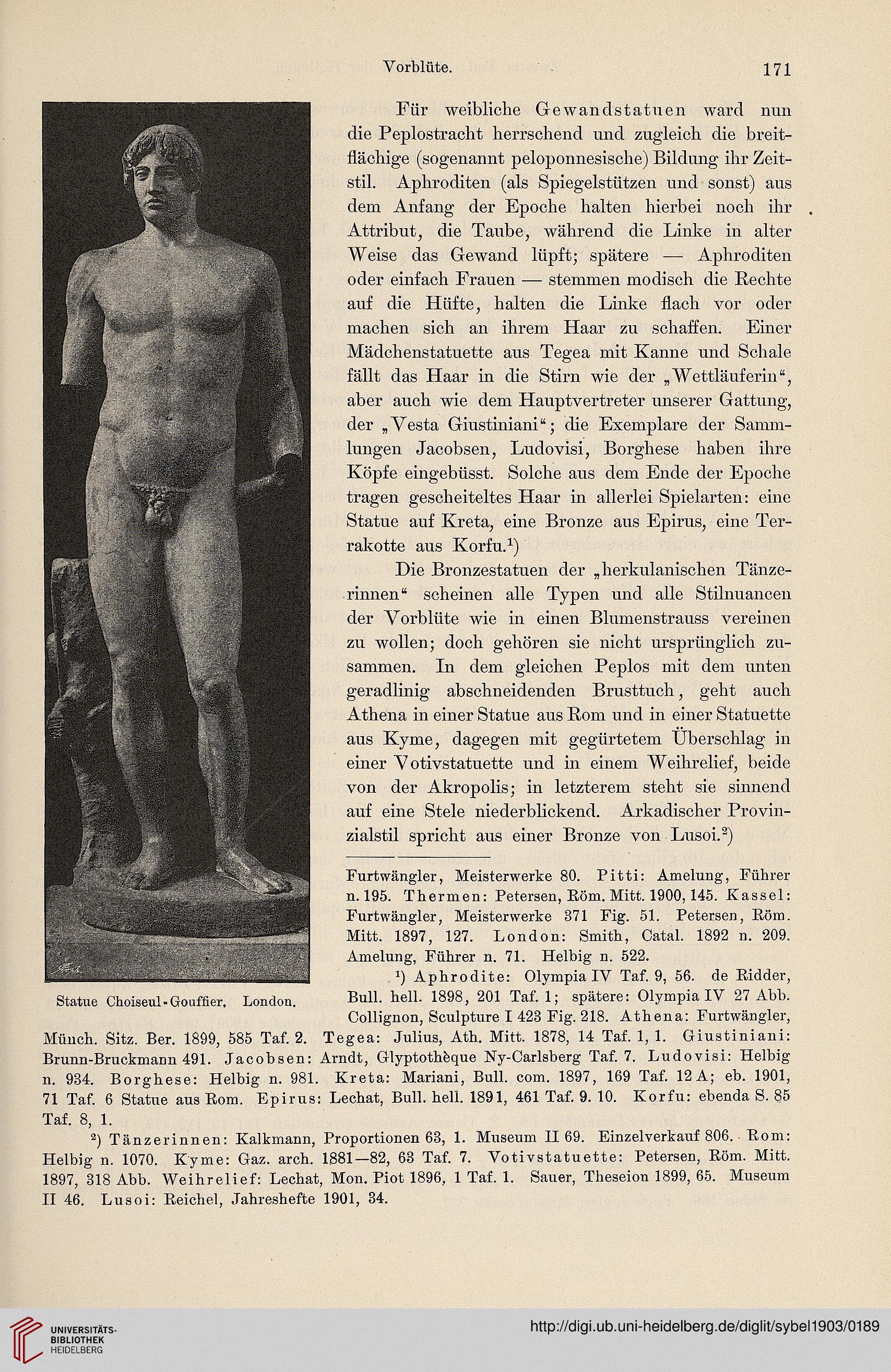Vorblüte.
171
Furtwängler, Meisterwerke 80. Pitti: Amelung, Führer
n.195. Thermen: Petersen,Röm.Mitt. 1900,145. Fassei:
Furtwängler, Meisterwerke 871 Fig. 51. Petersen, Röm.
Mitt. 1897, 127. London: Smith, Oatal. 1892 n. 209.
Amelung, Führer n. 71. Helbig n. 522.
i) Aphrodite: Olympia IV Taf. 9, 56. de Ridder,
Statue Choiseul-Goufßer. London. Bull. hell. 1898, 201 Tal. 1; spätere: Olympia IV 2/ Abb.
Oollignon,Sculpture 1 428 Fig. 218. Athena: Furtwängler,
Münch. Sitz. Ber. 1899, 585 Taf. 2. Tegea: Julius, Ath. Mitt. 1878, 14 Taf. 1, 1. Oiustiniani:
Brunn-Bruckmann 491. Jacobsen: Arndt, Glyptoth&que Ny-Carlsberg Taf. 7. Ludovisi: Helbig
n. 934. Borghese: Helbig n. 981. Kreta: Mariani, Bull. com. 1897, 169 Taf. 12 A; eb. 1901,
71 Taf. 6 Statue aus Rom. Epirus: Lechat, Bull. hell. 1891, 461 Taf. 9. 10. Korfu: ebenda S. 85
Taf. 8, 1.
2) Tänzerinnen: Kalkmann, Proportionen 68, 1. Museum 1169. Einzelverkauf 806. Rom:
Helbig n. 1070. Kyme: Gaz. arch. 1881—82, 68 Taf. 7. Votivstatuette: Petersen, Röm. Mitt.
1897, 818 Abb. Weihrelief: Lechat, Mon. Piot 1896, 1 Taf. 1. Sauer, Theseion 1899, 65. Museum
II 46. Lusoi: Reichel, Jahreshefte 1901, 84.
Für weibliche Gewandstatuen ward nun
die Peplostracht herrschend und zugleich die breit-
tiächige (sogenannt peloponnesische) Bildung ihr Xcit-
stil. Aphroditen (als Spiegelstützen und sonst) aus
dem Anfang der Epoche halten hierbei noch ihr
Attribut, die Taube, während die Unke in alter
Weise das Gewand lüpft; spätere — Aphroditen
oder einfach Frauen — stemmen modisch die Rechte
auf die Hüfte, halten die Linke Hach vor oder
machen sich an ihrem Haar zu schaffen. Einer
Mädchenstatuette aus Tegea mit Kanne und Schale
fällt das Haar in die Stirn wie der „ Wettläuferin",
aber auch wie dem Hauptvertreter unserer Gattung,
der „ Vesta Giustiniani"; die Exemplare der Samm-
lungen Jacobsen, Ludovisi, Borghese haben ihre
Köpfe eingebüsst. Solche aus dem Ende der Epoche
tragen gescheiteltes Haar in allerlei Spielarten: eine
Statue auf Kreta, eine Bronze aus Epirus, eine Ter-
rakotte aus Korfud)
Die Bronzestatuen der „herkulanischen Tänze-
rinnen" scheinen alle Typen und alle Stilnuancen
der Vorblüte wie in einen Blumenstrauss vereinen
zu wollen; doch gehören sie nicht ursprünglich zu-
sammen. In dem gleichen Peplos mit dem unten
geradlinig abschneidenden Brusttuch, geht auch
Athena in einer Statue aus Rom und in einer Statuette
aus Kyme, dagegen mit gegürtetem Überschlag in
einer Votivstatnette und in einem Weihrelief, beide
von der Akropolis; in letzterem steht sie sinnend
auf eine Stele niederblickend. Arkadischer Provin-
zialstil spricht aus einer Bronze von Lusoi.*)
171
Furtwängler, Meisterwerke 80. Pitti: Amelung, Führer
n.195. Thermen: Petersen,Röm.Mitt. 1900,145. Fassei:
Furtwängler, Meisterwerke 871 Fig. 51. Petersen, Röm.
Mitt. 1897, 127. London: Smith, Oatal. 1892 n. 209.
Amelung, Führer n. 71. Helbig n. 522.
i) Aphrodite: Olympia IV Taf. 9, 56. de Ridder,
Statue Choiseul-Goufßer. London. Bull. hell. 1898, 201 Tal. 1; spätere: Olympia IV 2/ Abb.
Oollignon,Sculpture 1 428 Fig. 218. Athena: Furtwängler,
Münch. Sitz. Ber. 1899, 585 Taf. 2. Tegea: Julius, Ath. Mitt. 1878, 14 Taf. 1, 1. Oiustiniani:
Brunn-Bruckmann 491. Jacobsen: Arndt, Glyptoth&que Ny-Carlsberg Taf. 7. Ludovisi: Helbig
n. 934. Borghese: Helbig n. 981. Kreta: Mariani, Bull. com. 1897, 169 Taf. 12 A; eb. 1901,
71 Taf. 6 Statue aus Rom. Epirus: Lechat, Bull. hell. 1891, 461 Taf. 9. 10. Korfu: ebenda S. 85
Taf. 8, 1.
2) Tänzerinnen: Kalkmann, Proportionen 68, 1. Museum 1169. Einzelverkauf 806. Rom:
Helbig n. 1070. Kyme: Gaz. arch. 1881—82, 68 Taf. 7. Votivstatuette: Petersen, Röm. Mitt.
1897, 818 Abb. Weihrelief: Lechat, Mon. Piot 1896, 1 Taf. 1. Sauer, Theseion 1899, 65. Museum
II 46. Lusoi: Reichel, Jahreshefte 1901, 84.
Für weibliche Gewandstatuen ward nun
die Peplostracht herrschend und zugleich die breit-
tiächige (sogenannt peloponnesische) Bildung ihr Xcit-
stil. Aphroditen (als Spiegelstützen und sonst) aus
dem Anfang der Epoche halten hierbei noch ihr
Attribut, die Taube, während die Unke in alter
Weise das Gewand lüpft; spätere — Aphroditen
oder einfach Frauen — stemmen modisch die Rechte
auf die Hüfte, halten die Linke Hach vor oder
machen sich an ihrem Haar zu schaffen. Einer
Mädchenstatuette aus Tegea mit Kanne und Schale
fällt das Haar in die Stirn wie der „ Wettläuferin",
aber auch wie dem Hauptvertreter unserer Gattung,
der „ Vesta Giustiniani"; die Exemplare der Samm-
lungen Jacobsen, Ludovisi, Borghese haben ihre
Köpfe eingebüsst. Solche aus dem Ende der Epoche
tragen gescheiteltes Haar in allerlei Spielarten: eine
Statue auf Kreta, eine Bronze aus Epirus, eine Ter-
rakotte aus Korfud)
Die Bronzestatuen der „herkulanischen Tänze-
rinnen" scheinen alle Typen und alle Stilnuancen
der Vorblüte wie in einen Blumenstrauss vereinen
zu wollen; doch gehören sie nicht ursprünglich zu-
sammen. In dem gleichen Peplos mit dem unten
geradlinig abschneidenden Brusttuch, geht auch
Athena in einer Statue aus Rom und in einer Statuette
aus Kyme, dagegen mit gegürtetem Überschlag in
einer Votivstatnette und in einem Weihrelief, beide
von der Akropolis; in letzterem steht sie sinnend
auf eine Stele niederblickend. Arkadischer Provin-
zialstil spricht aus einer Bronze von Lusoi.*)