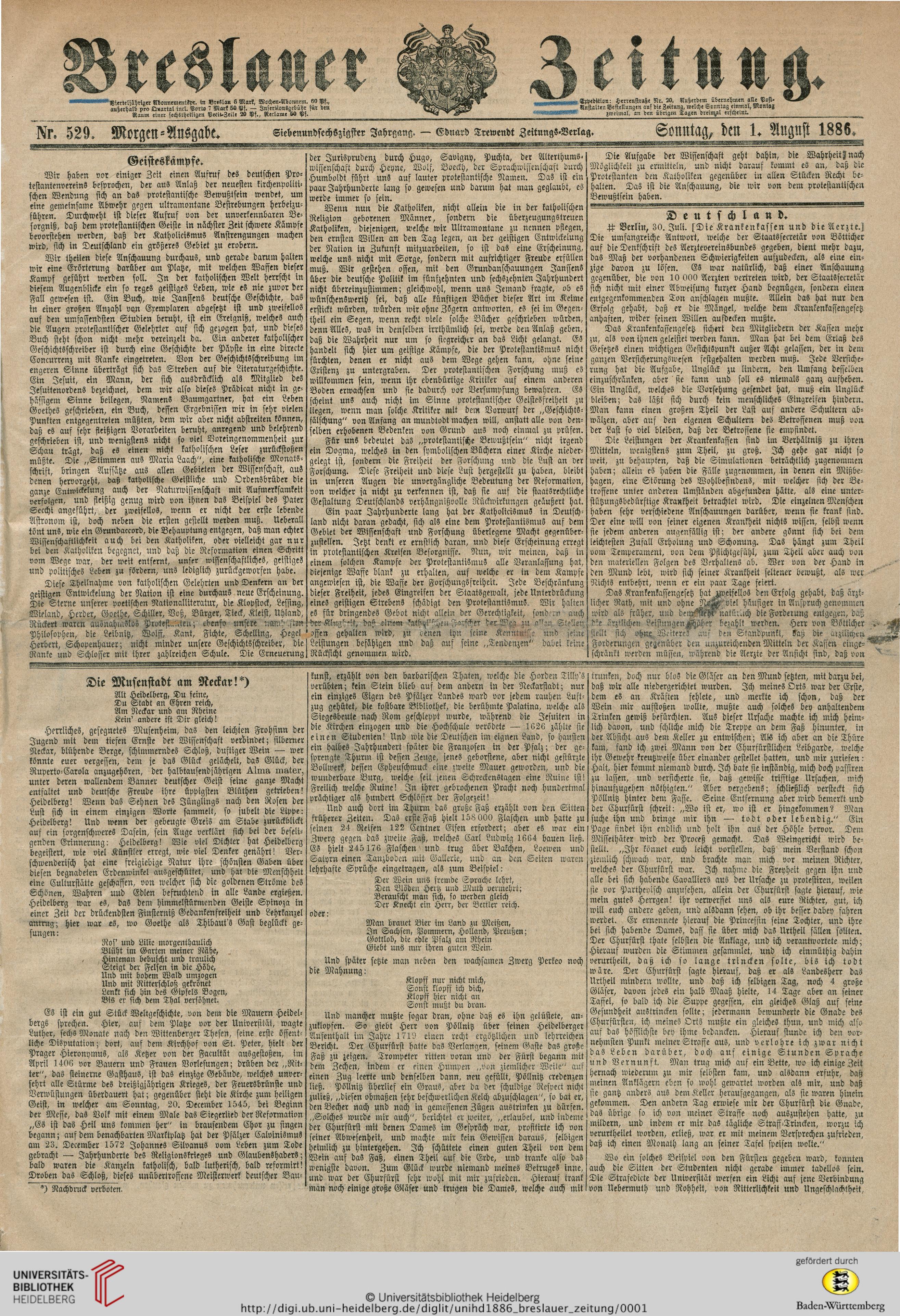^ DierteMhriger AbonnementSpr. in BreSla« 6 -Mar?, Moche>n.Abonnem. 60 Pft,
außerhalb xro Quartal incl. Porto 7 Mark Lv Pf. — JnsertLonsgebühr für den
Raum einer sechstheiliAen PeLit-Zeile 20 Pf., Reclame SO Pf.
___ z Lxpedttion: Herrenstraße Nr. 20. Nußerdem übernehmen alle Post-
, AnstaltenBestellungen auf die Zeituna, welche Sonntag einmal, Montag
zrveimal, an den ubrigen Tagen dreiu^al erscheint.__
wr. 529. Morgen-Ansgabe.
Siebemmdscchszigster Jahrgang. — Eduard Trewendt ZeitungS-Verlag.
Sonntag, den 1. Augnst 1886.
Geisteskämpfe.
Wir haben vor einiger Zeit einen Aufruf des deutschen Pro-
testantenvereins besprochen, der aus Anlaß der neuesten kirchenpoliti-
schen Wendung sich an das protestantische Bewußtsein wendet, um
eine gemeinsame Abwehr gegen ultramontane Bestrcbungen herbeizu-
führen. Durchweht ist dicscr Aufruf von der unverkcnnbaren Be-
sorgniß, daß dcm protcstantischen Geiste in nächster Zeit schwere KLmpfe
bevorstehen werden, daß der Katholicismus Anstrengungen machen
wird, sich in Deutschland ein größercs Gebiet zu erobern.
Wir thcilen diese Anschauung durchaus, und gerade darum halten
wir eine Erörterung darüber am Platze, mit welchen Waffen dicser
Kampf geführt werden soll. Jn der katholischen Wclt hcrrscht in
diesem Augenblicke ein so rcges geistigcs Lcben, wie es nie zuvor der
Fall gewesen tst. Ein Buch, wie Janffens deutsche Geschichte, das
in einer großen Anzahl van Exemplaren abgesetzt ist und zweifcllos
auf dcn umfaflendstcn Studicn beruht, ist ein Ercigniß, welchcs auch
die Augen protestantischcr Gelehrter auf sich gezogen hat, und dicses
Buch steht schon nicht mehr vcreinzelt da. Ein andcrer katholischer
Geschichtsschreiber ist durch eine Geschichte der PLpste in eine directe
Concurrcnz mit Ranke eingetreten. Von der GeschichtSschreibung im
engeren Sinne überträgt sich das Strcben auf die Literaturgeschichte.
Ein Jesuit, ein Mann, der sich ausdrücklich als Mitglied des
Jesuitenordens bezeichnet, dem wir also dicscs Prädicat nicht in ge-
hässigem Sinne beilegen, NamenS Baumgartner, hat ein Leben
GoetheS gcschricben, ein Buch, deffcn Ergebniffen wir in sehr viclen
Punkten entgegentreten müßten, dcm wir aber nicht abstreiten können,
daß es auf sehr fieißigcn Vorarbeiten beruht, anregend und belehrend
geschrieben ist, und wcnigstens nicht so viel Vorcingenommenheit zur
Schau trägt, daß es einen nicht katholischen Lcser zurückstoßen
müßte. Die „Stimmen aus Maria Laach", einc katholischc Monats-
schrift, bringen Aufsätze aus allen Gebicten der Wisscnschaft, auS
denen hcrvorgcht, daß katholische Gctstliche und Ordensbrüder die
ganze Entwickclung auch der Naturwissenschaft mit Aufmcrksamkeit
verfolgcn, und fieißig genug wird von ihnen das Beispiel des Pater
Secchi angeführt,. der zweifellos, wenn er nicht der crste lebende
Astronom ist, doch neben die ersten gestellt werdcn muß. Ucberall
tönt uns, wie ein Grundaccord, die Bchauptung entgegen, daß man echtcr
Wiffenschaftlichkeit auch bei den Katholiken, oder vielleicht gar nur
bci den Katholiken begegnet, und daß die Rcformation einen Schritt
vom Wege war, der weit entfernt, unser wissenschaftliches, gcisttges
und politisches Lcben zu fördcrn, uns ltdiglich zurückgeworfen habe.
Diese Theilnahme von katholtschen Gelehrten und Denkcrn an der
geistigen Entwickelung der Nation ist cine durchauS neue Erscheinung.
Die Sterne unserer poetischen Nationalliteratur, die Klopstock, Lessing,
Wieland, Hcrder, Goethe, Schiller, Voß, Bürger, Tieck, Kleist, Uhland,
Rückert warcn auönahlüslos Protest>.-.,leu; cbenfo unsere tramh ftrn
Philosophen, die Leibnitz, Wolff, Kant, Fichte, Schelling, Hegel
Herbert, Schopenhauer; nicht minder unsere Geschichtsschretber, die
Ranke und Schloffer mit ihrcr zahlreichen Schule. Die Erncuerung
der Jurisprudenz durch Hugo, Savigny, Puchta, der Alterthums-
wlffcnschaft durch Hcyne, Wolf, Boeckh, dcr Sprachwiffcnschaft durch
Humboldt führt uns auf lauter protestantische Namen. Das ist ein
paar Jahrhunderte lang so gewescn und darum hat man geglaubt, es
werde immer so sein.
Wenn nun die Katholiken, nicht allein die in der katholischen
Rcligion geborenen Männer, sondern die überzeugungstreuen
Katholiken, diejcnigen, welche wir Ultramontane zu ncnnen Pflegen,
den ernsten Willen an den Tag lcgen, an der geistigen Entwickelung
der Natton in Zukunft mitzuarbeiten, so ist das cine Erscheinung,
welche uns nicht mit Sorge, sondern mit aufrichtiger Freude erfüllen
muß. Wir gestehen offen, mit den Grundanschauungen Zansscns
über die deutsche Politik im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert
nicht übereinzustimmen; glcichwohl, wcnn uns Jemand fragte, ob es
wünschcnSwerth sei, daß alle künftigen Bücher diescr Art im Keime
crstickt würden, würden wir ohne Zögern antworten, es sei im Gegen-
theil ein Segen, wenn recht vicle solche Bücher gcschrieben würden,
denn AlleS, was in denselben irrthümlich sei, werde den Anlaß gebcn,
daß die Wahrhcit nur um so siegreicher an das Licht gelangt. ES
handelt sich hier um geistige Kämpfe, die dcr Protestantismus nicht
fürchten, denen er nicht aus dem Wege gehen kann, ohne seine
Extstenz zu untergraben. Dcr protestanttschen Forschung muß eS
willkommen sein, wenn ihr ebenbürtige Kritiker auf eincm anderen
Bodcn crwachsen und sie dadurch vor Versumpfung bewahren. Es
scheint uns auch nicht im Sinne protestantischcr Geistesfreiheit zu
liegen, wenn man solche Kritiker mit dem Vorwurf der „Geschichts-
fälschung" von Anfang an mundtodt machen will, anstatt alle von den-
selben crhobenen Bedenken von Grund aus noch einmal zu prüfen.
Für unS bedeutet daS „protcstanttsche Bewußtsein" nicht irgend
ein Dogma, wclcheö in den symbolischen Büchern einer Kirche nieder-
gelegt ist, sondcrn die Frciheit der Forschung und die Lust an der
Forschung. Diese Freiheit und diese Lust hergestellt zu haben, bleibt
in unseren Augen die unvcrgängliche Bedeutung der Rcformation,
von welchcr ja nicht zu verkennen ist, daß sie auf die staatsrechtliche
Gestaltung Deutschlands verhängnißvolle Rückwirkungen geäußert hat.
Ein paar Jahrhunderte lang hat der KatholicismuS in Deutsch-
land nicht daran gedacht, sich als einc dem Protestantismus auf dem
Gcbiet dcr Wtssenschaft und Forschung überlegcne Macht gegenübcr-
zustellcn. Jetzt denkt er ernstlich daran, und diese Erscheinung erregt
in protkstantischen Kreisen Bcsorgniffe. Nun, wir meinen, daß in
einem solchen Kampfe der ProtestantiSmuS alle Veranlaffung hat,
dicjcnige Waffe blank zu erhalten, aus welche er in dem Kampfc
angewiesen ist, die Waffe der Forschungsfreiheit. Jcde BeschrLnkung
dieser Freiheit, jedeS Eingreifen der Staatsgewalt, jede Unterdrückung
cines geistigen Strebens schädigt den Protcstantismus. Wir halten
es für dringendes Gebot nicht allcin der Gerechtigkeit, sondcrn auch
dcr Klug'--it, daß clnem karh^l'schcn Fo-schcr der W-'g zu a":n Stellen.
offen gehalten wlrd, zu oenen tyn seine Kennü.-s- und jeinc
Leistungen befähigen und daß auf seine „Tendenzen" dabei reinr
Rückstcht genommcn wird.
Die Aufgabe der Wiffenschaft geht dahin, die WahrheitHnach
Möglichkeit zu crmitteln, und nicht darauf kommt es an, daß die
Protestanten den Katholikcn gegenüber in allen Stücken Recht be-
halten. Das ist die Anschauung, die wir von dem protestantischen
Bewußtsein haben. _
Deutschland.
ckst Berlin, 30. Juli. sDie Krankenkassen und die Aerzte.s
Die umfangreiche Antwort, welche der Staatssecretär von Bötticher
auf die Denkschrift des Aerztevcreinsbundes gegeben, dient mehr dazu,
das Maß dcr vorhandenen Schwierigkeiten aufzudeckcn, als eine ein-
zige davon zu lösen. Es war natürlich, daß einer Anschauung
gegenübcr, dte von 10 000 Aerzten vertreten wird, der Staatssecretär
stch nicht mit eincr Abweisung kurzer Hand begnügen, sondern einen
entgegenkommenden Ton anschlagen mußte. Allein das hat nur den
Erfolg gehabt, daß er die Mängel, wclche dem Krankenkaffengesetz
anhaften, widcr scinen Willen aufdecken mußte.
DaS Krankenkassengesetz stchert den Mitgliedern dcr Kaffen mehr
zu, als von ihnen gclcistct werden kann. Man hat bet dcm Erlaß des
Gcsetzcs cincn wichtigcn Gesichtspunkt außer Acht gelaffen, der in dem
ganzcn Versichcrungswesen festgehalten werden muß. Jede Versiche-
rung hat die Aufgabe, Unglück zu lindcrn, den Umfang deffclben
einzuschränken, aber sie kann und soll es niemals gan; aufheben.
Ein Unglück, wclches die Vorsehung gesendet hat, muß ein Unglück
bleiben; das läßt sich durch kein menschliches Eingreifen hindern.
Man kann einen großen Theil der Last auf andcre Schultern ab-
wälzen, aber auf den eigenen Schultern des Bctroffenen muß von
der Last so viel bleiben, daß dcr Betroffene fie empfindet.
Die Leistungen dcr Krankenkassen sind im Verhältniß zu ihren
Mitteln, wenigstens zum Theil, zu groß. Jch gehe gar nicht so
weit, zu behaupten, daß die Simulationen beträchtlich zugenommen
haben; allein eS haben die Fälle zugenommen, in denen ein Mißbe-
hagen, eine Störung des Wohlbefindens, mit welchcr sich der Be-
troffene unter anderen Umständen abgefunden hätte, als eine untcr-
stützungsbedürstige Krankheit bctrachtet wird. Die einzelnen Menschen
haben sehr verschiedene Anschauungen darüber, wenn sie krank sind.
Der eine will von seiner eigenen Krankheit nichts wissen, selbst wenn
sie jedem anderen augenfällig ist; dcr andere gönnt sich bei dem
leichtesten Zufall Erholung und Schonung. Das HLngt zum Theil
vom Temperament, von dem Pftichtgefühl, zum Theil abcr auch von
den matericllen Folgen des Verhaltens ab. Wer von der Hand in
dcn Mund lebt, wird sich seiner Krankheit seltener bewußt, als wer
Nichts entbehrt, wenn er ein paar Tage feiert.
Das Krankenkassengesetz hat uveisellos den Erfolg gehabt, daß ärzt-
licher Rath, mit und ohne RÄ',' vicl häufiger in Anspruch genommen
wird als frühcr, und deim^M natürlich die Forderung entgcgen, daß
die ärzUichen LeistnngenH'HHer bczahlt werdcn. Herr von Bötticher
stellt fich ohnr. WntereS auf den Standpunkt, saß die ärzilichcn
Forderungen gezenüber dcn unzureichendcn Mitteln der Käffen einge- "
schränkt wcrden müssen, während die Aerzte der Arrsicht sind, daß von
Die Musenstadt am Neckar!*)
Alt Heidclberg, Du feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheme
Kein' andere rst Dir gleich!
Henliches, gesegnetes Musenheim, das den leichten Frohsinn der
Jugend mit dem tiefen Ernste der Wiffenschaft verbindet; silberner
Neckar, blühcnde Berge, schimmerndcs Schloß, dustiger Wein — wer
könntc euer vergessen, dem je daS Glück gelächelt, daS Glück, der
Ruperto-Carola anzugehören, der halbtausendjährigen irrnter,
unter deren wallendem Banner deutscher Geist seinc ganze Macht
entfaltet und deutsche Freude ihre üppigsten Blüthen getricben!
Heldelberg! Wenn das Schnen dcs Jünglings nach den Rvsen der
Lust sich in einem einzigen Worte sammclt, so jubelt dte Lippe:
Heldclberg! Und wenn der gebeugte Grels am Stabe zurückbltckt
auf ein sorgenschweres Dasein, sein Auge vcrklärt sich bei der beseli-
genden Erinnerung: Heldelbcrg! Wie viel Dtchtcr hat Heidelberg
begeistcrt, wte viel Künstler erregt, wie viel Denker genährt! Ver-
schwenderisch hat cine freigiebige Natur ihre schönsten Gaben über
diesen begnadeien Erdenwinkel auSgeschüttet, und hat die Menschheit
eine Culturstätte geschaffen, von welcher sich die goldenen Ströme des
Schönen, Wahren uud Edlen befruchtend in alle Lande ergießen.
Heidelberg war es, daS dem himmelstürmcnden Geiste Spinoza in
einer Zeit der drückendstcn Finsterniß Gedankenfreiheit und Lehrkanzel
anrrug; hier war es, wo Goethe als Thibaut'S Gast beglückt ge-
sungen:
Ros' und Lilie morgenthaulich
Blüht im Garten meiner Nähe,
, Hintenan bebuscht und traulich
Stcigt der Felsen in die Höhe,
Und mit hohem Wald umzogen
Und mit Ritterschloß gekrönet
Lenkt sich hin des Gipfels Bogen,
Bis er sich dem Thal versöhnet.
Es ist ein gut Stück Weligeschichte, von dem die Mauern Heidel-
bergs sprechen. Hier, auf dem Platze vor der Universität, wagte
Luther, sechs Monate nach den Wittenberger Thesen, seine erste öffent-
liche Disputation; dort, auf dem Kirchhof von St- Peter, hielt der
Prager Hieronymus, als Ketzer von der FacultSt ausgestoßen, im
April 1406 vor Bauern und Frauen Vorlesungen; drüben der „Rit-
ter", das steinerne GasthauS, ist das einzige Gebände, welches unver-
schrt alle Stürme des dreißigjährigen Krieges, der Feuersbrünste und
Verwüstungen überdauert hat; gegenüber steht die Kirche zum heiligen
Geist, in welcher am Sonntag, 20. Deccmber 1545, bei Beginn
der Meffe, das Volk mit eincm Male das Siegerlied der Reformation
„Es ist das Heil uns kommen her" in brausendem Chor zu singcn
begann; auf dem benachbarten Marktplatz hat der Pfälzer Calvlnismus
am 23. December 1572 Johannes Srlvanus vom Lebcn zum Tode
gebracht — Jahrhunderte des Religionskrieges und Glaubenshaders;
bald waren die Kanzeln katholisch, bald lutherisch, bald reformirt!
Droben das Schloß, dieses unübertroffene Mersterwerk deutscher Bau-
Nachdruck verbotem
kunst, erzählt von den barbarischen Thaten, welche die Horden Tilly's
verübten; kcln Stein blieb auf dem andcrn in der Neckarstadt; nur
ein einziges Eigen des Pfälzer Landes ward vor jedem rauhen Luft-
zug gehütet, dtc kostbare Bibliothek, die bcrühmte Palatina, welche als
Siegesbeute nach Rom geschleppt wurde, während die Jesuiien in
die Ktrchen einzogen und die Hochschule verödete — 1626 zählte sie
einen Studenten! Und wie die Deutschen im etgnen Land, so hausten
ein halbes Jahrhundert später die Franzosen in der Pfalz; der ge-
sprengte Thurm ist dessen Zeuge, jcnes geborstene, aber nicht gcstürzte
Bollwcrk, dessen Epheuschmuck eine zweite Mauer geworden, und die
wunderbare Burg, welche seit jenen Schreckenstagen eine Ruine ist!
Freilich welche Ruine! Jn ihrer gcbrochenen Pracht noch hundertmal
prächtiger alS hundcrt Schlöffer der Folgezeit!
Und auch dort im Thurm das große Faß erzählt von den Sitten
ftüherer Zeiten. Das erste Faß hielt 158 000 Flaschen und hatte zu
seinen 24 Reifen 122 Ccntner Eisen crfordert; aber es war ein
Zwerg gegen das zweite Faß, wclches Carl Ludwig 1664 bauen ließ.
Es hielt 245176 Flaschen und trug über Bakchen, Loewen und
Satyrn einen Tanzboden mit Gallerie, und an den Seiten waren
lehrhafte Sprüche eingetragen, ais zum Beispiel:
Der Wein uns fremde Sprache lehrt,
Den Blöden Hcrtz und Muth uermehrt;
Berauscht man sich, so werden gleich
Der Knecht ein Herr, der Bertler reich.
oder:
Man brauet Bier im Land zu Meißen,
Jn Sachsen, Pommern, Holland, Preußen;
Gottlob, die edle Pfalz ain Rhein
Giebt uns nur ihren guten Weln-
Und später setzte man neben den wachsamen Zwerg Perkeo noch
die Mahnung:
Klopff nur nicht mich,
Sonst klopff ich dich,
Klopsf hier nicht an
Sonst mußt du dran.
Und mancher mußte sogar dran, ohne daß es ihn gelüstete, an-
zuklopfen. So giebt Herr von Pöllnitz über seinen Heidelberger
Aufenthalt im Jahre 1719 einen recht ergötzlichen und lehrreichen
Bericht. Der Churfürst hatte das Verlangcn, seinem Gaste das große
Faß zu zeigen. Trompeter ritten voran und der Fürst begann mit
dcm Zechen, indem er einen Humpen „von ziemlicher Weiie" auf
cinen Zug leerte und denselben dann, neu gefüllt, Pöllnitz credenzen
ließ. Pöllnitz überlief ein Graus, aber da der schuidige 'Respect nicht
zuließ, „diesen obmaßen sehr beschwerlichen Kelch abzuschlagen", so bat er,
den Becher nach und nach in gemeffenen Zügen austrinken zu dürfen.
„Solches wurde mir auch", berichtet er weiter, „erlaubet, und indemc
der Churfürst mit denen Dames im Gespräch war, profitirte ich von
seiner Abwesenheit, und machte mir kein Gewissen daraus, seibigen
heimlich zu hintergehen. Jch schüttete einen guten Theil von dem
Wein auf daS Faß, einen Theil auf die Erde, und tranke alsv das
wenigste davon. Zum Giück wurde nicmand mcines Betruges inne,
und war der Churfürst sehr wohl mit mtr zufrieden. Hierauf trank
man M'ch einige große Gläser und trugen die DameS, welche auch mit
trunken, doch nur blos die Gläser an den Mund setzten, mü darzu bei,
daß wir alle niedergerichtet wurden. Jch meines OrtS war der Erste,
dem es an Kräften fehlete, und merkte ich schon, daß der
Wein mir aufstoßen wollte, mußte auch solches bey anhaltendem
Trinken gewiß befürchten. Aus dieser Ursache machte ich mich heim-
lich davon, und schltche mich die Treppe an dem Faß hinunter, in
der Abstcht aus dem Keller zu entwischen; Als ich aber an die Thüre
kam, fand ich zwei Mann von der Churfürstlichen Leibgarde, welche
ihr Gewchr kreutzwcise üb-r cinander gestcllet hatten, und mir zuriefen:
Halt, hier kommt niemand durch. Jch batc sie inständig, mich doch passiren
zu iaffen, und verstcherte ste, daß gewisse trifftige Ursachen, mich
hinaufzugehen nöthigtcn." Aber vergebens; schließlich versteckt sich
Pöllnitz hinter dem Fasse. Scine Entfernung aber wird bemcrkt und
der Churfürst schrcit: „Wo ist er, wo ist er hingekommen? Man
suche ihn und bringe mir ihn — todt oder lebendig." Ein
Page findet ihn endlich und holt ihn aus der Höhle hervor. Dem
Misseihäter wird der Proceß gemacht. Das Weingericht wird be-
stellt. „Jhr könnet euch leicht vorstellen, daß mein Verstand schon
zremlich schwach war, und brachte man mich vor meinen Richter,
welches dcr Churfürst war. Jch nahme die Freyheit gegen ihn und
alle bei sich habende Cavalliers aus der Ursache zu protestircn/weilen
sie vor Partheyisch anznsehen, allein dcr Churfürst sagte hierauf, wie
mein gutes Herrgen! ihr verwerffet uns als eure Richter, gut, ich
will euch cmdere geben, und alSdann sehen, ob ihr besser dabey fahren
werdet. Er ernennete hierauf die Princesstn seine Tochter, und ihre
bei sich habende Dames, dass sie über mich das Urtheil fällen sollten.
Der Churfürst thate selbsten die Anklage, und ich verantwortete mich;
Hierauf wurdcn die Stlmmen gesammlet, und ich etnmüthig dahin
verurtheilt, daß ich so lange trincken solte, bis ich todt
wäre. Der Churfürst sagte hierauf, daß er als Landesherr das
Urtheil mindern wollte, und daß ich selbtgen Tag, noch 4 große
Gläser, davon jedes ein halb Maaß hlelte, 14 Tage aber an seiner
Taffel, so baid ich die Suppe gegessen, ein gleiches Glaß auf seine
Gesundheit austrincken sollte; jedermann bewunderte die Gnade des
Churfürsten, ich meines Orts mußte cin gleiches thun, und mich also
auf das höfflichsie bey ihme bedancken. Hierauf stunde ich den vor-
nchmsten Punkt meinerStraffe aus, und verlohre ich zwar nicht
das Leben darübcr, doch auf cinige Stunden Sprache
und Vernunft. Man trug mich auf ein Bette, wo ich einige Zeit
hernach wiedcrum zu mir selbsten kam, und alsdann erfuhr, daß
meinen Anklägern eben so wohl gewartet worden als mir, und daß
sie gantz andcrs aus dcm Keller heraufgegangen, als sie waren hincin
gekommen. Den andern Tag erwiese mir der Churfürst die Gnade,
das übrigc so ich von meiner Straffe noch auszustehen hatte, zu
mildern, und indem cr mir daS tägliche Straff-Trincken, worzu ich
verurthcilet worden, erließ, war er mit meinem Versprechen zufrieden,
daß ich einen Monath lang an seincr Tafel speisen wolte."
Wo ein solches Beispiel von den Fürsten gegeben ward, konnten
auch die Sitten der Studenten nicht gerade immer tadellos sein.
Die Strafedicte der Universität werfen ein Licht auf jene Verbindung
von Uebermuth und Rohheit, von Ritterlichkeit und Ungeschlachtheit
außerhalb xro Quartal incl. Porto 7 Mark Lv Pf. — JnsertLonsgebühr für den
Raum einer sechstheiliAen PeLit-Zeile 20 Pf., Reclame SO Pf.
___ z Lxpedttion: Herrenstraße Nr. 20. Nußerdem übernehmen alle Post-
, AnstaltenBestellungen auf die Zeituna, welche Sonntag einmal, Montag
zrveimal, an den ubrigen Tagen dreiu^al erscheint.__
wr. 529. Morgen-Ansgabe.
Siebemmdscchszigster Jahrgang. — Eduard Trewendt ZeitungS-Verlag.
Sonntag, den 1. Augnst 1886.
Geisteskämpfe.
Wir haben vor einiger Zeit einen Aufruf des deutschen Pro-
testantenvereins besprochen, der aus Anlaß der neuesten kirchenpoliti-
schen Wendung sich an das protestantische Bewußtsein wendet, um
eine gemeinsame Abwehr gegen ultramontane Bestrcbungen herbeizu-
führen. Durchweht ist dicscr Aufruf von der unverkcnnbaren Be-
sorgniß, daß dcm protcstantischen Geiste in nächster Zeit schwere KLmpfe
bevorstehen werden, daß der Katholicismus Anstrengungen machen
wird, sich in Deutschland ein größercs Gebiet zu erobern.
Wir thcilen diese Anschauung durchaus, und gerade darum halten
wir eine Erörterung darüber am Platze, mit welchen Waffen dicser
Kampf geführt werden soll. Jn der katholischen Wclt hcrrscht in
diesem Augenblicke ein so rcges geistigcs Lcben, wie es nie zuvor der
Fall gewesen tst. Ein Buch, wie Janffens deutsche Geschichte, das
in einer großen Anzahl van Exemplaren abgesetzt ist und zweifcllos
auf dcn umfaflendstcn Studicn beruht, ist ein Ercigniß, welchcs auch
die Augen protestantischcr Gelehrter auf sich gezogen hat, und dicses
Buch steht schon nicht mehr vcreinzelt da. Ein andcrer katholischer
Geschichtsschreiber ist durch eine Geschichte der PLpste in eine directe
Concurrcnz mit Ranke eingetreten. Von der GeschichtSschreibung im
engeren Sinne überträgt sich das Strcben auf die Literaturgeschichte.
Ein Jesuit, ein Mann, der sich ausdrücklich als Mitglied des
Jesuitenordens bezeichnet, dem wir also dicscs Prädicat nicht in ge-
hässigem Sinne beilegen, NamenS Baumgartner, hat ein Leben
GoetheS gcschricben, ein Buch, deffcn Ergebniffen wir in sehr viclen
Punkten entgegentreten müßten, dcm wir aber nicht abstreiten können,
daß es auf sehr fieißigcn Vorarbeiten beruht, anregend und belehrend
geschrieben ist, und wcnigstens nicht so viel Vorcingenommenheit zur
Schau trägt, daß es einen nicht katholischen Lcser zurückstoßen
müßte. Die „Stimmen aus Maria Laach", einc katholischc Monats-
schrift, bringen Aufsätze aus allen Gebicten der Wisscnschaft, auS
denen hcrvorgcht, daß katholische Gctstliche und Ordensbrüder die
ganze Entwickclung auch der Naturwissenschaft mit Aufmcrksamkeit
verfolgcn, und fieißig genug wird von ihnen das Beispiel des Pater
Secchi angeführt,. der zweifellos, wenn er nicht der crste lebende
Astronom ist, doch neben die ersten gestellt werdcn muß. Ucberall
tönt uns, wie ein Grundaccord, die Bchauptung entgegen, daß man echtcr
Wiffenschaftlichkeit auch bei den Katholiken, oder vielleicht gar nur
bci den Katholiken begegnet, und daß die Rcformation einen Schritt
vom Wege war, der weit entfernt, unser wissenschaftliches, gcisttges
und politisches Lcben zu fördcrn, uns ltdiglich zurückgeworfen habe.
Diese Theilnahme von katholtschen Gelehrten und Denkcrn an der
geistigen Entwickelung der Nation ist cine durchauS neue Erscheinung.
Die Sterne unserer poetischen Nationalliteratur, die Klopstock, Lessing,
Wieland, Hcrder, Goethe, Schiller, Voß, Bürger, Tieck, Kleist, Uhland,
Rückert warcn auönahlüslos Protest>.-.,leu; cbenfo unsere tramh ftrn
Philosophen, die Leibnitz, Wolff, Kant, Fichte, Schelling, Hegel
Herbert, Schopenhauer; nicht minder unsere Geschichtsschretber, die
Ranke und Schloffer mit ihrcr zahlreichen Schule. Die Erncuerung
der Jurisprudenz durch Hugo, Savigny, Puchta, der Alterthums-
wlffcnschaft durch Hcyne, Wolf, Boeckh, dcr Sprachwiffcnschaft durch
Humboldt führt uns auf lauter protestantische Namen. Das ist ein
paar Jahrhunderte lang so gewescn und darum hat man geglaubt, es
werde immer so sein.
Wenn nun die Katholiken, nicht allein die in der katholischen
Rcligion geborenen Männer, sondern die überzeugungstreuen
Katholiken, diejcnigen, welche wir Ultramontane zu ncnnen Pflegen,
den ernsten Willen an den Tag lcgen, an der geistigen Entwickelung
der Natton in Zukunft mitzuarbeiten, so ist das cine Erscheinung,
welche uns nicht mit Sorge, sondern mit aufrichtiger Freude erfüllen
muß. Wir gestehen offen, mit den Grundanschauungen Zansscns
über die deutsche Politik im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert
nicht übereinzustimmen; glcichwohl, wcnn uns Jemand fragte, ob es
wünschcnSwerth sei, daß alle künftigen Bücher diescr Art im Keime
crstickt würden, würden wir ohne Zögern antworten, es sei im Gegen-
theil ein Segen, wenn recht vicle solche Bücher gcschrieben würden,
denn AlleS, was in denselben irrthümlich sei, werde den Anlaß gebcn,
daß die Wahrhcit nur um so siegreicher an das Licht gelangt. ES
handelt sich hier um geistige Kämpfe, die dcr Protestantismus nicht
fürchten, denen er nicht aus dem Wege gehen kann, ohne seine
Extstenz zu untergraben. Dcr protestanttschen Forschung muß eS
willkommen sein, wenn ihr ebenbürtige Kritiker auf eincm anderen
Bodcn crwachsen und sie dadurch vor Versumpfung bewahren. Es
scheint uns auch nicht im Sinne protestantischcr Geistesfreiheit zu
liegen, wenn man solche Kritiker mit dem Vorwurf der „Geschichts-
fälschung" von Anfang an mundtodt machen will, anstatt alle von den-
selben crhobenen Bedenken von Grund aus noch einmal zu prüfen.
Für unS bedeutet daS „protcstanttsche Bewußtsein" nicht irgend
ein Dogma, wclcheö in den symbolischen Büchern einer Kirche nieder-
gelegt ist, sondcrn die Frciheit der Forschung und die Lust an der
Forschung. Diese Freiheit und diese Lust hergestellt zu haben, bleibt
in unseren Augen die unvcrgängliche Bedeutung der Rcformation,
von welchcr ja nicht zu verkennen ist, daß sie auf die staatsrechtliche
Gestaltung Deutschlands verhängnißvolle Rückwirkungen geäußert hat.
Ein paar Jahrhunderte lang hat der KatholicismuS in Deutsch-
land nicht daran gedacht, sich als einc dem Protestantismus auf dem
Gcbiet dcr Wtssenschaft und Forschung überlegcne Macht gegenübcr-
zustellcn. Jetzt denkt er ernstlich daran, und diese Erscheinung erregt
in protkstantischen Kreisen Bcsorgniffe. Nun, wir meinen, daß in
einem solchen Kampfe der ProtestantiSmuS alle Veranlaffung hat,
dicjcnige Waffe blank zu erhalten, aus welche er in dem Kampfc
angewiesen ist, die Waffe der Forschungsfreiheit. Jcde BeschrLnkung
dieser Freiheit, jedeS Eingreifen der Staatsgewalt, jede Unterdrückung
cines geistigen Strebens schädigt den Protcstantismus. Wir halten
es für dringendes Gebot nicht allcin der Gerechtigkeit, sondcrn auch
dcr Klug'--it, daß clnem karh^l'schcn Fo-schcr der W-'g zu a":n Stellen.
offen gehalten wlrd, zu oenen tyn seine Kennü.-s- und jeinc
Leistungen befähigen und daß auf seine „Tendenzen" dabei reinr
Rückstcht genommcn wird.
Die Aufgabe der Wiffenschaft geht dahin, die WahrheitHnach
Möglichkeit zu crmitteln, und nicht darauf kommt es an, daß die
Protestanten den Katholikcn gegenüber in allen Stücken Recht be-
halten. Das ist die Anschauung, die wir von dem protestantischen
Bewußtsein haben. _
Deutschland.
ckst Berlin, 30. Juli. sDie Krankenkassen und die Aerzte.s
Die umfangreiche Antwort, welche der Staatssecretär von Bötticher
auf die Denkschrift des Aerztevcreinsbundes gegeben, dient mehr dazu,
das Maß dcr vorhandenen Schwierigkeiten aufzudeckcn, als eine ein-
zige davon zu lösen. Es war natürlich, daß einer Anschauung
gegenübcr, dte von 10 000 Aerzten vertreten wird, der Staatssecretär
stch nicht mit eincr Abweisung kurzer Hand begnügen, sondern einen
entgegenkommenden Ton anschlagen mußte. Allein das hat nur den
Erfolg gehabt, daß er die Mängel, wclche dem Krankenkaffengesetz
anhaften, widcr scinen Willen aufdecken mußte.
DaS Krankenkassengesetz stchert den Mitgliedern dcr Kaffen mehr
zu, als von ihnen gclcistct werden kann. Man hat bet dcm Erlaß des
Gcsetzcs cincn wichtigcn Gesichtspunkt außer Acht gelaffen, der in dem
ganzcn Versichcrungswesen festgehalten werden muß. Jede Versiche-
rung hat die Aufgabe, Unglück zu lindcrn, den Umfang deffclben
einzuschränken, aber sie kann und soll es niemals gan; aufheben.
Ein Unglück, wclches die Vorsehung gesendet hat, muß ein Unglück
bleiben; das läßt sich durch kein menschliches Eingreifen hindern.
Man kann einen großen Theil der Last auf andcre Schultern ab-
wälzen, aber auf den eigenen Schultern des Bctroffenen muß von
der Last so viel bleiben, daß dcr Betroffene fie empfindet.
Die Leistungen dcr Krankenkassen sind im Verhältniß zu ihren
Mitteln, wenigstens zum Theil, zu groß. Jch gehe gar nicht so
weit, zu behaupten, daß die Simulationen beträchtlich zugenommen
haben; allein eS haben die Fälle zugenommen, in denen ein Mißbe-
hagen, eine Störung des Wohlbefindens, mit welchcr sich der Be-
troffene unter anderen Umständen abgefunden hätte, als eine untcr-
stützungsbedürstige Krankheit bctrachtet wird. Die einzelnen Menschen
haben sehr verschiedene Anschauungen darüber, wenn sie krank sind.
Der eine will von seiner eigenen Krankheit nichts wissen, selbst wenn
sie jedem anderen augenfällig ist; dcr andere gönnt sich bei dem
leichtesten Zufall Erholung und Schonung. Das HLngt zum Theil
vom Temperament, von dem Pftichtgefühl, zum Theil abcr auch von
den matericllen Folgen des Verhaltens ab. Wer von der Hand in
dcn Mund lebt, wird sich seiner Krankheit seltener bewußt, als wer
Nichts entbehrt, wenn er ein paar Tage feiert.
Das Krankenkassengesetz hat uveisellos den Erfolg gehabt, daß ärzt-
licher Rath, mit und ohne RÄ',' vicl häufiger in Anspruch genommen
wird als frühcr, und deim^M natürlich die Forderung entgcgen, daß
die ärzUichen LeistnngenH'HHer bczahlt werdcn. Herr von Bötticher
stellt fich ohnr. WntereS auf den Standpunkt, saß die ärzilichcn
Forderungen gezenüber dcn unzureichendcn Mitteln der Käffen einge- "
schränkt wcrden müssen, während die Aerzte der Arrsicht sind, daß von
Die Musenstadt am Neckar!*)
Alt Heidclberg, Du feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheme
Kein' andere rst Dir gleich!
Henliches, gesegnetes Musenheim, das den leichten Frohsinn der
Jugend mit dem tiefen Ernste der Wiffenschaft verbindet; silberner
Neckar, blühcnde Berge, schimmerndcs Schloß, dustiger Wein — wer
könntc euer vergessen, dem je daS Glück gelächelt, daS Glück, der
Ruperto-Carola anzugehören, der halbtausendjährigen irrnter,
unter deren wallendem Banner deutscher Geist seinc ganze Macht
entfaltet und deutsche Freude ihre üppigsten Blüthen getricben!
Heldelberg! Wenn das Schnen dcs Jünglings nach den Rvsen der
Lust sich in einem einzigen Worte sammclt, so jubelt dte Lippe:
Heldclberg! Und wenn der gebeugte Grels am Stabe zurückbltckt
auf ein sorgenschweres Dasein, sein Auge vcrklärt sich bei der beseli-
genden Erinnerung: Heldelbcrg! Wie viel Dtchtcr hat Heidelberg
begeistcrt, wte viel Künstler erregt, wie viel Denker genährt! Ver-
schwenderisch hat cine freigiebige Natur ihre schönsten Gaben über
diesen begnadeien Erdenwinkel auSgeschüttet, und hat die Menschheit
eine Culturstätte geschaffen, von welcher sich die goldenen Ströme des
Schönen, Wahren uud Edlen befruchtend in alle Lande ergießen.
Heidelberg war es, daS dem himmelstürmcnden Geiste Spinoza in
einer Zeit der drückendstcn Finsterniß Gedankenfreiheit und Lehrkanzel
anrrug; hier war es, wo Goethe als Thibaut'S Gast beglückt ge-
sungen:
Ros' und Lilie morgenthaulich
Blüht im Garten meiner Nähe,
, Hintenan bebuscht und traulich
Stcigt der Felsen in die Höhe,
Und mit hohem Wald umzogen
Und mit Ritterschloß gekrönet
Lenkt sich hin des Gipfels Bogen,
Bis er sich dem Thal versöhnet.
Es ist ein gut Stück Weligeschichte, von dem die Mauern Heidel-
bergs sprechen. Hier, auf dem Platze vor der Universität, wagte
Luther, sechs Monate nach den Wittenberger Thesen, seine erste öffent-
liche Disputation; dort, auf dem Kirchhof von St- Peter, hielt der
Prager Hieronymus, als Ketzer von der FacultSt ausgestoßen, im
April 1406 vor Bauern und Frauen Vorlesungen; drüben der „Rit-
ter", das steinerne GasthauS, ist das einzige Gebände, welches unver-
schrt alle Stürme des dreißigjährigen Krieges, der Feuersbrünste und
Verwüstungen überdauert hat; gegenüber steht die Kirche zum heiligen
Geist, in welcher am Sonntag, 20. Deccmber 1545, bei Beginn
der Meffe, das Volk mit eincm Male das Siegerlied der Reformation
„Es ist das Heil uns kommen her" in brausendem Chor zu singcn
begann; auf dem benachbarten Marktplatz hat der Pfälzer Calvlnismus
am 23. December 1572 Johannes Srlvanus vom Lebcn zum Tode
gebracht — Jahrhunderte des Religionskrieges und Glaubenshaders;
bald waren die Kanzeln katholisch, bald lutherisch, bald reformirt!
Droben das Schloß, dieses unübertroffene Mersterwerk deutscher Bau-
Nachdruck verbotem
kunst, erzählt von den barbarischen Thaten, welche die Horden Tilly's
verübten; kcln Stein blieb auf dem andcrn in der Neckarstadt; nur
ein einziges Eigen des Pfälzer Landes ward vor jedem rauhen Luft-
zug gehütet, dtc kostbare Bibliothek, die bcrühmte Palatina, welche als
Siegesbeute nach Rom geschleppt wurde, während die Jesuiien in
die Ktrchen einzogen und die Hochschule verödete — 1626 zählte sie
einen Studenten! Und wie die Deutschen im etgnen Land, so hausten
ein halbes Jahrhundert später die Franzosen in der Pfalz; der ge-
sprengte Thurm ist dessen Zeuge, jcnes geborstene, aber nicht gcstürzte
Bollwcrk, dessen Epheuschmuck eine zweite Mauer geworden, und die
wunderbare Burg, welche seit jenen Schreckenstagen eine Ruine ist!
Freilich welche Ruine! Jn ihrer gcbrochenen Pracht noch hundertmal
prächtiger alS hundcrt Schlöffer der Folgezeit!
Und auch dort im Thurm das große Faß erzählt von den Sitten
ftüherer Zeiten. Das erste Faß hielt 158 000 Flaschen und hatte zu
seinen 24 Reifen 122 Ccntner Eisen crfordert; aber es war ein
Zwerg gegen das zweite Faß, wclches Carl Ludwig 1664 bauen ließ.
Es hielt 245176 Flaschen und trug über Bakchen, Loewen und
Satyrn einen Tanzboden mit Gallerie, und an den Seiten waren
lehrhafte Sprüche eingetragen, ais zum Beispiel:
Der Wein uns fremde Sprache lehrt,
Den Blöden Hcrtz und Muth uermehrt;
Berauscht man sich, so werden gleich
Der Knecht ein Herr, der Bertler reich.
oder:
Man brauet Bier im Land zu Meißen,
Jn Sachsen, Pommern, Holland, Preußen;
Gottlob, die edle Pfalz ain Rhein
Giebt uns nur ihren guten Weln-
Und später setzte man neben den wachsamen Zwerg Perkeo noch
die Mahnung:
Klopff nur nicht mich,
Sonst klopff ich dich,
Klopsf hier nicht an
Sonst mußt du dran.
Und mancher mußte sogar dran, ohne daß es ihn gelüstete, an-
zuklopfen. So giebt Herr von Pöllnitz über seinen Heidelberger
Aufenthalt im Jahre 1719 einen recht ergötzlichen und lehrreichen
Bericht. Der Churfürst hatte das Verlangcn, seinem Gaste das große
Faß zu zeigen. Trompeter ritten voran und der Fürst begann mit
dcm Zechen, indem er einen Humpen „von ziemlicher Weiie" auf
cinen Zug leerte und denselben dann, neu gefüllt, Pöllnitz credenzen
ließ. Pöllnitz überlief ein Graus, aber da der schuidige 'Respect nicht
zuließ, „diesen obmaßen sehr beschwerlichen Kelch abzuschlagen", so bat er,
den Becher nach und nach in gemeffenen Zügen austrinken zu dürfen.
„Solches wurde mir auch", berichtet er weiter, „erlaubet, und indemc
der Churfürst mit denen Dames im Gespräch war, profitirte ich von
seiner Abwesenheit, und machte mir kein Gewissen daraus, seibigen
heimlich zu hintergehen. Jch schüttete einen guten Theil von dem
Wein auf daS Faß, einen Theil auf die Erde, und tranke alsv das
wenigste davon. Zum Giück wurde nicmand mcines Betruges inne,
und war der Churfürst sehr wohl mit mtr zufrieden. Hierauf trank
man M'ch einige große Gläser und trugen die DameS, welche auch mit
trunken, doch nur blos die Gläser an den Mund setzten, mü darzu bei,
daß wir alle niedergerichtet wurden. Jch meines OrtS war der Erste,
dem es an Kräften fehlete, und merkte ich schon, daß der
Wein mir aufstoßen wollte, mußte auch solches bey anhaltendem
Trinken gewiß befürchten. Aus dieser Ursache machte ich mich heim-
lich davon, und schltche mich die Treppe an dem Faß hinunter, in
der Abstcht aus dem Keller zu entwischen; Als ich aber an die Thüre
kam, fand ich zwei Mann von der Churfürstlichen Leibgarde, welche
ihr Gewchr kreutzwcise üb-r cinander gestcllet hatten, und mir zuriefen:
Halt, hier kommt niemand durch. Jch batc sie inständig, mich doch passiren
zu iaffen, und verstcherte ste, daß gewisse trifftige Ursachen, mich
hinaufzugehen nöthigtcn." Aber vergebens; schließlich versteckt sich
Pöllnitz hinter dem Fasse. Scine Entfernung aber wird bemcrkt und
der Churfürst schrcit: „Wo ist er, wo ist er hingekommen? Man
suche ihn und bringe mir ihn — todt oder lebendig." Ein
Page findet ihn endlich und holt ihn aus der Höhle hervor. Dem
Misseihäter wird der Proceß gemacht. Das Weingericht wird be-
stellt. „Jhr könnet euch leicht vorstellen, daß mein Verstand schon
zremlich schwach war, und brachte man mich vor meinen Richter,
welches dcr Churfürst war. Jch nahme die Freyheit gegen ihn und
alle bei sich habende Cavalliers aus der Ursache zu protestircn/weilen
sie vor Partheyisch anznsehen, allein dcr Churfürst sagte hierauf, wie
mein gutes Herrgen! ihr verwerffet uns als eure Richter, gut, ich
will euch cmdere geben, und alSdann sehen, ob ihr besser dabey fahren
werdet. Er ernennete hierauf die Princesstn seine Tochter, und ihre
bei sich habende Dames, dass sie über mich das Urtheil fällen sollten.
Der Churfürst thate selbsten die Anklage, und ich verantwortete mich;
Hierauf wurdcn die Stlmmen gesammlet, und ich etnmüthig dahin
verurtheilt, daß ich so lange trincken solte, bis ich todt
wäre. Der Churfürst sagte hierauf, daß er als Landesherr das
Urtheil mindern wollte, und daß ich selbtgen Tag, noch 4 große
Gläser, davon jedes ein halb Maaß hlelte, 14 Tage aber an seiner
Taffel, so baid ich die Suppe gegessen, ein gleiches Glaß auf seine
Gesundheit austrincken sollte; jedermann bewunderte die Gnade des
Churfürsten, ich meines Orts mußte cin gleiches thun, und mich also
auf das höfflichsie bey ihme bedancken. Hierauf stunde ich den vor-
nchmsten Punkt meinerStraffe aus, und verlohre ich zwar nicht
das Leben darübcr, doch auf cinige Stunden Sprache
und Vernunft. Man trug mich auf ein Bette, wo ich einige Zeit
hernach wiedcrum zu mir selbsten kam, und alsdann erfuhr, daß
meinen Anklägern eben so wohl gewartet worden als mir, und daß
sie gantz andcrs aus dcm Keller heraufgegangen, als sie waren hincin
gekommen. Den andern Tag erwiese mir der Churfürst die Gnade,
das übrigc so ich von meiner Straffe noch auszustehen hatte, zu
mildern, und indem cr mir daS tägliche Straff-Trincken, worzu ich
verurthcilet worden, erließ, war er mit meinem Versprechen zufrieden,
daß ich einen Monath lang an seincr Tafel speisen wolte."
Wo ein solches Beispiel von den Fürsten gegeben ward, konnten
auch die Sitten der Studenten nicht gerade immer tadellos sein.
Die Strafedicte der Universität werfen ein Licht auf jene Verbindung
von Uebermuth und Rohheit, von Ritterlichkeit und Ungeschlachtheit