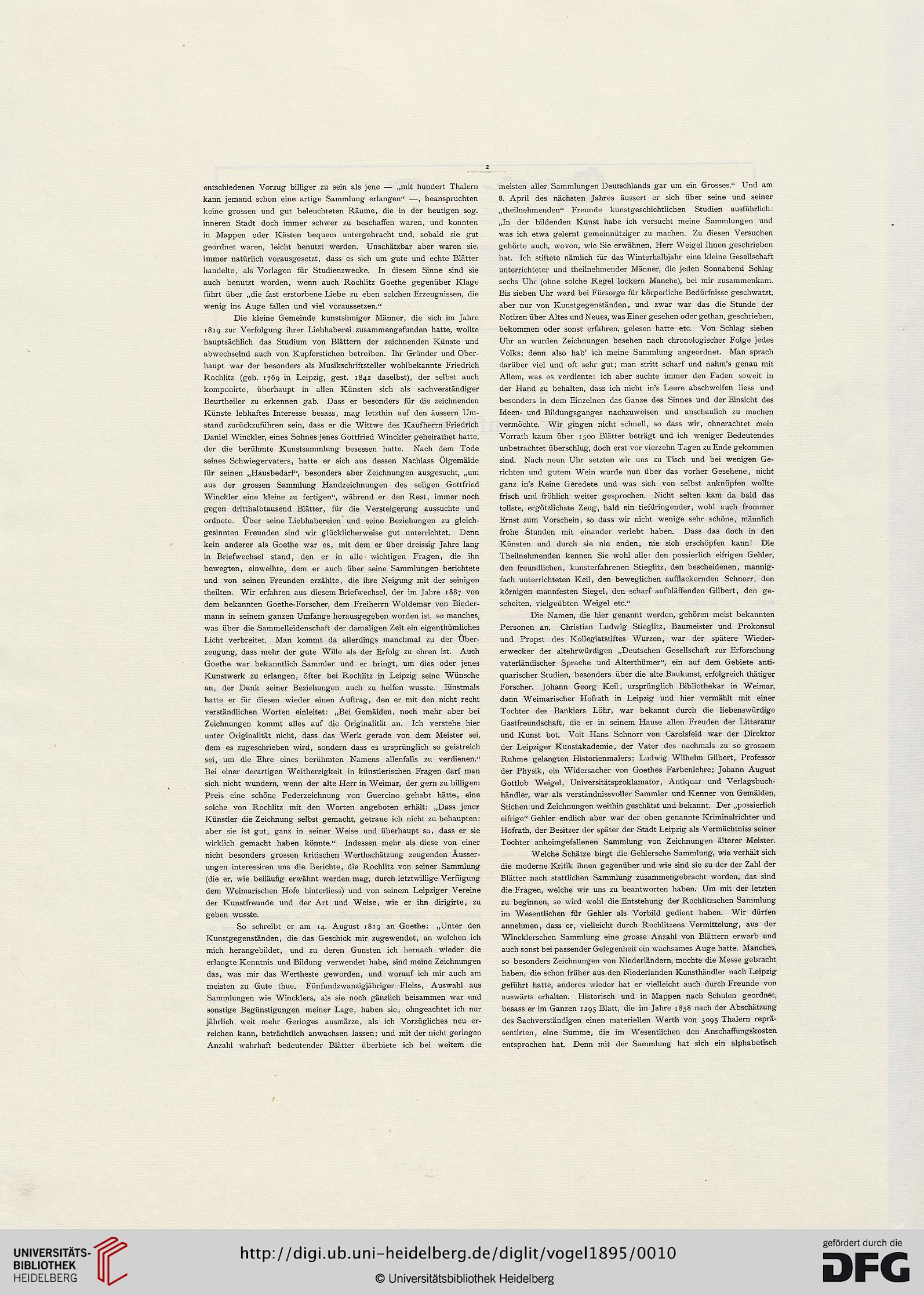2
entschiedenen Vorzug billiger zu sein als jene — „mit hundert Thalern
kann jemand schon eine artige Sammlung erlangen“ —, beanspruchten
keine grossen und gut beleuchteten Räume, die in der heutigen sog.
inneren Stadt doch immer schwer zu beschaffen waren, und konnten
in Mappen oder Kästen bequem untergebracht und, sobald sie gut
geordnet waren, leicht benutzt werden. Unschätzbar aber waren sie,
immer natürlich vorausgesetzt, dass es sich um gute und echte Blätter
handelte, als Vorlagen für Studienzwecke. In diesem Sinne sind sie
auch benutzt worden, wenn auch Rochlitz Goethe gegenüber Klage
führt über „die fast erstorbene Liebe zu eben solchen Erzeugnissen, die
wenig ins Auge fallen und viel voraussetzen.“
Die kleine Gemeinde kunstsinniger Männer, die sich im Jahre
1819 zur Verfolgung ihrer Liebhaberei zusammengefunden hatte, wollte
hauptsächlich das Studium von Blättern der zeichnenden Künste und
abwechselnd auch von Kupferstichen betreiben. Ihr Gründer und Ober-
haupt war der besonders als Musikschriftsteller wohlbekannte Friedrich
Rochlitz (geb. 1769 in Leipzig, gest. 1842 daselbst), der selbst auch
komponirte, überhaupt in allen Künsten sich als sachverständiger
Beurtheiler zu erkennen gab. Dass er besonders für die zeichnenden
Künste lebhaftes Interesse besass, mag letzthin auf den äussern Um-
stand zurückzuführen sein, dass er die Wittwe des Kaufherrn Friedrich
Daniel Winckler, eines Sohnes jenes Gottfried Winckler geheirathet hatte,
der die berühmte Kunstsammlung besessen hatte. Nach dem Tode
seines Schwiegervaters, hatte er sich aus dessen Nachlass Ölgemälde
für seinen „Hausbedarf“, besonders aber Zeichnungen ausgesucht, „um
aus der grossen Sammlung Handzeichnungen des seligen Gottfried
Winckler eine kleine zu fertigen“, während er den Rest, immer noch
gegen dritthalbtausend Blätter, für die Versteigerung aussuchte und
ordnete. Über seine Liebhabereien und seine Beziehungen zu gleich-
gesinnten Freunden sind wir glücklicherweise gut unterrichtet. Denn
kein anderer als Goethe war es, mit dem er über dreissig Jahre lang
in Briefwechsel stand, den er in alle wichtigen Fragen, die ihn
bewegten, einweihte, dem er auch über seine Sammlungen berichtete
und von seinen Freunden erzählte, die ihre Neigung mit der seinigen
theilten. Wir erfahren aus diesem Briefwechsel, der im Jahre 1887 von
dem bekannten Goethe-Forscher, dem Freiherrn Woldemar von Bieder-
mann in seinem ganzen Umfange herausgegeben worden ist, so manches,
was über die Sammelleidenschaft der damaligen Zeit ein eigenthümliches
Licht verbreitet. Man kommt da allerdings manchmal zu der Über-
zeugung, dass mehr der gute Wille als der Erfolg zu ehren ist. Auch
Goethe war bekanntlich Sammler und er bringt, um dies oder jenes
Kunstwerk zu erlangen, öfter bei Rochlitz in Leipzig seine Wünsche
an, der Dank seiner Beziehungen auch zu helfen wusste. Einstmals
hatte er für diesen wieder einen Auftrag, den er mit den nicht recht
verständlichen Worten einleitet: „Bei Gemälden, noch mehr aber bei
Zeichnungen kommt alles auf die Originalität an. Ich verstehe hier
unter Originalität nicht, dass das Werk gerade von dem Meister sei,
dem es zugeschrieben wird, sondern dass es ursprünglich so geistreich
sei, um die Ehre eines berühmten Namens allenfalls zu verdienen.“
Bei einer derartigen Weitherzigkeit in künstlerischen Fragen darf man
sich nicht wundern, wenn der alte Herr in Weimar, der gern zu billigem
Preis eine schöne Federzeichnung von Guercino gehabt hätte, eine
solche von Rochlitz mit den Worten angeboten erhält: „Dass jener
Künstler die Zeichnung selbst gemacht, getraue ich nicht zu behaupten:
aber sie ist gut, ganz in seiner Weise und überhaupt so, dass er sie
wirklich gemacht haben könnte.“ Indessen mehr als diese von einer
nicht besonders grossen kritischen Werthschätzung zeugenden Äusser-
ungen interessiren uns die Berichte, die Rochlitz von seiner Sammlung
(die er, wie beiläufig erwähnt werden mag, durch letztwillige Verfügung
dem Weimarischen Hofe hinterliess) und von seinem Leipziger Vereine
der Kunstfreunde und der Art und Weise, wie er ihn dirigirte, zu
geben wusste.
So schreibt er am 14. August 1819 an Goethe: „Unter den
Kunstgegenständen, die das Geschick mir zugewendet, an welchen ich
mich herangebildet, und zu deren Gunsten ich hernach wieder die
erlangte Kenntnis und Bildung verwendet habe, sind meine Zeichnungen
das, was mir das Wertheste geworden, und worauf ich mir auch am
meisten zu Gute thue. Fünfundzwanzigjähriger Fleiss, Auswahl aus
Sammlungen wie Wincklers, als sie noch gänzlich beisammen war und
sonstige Begünstigungen meiner Lage, haben sie, ohngeachtet ich nur
jährlich weit mehr Geringes ausmärze, als ich Vorzügliches neu er-
reichen kann, beträchtlich anwachsen lassen; und mit der nicht geringen
Anzahl wahrhaft bedeutender Blätter überbiete ich bei weitem die
meisten aller Sammlungen Deutschlands gar um ein Grosses.“ Und am
8. April des nächsten Jahres äussert er sich über seine und seiner
„theilnehm enden“ Freunde kunstgeschichtlichen Studien ausführlich:
„In der bildenden Kunst habe ich versucht meine Sammlungen und
was ich etwa gelernt gemeinnütziger zu machen. Zu diesen Versuchen
gehörte auch, wovon, wie Sie erwähnen, Herr Weigel Ihnen geschrieben
hat. Ich stiftete nämlich für das Winterhalbjahr eine kleine Gesellschaft
unterrichteter und theilnehmender Männer, die jeden Sonnabend Schlag
sechs Uhr (ohne solche Regel lockern Manche), bei mir zusammenkam.
Bis sieben Uhr ward bei Fürsorge für körperliche Bedürfnisse geschwatzt,
aber nur von Kunstgegenständen, und zwar war das die Stunde der
Notizen über Altes und Neues, was Einer gesehen oder gethan, geschrieben,
bekommen oder sonst erfahren, gelesen hatte etc. Von Schlag sieben
Uhr an wurden Zeichnungen besehen nach chronologischer Folge jedes
Volks; denn also hab’ ich meine Sammlung angeordnet. Man sprach
darüber viel und oft sehr gut; man stritt scharf und nahm’s genau mit
Allem, was es verdiente: ich aber suchte immer den Faden soweit in
der Hand zu behalten, dass ich nicht in’s Leere abschweifen liess und
besonders in dem Einzelnen das Ganze des Sinnes und der Einsicht des
Ideen- und Bildungsganges nachzuweisen und anschaulich zu machen
vermöchte. Wir gingen nicht schnell, so dass wir, ohnerachtet mein
Vorrath kaum über 1500 Blätter beträgt und ich weniger Bedeutendes
unbetrachtet überschlug, doch erst vor vierzehn Tagen zu Ende gekommen
sind. Nach neun Uhr setzten wir uns zu Tisch und bei wenigen Ge-
richten und gutem Wein wurde nun über das vorher Gesehene, nicht
ganz in’s Reine Geredete und was sich von selbst anknüpfen wollte
frisch und fröhlich weiter gesprochen. Nicht selten kam da bald das
tollste, ergötzlichste Zeug, bald ein tiefdringender, wohl auch frommer
Ernst zum Vorschein, so dass wir nicht wenige sehr schöne, männlich
frohe Stunden mit einander verlebt haben. Dass das doch in den
Künsten und durch sie nie enden, nie sich erschöpfen kann! Die
Theilnehmenden kennen Sie wohl alle: den possierlich eifrigen Gehler,
den freundlichen, kunsterfahrenen Stieglitz, den bescheidenen, mannig-
fach unterrichteten Keil, den beweglichen aufflackernden Schnorr, den
körnigen mannfesten Siegel, den scharf aufbläffenden Gilbert, den ge-
scheiten, vielgeübten Weigel etc.“
Die Namen, die hier genannt werden, gehören meist bekannten
Personen an. Christian Ludwig Stieglitz, Baumeister und Prokonsul
und Propst des Kollegiatstiftes Wurzen, war der spätere Wieder-
erwecker der altehrwürdigen „Deutschen Gesellschaft zur Erforschung
vaterländischer Sprache und Alterthümer“, ein auf dem Gebiete anti-
quarischer Studien, besonders über die alte Baukunst, erfolgreich thätiger
Forscher. Johann Georg Keil, ursprünglich Bibliothekar in Weimar,
dann Weimarischer Hofrath in Leipzig und hier vermählt mit einer
Tochter des Bankiers Löhr, war bekannt durch die liebenswürdige
Gastfreundschaft, die er in seinem Hause allen Freuden der Litteratur
und Kunst bot. Veit Hans Schnorr von Carolsfeld war der Direktor
der Leipziger Kunstakademie, der Vater des nachmals zu so grossem
Ruhme gelangten Historienmalers; Ludwig Wilhelm Gilbert, Professor
der Physik, ein Widersacher von Goethes Farbenlehre; Johann August
Gottlob Weigel, Universitätsproklamator, Antiquar und Verlagsbuch-
händler, war als verständnisvoller Sammler und Kenner von Gemälden,
Stichen und Zeichnungen weithin geschätzt und bekannt. Der „possierlich
eifrige“ Gehler endlich aber war der oben genannte Kriminalrichter und
Hofrath, der Besitzer der später der Stadt Leipzig als Vermächtniss seiner
Tochter anheimgefallenen Sammlung von Zeichnungen älterer Meister.
Welche Schätze birgt die Gehlersche Sammlung, wie verhält sich
die moderne Kritik ihnen gegenüber und wie sind sie zu der der Zahl der
Blätter nach stattlichen Sammlung zusammengebracht worden, das sind
die Fragen, welche wir uns zu beantworten haben. Um mit der letzten
zu beginnen, so wird wohl die Entstehung der Rochlitzschen Sammlung
im Wesentlichen für Gehler als Vorbild gedient haben. Wir dürfen
annehmen, dass er, vielleicht durch Rochlitzens Vermittelung, aus der
Wincklerschen Sammlung eine grosse Anzahl von Blättern erwarb und
auch sonst bei passender Gelegenheit ein wachsames Auge hatte. Manches,
so besonders Zeichnungen von Niederländern, mochte die Messe gebracht
haben, die schon früher aus den Niederlanden Kunsthändler nach Leipzig
geführt hatte, anderes wieder hat er vielleicht auch durch Freunde von
auswärts erhalten. Historisch und in Mappen nach Schulen geordnet,
besass er im Ganzen 1295 Blatt, die im Jahre 1858 nach der Abschätzung
des Sachverständigen einen materiellen Werth von 3095 Thalern reprä-
sentirten, eine Summe, die im Wesentlichen den Anschaffungskosten
entsprochen hat. Denn mit der Sammlung hat sich ein alphabetisch
r
entschiedenen Vorzug billiger zu sein als jene — „mit hundert Thalern
kann jemand schon eine artige Sammlung erlangen“ —, beanspruchten
keine grossen und gut beleuchteten Räume, die in der heutigen sog.
inneren Stadt doch immer schwer zu beschaffen waren, und konnten
in Mappen oder Kästen bequem untergebracht und, sobald sie gut
geordnet waren, leicht benutzt werden. Unschätzbar aber waren sie,
immer natürlich vorausgesetzt, dass es sich um gute und echte Blätter
handelte, als Vorlagen für Studienzwecke. In diesem Sinne sind sie
auch benutzt worden, wenn auch Rochlitz Goethe gegenüber Klage
führt über „die fast erstorbene Liebe zu eben solchen Erzeugnissen, die
wenig ins Auge fallen und viel voraussetzen.“
Die kleine Gemeinde kunstsinniger Männer, die sich im Jahre
1819 zur Verfolgung ihrer Liebhaberei zusammengefunden hatte, wollte
hauptsächlich das Studium von Blättern der zeichnenden Künste und
abwechselnd auch von Kupferstichen betreiben. Ihr Gründer und Ober-
haupt war der besonders als Musikschriftsteller wohlbekannte Friedrich
Rochlitz (geb. 1769 in Leipzig, gest. 1842 daselbst), der selbst auch
komponirte, überhaupt in allen Künsten sich als sachverständiger
Beurtheiler zu erkennen gab. Dass er besonders für die zeichnenden
Künste lebhaftes Interesse besass, mag letzthin auf den äussern Um-
stand zurückzuführen sein, dass er die Wittwe des Kaufherrn Friedrich
Daniel Winckler, eines Sohnes jenes Gottfried Winckler geheirathet hatte,
der die berühmte Kunstsammlung besessen hatte. Nach dem Tode
seines Schwiegervaters, hatte er sich aus dessen Nachlass Ölgemälde
für seinen „Hausbedarf“, besonders aber Zeichnungen ausgesucht, „um
aus der grossen Sammlung Handzeichnungen des seligen Gottfried
Winckler eine kleine zu fertigen“, während er den Rest, immer noch
gegen dritthalbtausend Blätter, für die Versteigerung aussuchte und
ordnete. Über seine Liebhabereien und seine Beziehungen zu gleich-
gesinnten Freunden sind wir glücklicherweise gut unterrichtet. Denn
kein anderer als Goethe war es, mit dem er über dreissig Jahre lang
in Briefwechsel stand, den er in alle wichtigen Fragen, die ihn
bewegten, einweihte, dem er auch über seine Sammlungen berichtete
und von seinen Freunden erzählte, die ihre Neigung mit der seinigen
theilten. Wir erfahren aus diesem Briefwechsel, der im Jahre 1887 von
dem bekannten Goethe-Forscher, dem Freiherrn Woldemar von Bieder-
mann in seinem ganzen Umfange herausgegeben worden ist, so manches,
was über die Sammelleidenschaft der damaligen Zeit ein eigenthümliches
Licht verbreitet. Man kommt da allerdings manchmal zu der Über-
zeugung, dass mehr der gute Wille als der Erfolg zu ehren ist. Auch
Goethe war bekanntlich Sammler und er bringt, um dies oder jenes
Kunstwerk zu erlangen, öfter bei Rochlitz in Leipzig seine Wünsche
an, der Dank seiner Beziehungen auch zu helfen wusste. Einstmals
hatte er für diesen wieder einen Auftrag, den er mit den nicht recht
verständlichen Worten einleitet: „Bei Gemälden, noch mehr aber bei
Zeichnungen kommt alles auf die Originalität an. Ich verstehe hier
unter Originalität nicht, dass das Werk gerade von dem Meister sei,
dem es zugeschrieben wird, sondern dass es ursprünglich so geistreich
sei, um die Ehre eines berühmten Namens allenfalls zu verdienen.“
Bei einer derartigen Weitherzigkeit in künstlerischen Fragen darf man
sich nicht wundern, wenn der alte Herr in Weimar, der gern zu billigem
Preis eine schöne Federzeichnung von Guercino gehabt hätte, eine
solche von Rochlitz mit den Worten angeboten erhält: „Dass jener
Künstler die Zeichnung selbst gemacht, getraue ich nicht zu behaupten:
aber sie ist gut, ganz in seiner Weise und überhaupt so, dass er sie
wirklich gemacht haben könnte.“ Indessen mehr als diese von einer
nicht besonders grossen kritischen Werthschätzung zeugenden Äusser-
ungen interessiren uns die Berichte, die Rochlitz von seiner Sammlung
(die er, wie beiläufig erwähnt werden mag, durch letztwillige Verfügung
dem Weimarischen Hofe hinterliess) und von seinem Leipziger Vereine
der Kunstfreunde und der Art und Weise, wie er ihn dirigirte, zu
geben wusste.
So schreibt er am 14. August 1819 an Goethe: „Unter den
Kunstgegenständen, die das Geschick mir zugewendet, an welchen ich
mich herangebildet, und zu deren Gunsten ich hernach wieder die
erlangte Kenntnis und Bildung verwendet habe, sind meine Zeichnungen
das, was mir das Wertheste geworden, und worauf ich mir auch am
meisten zu Gute thue. Fünfundzwanzigjähriger Fleiss, Auswahl aus
Sammlungen wie Wincklers, als sie noch gänzlich beisammen war und
sonstige Begünstigungen meiner Lage, haben sie, ohngeachtet ich nur
jährlich weit mehr Geringes ausmärze, als ich Vorzügliches neu er-
reichen kann, beträchtlich anwachsen lassen; und mit der nicht geringen
Anzahl wahrhaft bedeutender Blätter überbiete ich bei weitem die
meisten aller Sammlungen Deutschlands gar um ein Grosses.“ Und am
8. April des nächsten Jahres äussert er sich über seine und seiner
„theilnehm enden“ Freunde kunstgeschichtlichen Studien ausführlich:
„In der bildenden Kunst habe ich versucht meine Sammlungen und
was ich etwa gelernt gemeinnütziger zu machen. Zu diesen Versuchen
gehörte auch, wovon, wie Sie erwähnen, Herr Weigel Ihnen geschrieben
hat. Ich stiftete nämlich für das Winterhalbjahr eine kleine Gesellschaft
unterrichteter und theilnehmender Männer, die jeden Sonnabend Schlag
sechs Uhr (ohne solche Regel lockern Manche), bei mir zusammenkam.
Bis sieben Uhr ward bei Fürsorge für körperliche Bedürfnisse geschwatzt,
aber nur von Kunstgegenständen, und zwar war das die Stunde der
Notizen über Altes und Neues, was Einer gesehen oder gethan, geschrieben,
bekommen oder sonst erfahren, gelesen hatte etc. Von Schlag sieben
Uhr an wurden Zeichnungen besehen nach chronologischer Folge jedes
Volks; denn also hab’ ich meine Sammlung angeordnet. Man sprach
darüber viel und oft sehr gut; man stritt scharf und nahm’s genau mit
Allem, was es verdiente: ich aber suchte immer den Faden soweit in
der Hand zu behalten, dass ich nicht in’s Leere abschweifen liess und
besonders in dem Einzelnen das Ganze des Sinnes und der Einsicht des
Ideen- und Bildungsganges nachzuweisen und anschaulich zu machen
vermöchte. Wir gingen nicht schnell, so dass wir, ohnerachtet mein
Vorrath kaum über 1500 Blätter beträgt und ich weniger Bedeutendes
unbetrachtet überschlug, doch erst vor vierzehn Tagen zu Ende gekommen
sind. Nach neun Uhr setzten wir uns zu Tisch und bei wenigen Ge-
richten und gutem Wein wurde nun über das vorher Gesehene, nicht
ganz in’s Reine Geredete und was sich von selbst anknüpfen wollte
frisch und fröhlich weiter gesprochen. Nicht selten kam da bald das
tollste, ergötzlichste Zeug, bald ein tiefdringender, wohl auch frommer
Ernst zum Vorschein, so dass wir nicht wenige sehr schöne, männlich
frohe Stunden mit einander verlebt haben. Dass das doch in den
Künsten und durch sie nie enden, nie sich erschöpfen kann! Die
Theilnehmenden kennen Sie wohl alle: den possierlich eifrigen Gehler,
den freundlichen, kunsterfahrenen Stieglitz, den bescheidenen, mannig-
fach unterrichteten Keil, den beweglichen aufflackernden Schnorr, den
körnigen mannfesten Siegel, den scharf aufbläffenden Gilbert, den ge-
scheiten, vielgeübten Weigel etc.“
Die Namen, die hier genannt werden, gehören meist bekannten
Personen an. Christian Ludwig Stieglitz, Baumeister und Prokonsul
und Propst des Kollegiatstiftes Wurzen, war der spätere Wieder-
erwecker der altehrwürdigen „Deutschen Gesellschaft zur Erforschung
vaterländischer Sprache und Alterthümer“, ein auf dem Gebiete anti-
quarischer Studien, besonders über die alte Baukunst, erfolgreich thätiger
Forscher. Johann Georg Keil, ursprünglich Bibliothekar in Weimar,
dann Weimarischer Hofrath in Leipzig und hier vermählt mit einer
Tochter des Bankiers Löhr, war bekannt durch die liebenswürdige
Gastfreundschaft, die er in seinem Hause allen Freuden der Litteratur
und Kunst bot. Veit Hans Schnorr von Carolsfeld war der Direktor
der Leipziger Kunstakademie, der Vater des nachmals zu so grossem
Ruhme gelangten Historienmalers; Ludwig Wilhelm Gilbert, Professor
der Physik, ein Widersacher von Goethes Farbenlehre; Johann August
Gottlob Weigel, Universitätsproklamator, Antiquar und Verlagsbuch-
händler, war als verständnisvoller Sammler und Kenner von Gemälden,
Stichen und Zeichnungen weithin geschätzt und bekannt. Der „possierlich
eifrige“ Gehler endlich aber war der oben genannte Kriminalrichter und
Hofrath, der Besitzer der später der Stadt Leipzig als Vermächtniss seiner
Tochter anheimgefallenen Sammlung von Zeichnungen älterer Meister.
Welche Schätze birgt die Gehlersche Sammlung, wie verhält sich
die moderne Kritik ihnen gegenüber und wie sind sie zu der der Zahl der
Blätter nach stattlichen Sammlung zusammengebracht worden, das sind
die Fragen, welche wir uns zu beantworten haben. Um mit der letzten
zu beginnen, so wird wohl die Entstehung der Rochlitzschen Sammlung
im Wesentlichen für Gehler als Vorbild gedient haben. Wir dürfen
annehmen, dass er, vielleicht durch Rochlitzens Vermittelung, aus der
Wincklerschen Sammlung eine grosse Anzahl von Blättern erwarb und
auch sonst bei passender Gelegenheit ein wachsames Auge hatte. Manches,
so besonders Zeichnungen von Niederländern, mochte die Messe gebracht
haben, die schon früher aus den Niederlanden Kunsthändler nach Leipzig
geführt hatte, anderes wieder hat er vielleicht auch durch Freunde von
auswärts erhalten. Historisch und in Mappen nach Schulen geordnet,
besass er im Ganzen 1295 Blatt, die im Jahre 1858 nach der Abschätzung
des Sachverständigen einen materiellen Werth von 3095 Thalern reprä-
sentirten, eine Summe, die im Wesentlichen den Anschaffungskosten
entsprochen hat. Denn mit der Sammlung hat sich ein alphabetisch
r