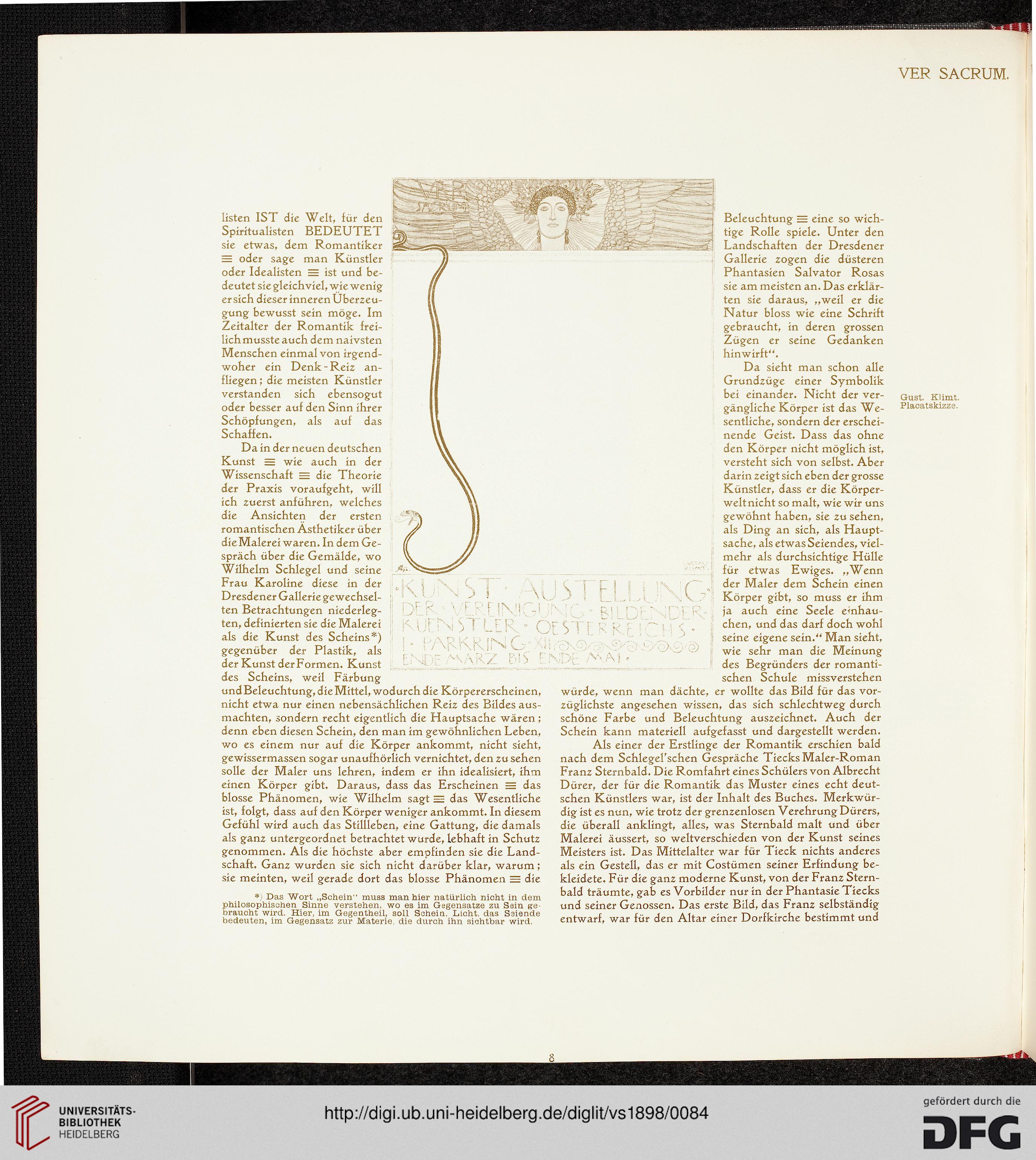VER SACRUM.
listen IST die Welt, für den
Spiritualisten BEDEUTET
sie etwas, dem Romantiker
= oder sage man Künstler
oder Idealisten = ist und be-
deutet sie gleichviel, wie wenig
er sich dieser inneren Uberzeu-
gung bewusst sein möge. Im
Zeitalter der Romantik frei-
lich musste auch dem naivsten
Menschen einmal von irgend-
woher ein Denk-Reiz an-
fliegen ; die meisten Künstler
verstanden sich ebensogut
oder besser auf den Sinn ihrer
Schöpfungen, als auf das
Schaffen.
Da in der neuen deutschen
Kunst == wie auch in der
Wissenschaft = die Theorie
der Praxis voraufgeht, will
ich zuerst anführen, welches
die Ansichten der ersten
romantischen Ästhetiker über
dieMalerei waren. In dem Ge-
spräch über die Gemälde, wo
Wilhelm Schlegel und seine
Frau Karoline diese in der
Dresdener Gallerie gewechsel-
ten Betrachtungen niederleg-
ten, definierten sie die Malerei
als die Kunst des Scheins*)
gegenüber der Plastik, als
der Kunst derFormen. Kunst
des Scheins, weil Färbung
und Beleuchtung, die Mittel, wodurch die Körpererscheinen,
nicht etwa nur einen nebensächlichen Reiz des Bildes aus-
machten, sondern recht eigentlich die Hauptsache wären;
denn eben diesen Schein, den man im gewöhnlichen Leben,
wo es einem nur auf die Körper ankommt, nicht sieht,
gewissermassen sogar unaufhörlich vernichtet, den zu sehen
solle der Maler uns lehren, indem er ihn idealisiert, ihm
einen Körper gibt. Daraus, dass das Erscheinen = das
blosse Phänomen, wie Wilhelm sagt = das Wesentliche
ist, folgt, dass auf den Körper weniger ankommt. In diesem
Gefühl wird auch das Stillleben, eine Gattung, die damals
als ganz untergeordnet betrachtet wurde, lebhaft in Schutz
genommen. Als die höchste aber empfinden sie die Land-
schaft. Ganz wurden sie sich nicht darüber klar, warum;
sie meinten, weil gerade dort das blosse Phänomen = die
*) Das Wort „Schein" muss man hier natürlich nicht in dem
philosophischen Sinne verstehen, wo es im Gegensatze zu Sein ge-
braucht wird. Hier, im Gegentheil, soll Schein, Licht, das Seiende
bedeuten, im Gegensatz zur Materie, die durch ihn sichtbar wird.
man schon alle
Symbolik
DPR ■ VEREINE
KUCN 5TLEK
!• PARKKfNr
EINIDE ^NAJVZ
BIS
Beleuchtung = eine so wich-
tige Rolle spiele. Unter den
Landschaften der Dresdener
Gallerie zogen die düsteren
Phantasien Salvator Rosas
sie am meisten an. Das erklär-
ten sie daraus, „weil er die
Natur bloss wie eine Schrift
gebraucht, in deren grossen
Zügen er seine Gedanken
hinwirft".
Da sieht
Grundzüge einer
bei einander. Nicht der ver-
gängliche Körper ist das We-
sentliche, sondern der erschei-
nende Geist. Dass das ohne
den Körper nicht möglich ist,
versteht sich von selbst. Aber
darin zeigt sich eben der grosse
Künstler, dass er die Körper-
welt nicht so malt, wie wir uns
gewöhnt haben, sie zu sehen,
als Ding an sich, als Haupt-
sache, als etwas Seiendes, viel-
mehr als durchsichtige Hülle
für etwas Ewiges. „Wenn
der Maler dem Schein einen
Körper gibt, so muss er ihm
ja auch eine Seele einhau-
chen, und das darf doch wohl
seine eigene sein." Man sieht,
wie sehr man die Meinung
des Begründers der romanti-
schen Schule missverstehen
würde, wenn man dächte, er wollte das Bild für das vor-
züglichste angesehen wissen, das sich schlechtweg durch
schöne Farbe und Beleuchtung auszeichnet. Auch der
Schein kann materiell aufgefasst und dargestellt werden.
Als einer der Erstlinge der Romantik erschien bald
nach dem Schlegel'schen Gespräche Tiecks Maler-Roman
Franz Sternbald. Die Romfahrt eines Schülers von Albrecht
Dürer, der für die Romantik das Muster eines echt deut-
schen Künstlers war, ist der Inhalt des Buches. Merkwür-
dig ist es nun, wie trotz der grenzenlosen Verehrung Dürers,
die überall anklingt, alles, was Sternbald malt und über
Malerei äussert, so weltverschieden von der Kunst seines
Meisters ist. Das Mittelalter war für Tieck nichts anderes
als ein Gestell, das er mit Costümen seiner Erfindung be-
kleidete. Für die ganz moderne Kunst, von der Franz Stern-
bald träumte, gab es Vorbilder nur in der Phantasie Tiecks
und seiner Genossen. Das erste Bild, das Franz selbständig
entwarf, war für den Altar einer Dorfkirche bestimmt und
3"
L
R
DI Luv'..
OESTE R K.
■
ENDE A\M
Gust. Klimt.
Placatskizze.
8
listen IST die Welt, für den
Spiritualisten BEDEUTET
sie etwas, dem Romantiker
= oder sage man Künstler
oder Idealisten = ist und be-
deutet sie gleichviel, wie wenig
er sich dieser inneren Uberzeu-
gung bewusst sein möge. Im
Zeitalter der Romantik frei-
lich musste auch dem naivsten
Menschen einmal von irgend-
woher ein Denk-Reiz an-
fliegen ; die meisten Künstler
verstanden sich ebensogut
oder besser auf den Sinn ihrer
Schöpfungen, als auf das
Schaffen.
Da in der neuen deutschen
Kunst == wie auch in der
Wissenschaft = die Theorie
der Praxis voraufgeht, will
ich zuerst anführen, welches
die Ansichten der ersten
romantischen Ästhetiker über
dieMalerei waren. In dem Ge-
spräch über die Gemälde, wo
Wilhelm Schlegel und seine
Frau Karoline diese in der
Dresdener Gallerie gewechsel-
ten Betrachtungen niederleg-
ten, definierten sie die Malerei
als die Kunst des Scheins*)
gegenüber der Plastik, als
der Kunst derFormen. Kunst
des Scheins, weil Färbung
und Beleuchtung, die Mittel, wodurch die Körpererscheinen,
nicht etwa nur einen nebensächlichen Reiz des Bildes aus-
machten, sondern recht eigentlich die Hauptsache wären;
denn eben diesen Schein, den man im gewöhnlichen Leben,
wo es einem nur auf die Körper ankommt, nicht sieht,
gewissermassen sogar unaufhörlich vernichtet, den zu sehen
solle der Maler uns lehren, indem er ihn idealisiert, ihm
einen Körper gibt. Daraus, dass das Erscheinen = das
blosse Phänomen, wie Wilhelm sagt = das Wesentliche
ist, folgt, dass auf den Körper weniger ankommt. In diesem
Gefühl wird auch das Stillleben, eine Gattung, die damals
als ganz untergeordnet betrachtet wurde, lebhaft in Schutz
genommen. Als die höchste aber empfinden sie die Land-
schaft. Ganz wurden sie sich nicht darüber klar, warum;
sie meinten, weil gerade dort das blosse Phänomen = die
*) Das Wort „Schein" muss man hier natürlich nicht in dem
philosophischen Sinne verstehen, wo es im Gegensatze zu Sein ge-
braucht wird. Hier, im Gegentheil, soll Schein, Licht, das Seiende
bedeuten, im Gegensatz zur Materie, die durch ihn sichtbar wird.
man schon alle
Symbolik
DPR ■ VEREINE
KUCN 5TLEK
!• PARKKfNr
EINIDE ^NAJVZ
BIS
Beleuchtung = eine so wich-
tige Rolle spiele. Unter den
Landschaften der Dresdener
Gallerie zogen die düsteren
Phantasien Salvator Rosas
sie am meisten an. Das erklär-
ten sie daraus, „weil er die
Natur bloss wie eine Schrift
gebraucht, in deren grossen
Zügen er seine Gedanken
hinwirft".
Da sieht
Grundzüge einer
bei einander. Nicht der ver-
gängliche Körper ist das We-
sentliche, sondern der erschei-
nende Geist. Dass das ohne
den Körper nicht möglich ist,
versteht sich von selbst. Aber
darin zeigt sich eben der grosse
Künstler, dass er die Körper-
welt nicht so malt, wie wir uns
gewöhnt haben, sie zu sehen,
als Ding an sich, als Haupt-
sache, als etwas Seiendes, viel-
mehr als durchsichtige Hülle
für etwas Ewiges. „Wenn
der Maler dem Schein einen
Körper gibt, so muss er ihm
ja auch eine Seele einhau-
chen, und das darf doch wohl
seine eigene sein." Man sieht,
wie sehr man die Meinung
des Begründers der romanti-
schen Schule missverstehen
würde, wenn man dächte, er wollte das Bild für das vor-
züglichste angesehen wissen, das sich schlechtweg durch
schöne Farbe und Beleuchtung auszeichnet. Auch der
Schein kann materiell aufgefasst und dargestellt werden.
Als einer der Erstlinge der Romantik erschien bald
nach dem Schlegel'schen Gespräche Tiecks Maler-Roman
Franz Sternbald. Die Romfahrt eines Schülers von Albrecht
Dürer, der für die Romantik das Muster eines echt deut-
schen Künstlers war, ist der Inhalt des Buches. Merkwür-
dig ist es nun, wie trotz der grenzenlosen Verehrung Dürers,
die überall anklingt, alles, was Sternbald malt und über
Malerei äussert, so weltverschieden von der Kunst seines
Meisters ist. Das Mittelalter war für Tieck nichts anderes
als ein Gestell, das er mit Costümen seiner Erfindung be-
kleidete. Für die ganz moderne Kunst, von der Franz Stern-
bald träumte, gab es Vorbilder nur in der Phantasie Tiecks
und seiner Genossen. Das erste Bild, das Franz selbständig
entwarf, war für den Altar einer Dorfkirche bestimmt und
3"
L
R
DI Luv'..
OESTE R K.
■
ENDE A\M
Gust. Klimt.
Placatskizze.
8