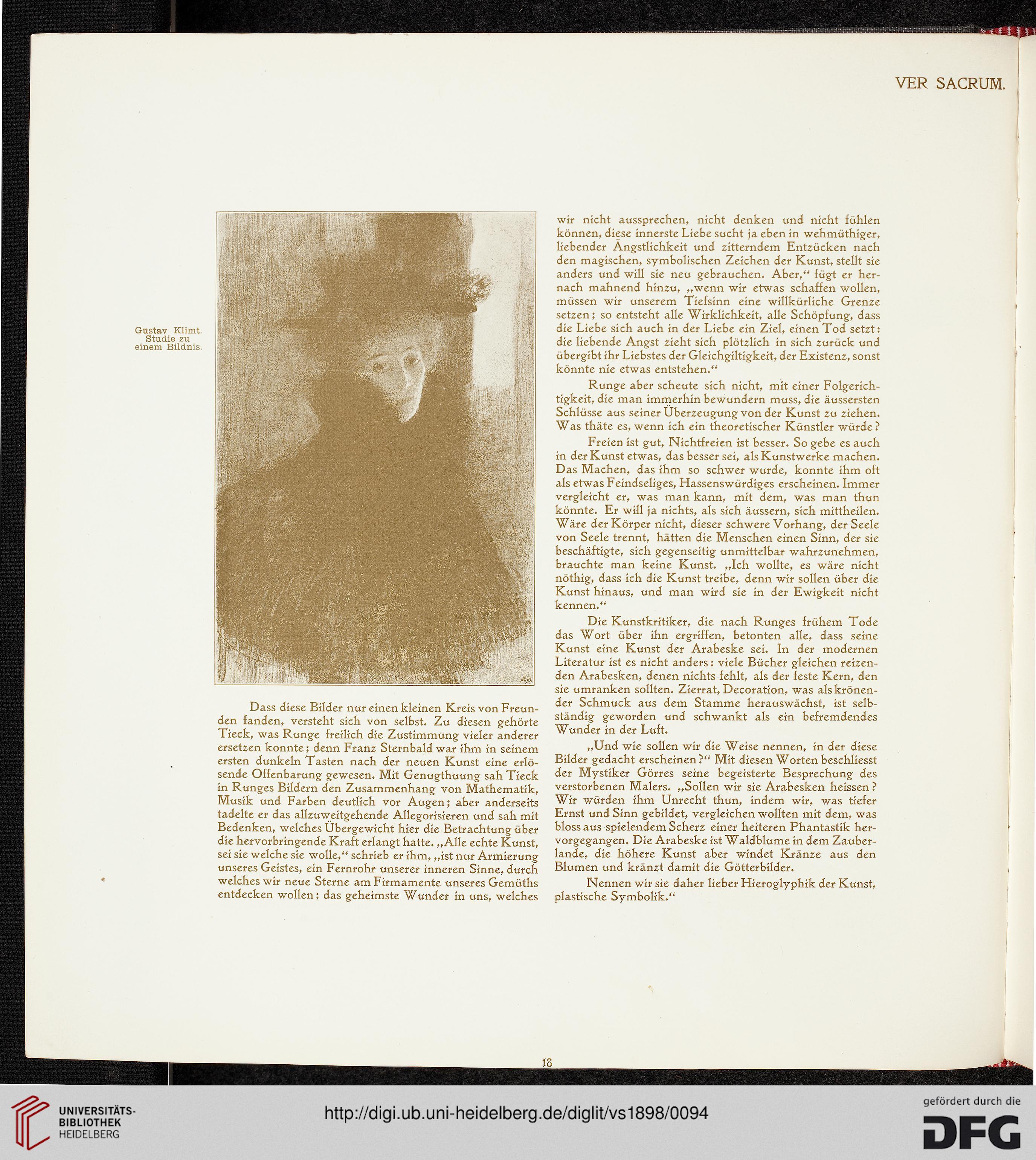Gustav Klimt.
Studie zu
einem Bildnis.
Dass diese Bilder nur einen kleinen Kreis von Freun-
den fanden, versteht sich von selbst. Zu diesen gehörte
Tieck, was Runge freilich die Zustimmung vieler anderer
ersetzen konnte; denn Franz Sternbald war ihm in seinem
ersten dunkeln Tasten nach der neuen Kunst eine erlö-
sende Offenbarung gewesen. Mit Genugthuung sah Tieck
in Runges Bildern den Zusammenhang von Mathematik,
Musik und Farben deutlich vor Augen; aber anderseits
tadelte er das allzuweitgehende Allegorisieren und sah mit
Bedenken, welches Ubergewicht hier die Betrachtung über
die hervorbringende Kraft erlangt hatte. „Alle echte Kunst,
sei sie welche sie wolle," schrieb er ihm, „ist nur Armierung
unseres Geistes, ein Fernrohr unserer inneren Sinne, durch
welches wir neue Sterne am Firmamente unseres Gemüths
entdecken wollen; das geheimste Wunder in uns, welches
VER SACRUM.
wir nicht aussprechen, nicht denken und nicht fühlen
können, diese innerste Liebe sucht ja eben in wehmüthiger.
liebender Ängstlichkeit und zitterndem Entzücken nach
den magischen, symbolischen Zeichen der Kunst, stellt sie
anders und will sie neu gebrauchen. Aber," fügt er her-
nach mahnend hinzu, „wenn wir etwas schaffen wollen,
müssen wir unserem Tiefsinn eine willkürliche Grenze
setzen; so entsteht alle Wirklichkeit, alle Schöpfung, dass
die Liebe sich auch in der Liebe ein Ziel, einen Tod setzt:
die liebende Angst zieht sich plötzlich in sich zurück und
übergibt ihr Liebstes der Gleichgiltigkeit, der Existenz, sonst
könnte nie etwas entstehen."
Runge aber scheute sich nicht, mit einer Folgerich-
tigkeit, die man immerhin bewundern muss, die äussersten
Schlüsse aus seiner Uberzeugung von der Kunst zu ziehen.
Was thäte es, wenn ich ein theoretischer Künstler würde ?
Freien ist gut, Nichtfreien ist besser. So gebe es auch
in der Kunst etwas, das besser sei, als Kunstwerke machen.
Das Machen, das ihm so schwer wurde, konnte ihm oft
als etwas Feindseliges, Hassenswürdiges erscheinen. Immer
vergleicht er, was man kann, mit dem, was man thun
könnte. Er will ja nichts, als sich äussern, sich mittheilen.
Wäre der Körper nicht, dieser schwere Vorhang, der Seele
von Seele trennt, hätten die Menschen einen Sinn, der sie
beschäftigte, sich gegenseitig unmittelbar wahrzunehmen,
brauchte man keine Kunst. „Ich wollte, es wäre nicht
nöthig, dass ich die Kunst treibe, denn wir sollen über die
Kunst hinaus, und man wird sie in der Ewigkeit nicht
kennen."
Die Kunstkritiker, die nach Runges frühem Tode
das Wort über ihn ergriffen, betonten alle, dass seine
Kunst eine Kunst der Arabeske sei. In der modernen
Literatur ist es nicht anders: viele Bücher gleichen reizen-
den Arabesken, denen nichts fehlt, als der feste Kern, den
sie umranken sollten. Zierrat, Decoration, was als krönen-
der Schmuck aus dem Stamme herauswächst, ist selb-
ständig geworden und schwankt als ein befremdendes
Wunder in der Luft.
„Und wie sollen wir die Weise nennen, in der diese
Bilder gedacht erscheinen ?" Mit diesen Worten beschliesst
der Mystiker Görres seine begeisterte Besprechung des
verstorbenen Malers. „Sollen wir sie Arabesken heissen ?
Wir würden ihm Unrecht thun, indem wir, was tiefer
Ernst und Sinn gebildet, vergleichen wollten mit dem, was
bloss aus spielendem Scherz einer heiteren Phantastik her-
vorgegangen. Die Arabeske ist Waldblume in dem Zauber-
lande, die höhere Kunst aber windet Kränze aus den
Blumen und kränzt damit die Götterbilder.
Nennen wir sie daher lieber Hieroglyphik der Kunst,
plastische Symbolik."
Studie zu
einem Bildnis.
Dass diese Bilder nur einen kleinen Kreis von Freun-
den fanden, versteht sich von selbst. Zu diesen gehörte
Tieck, was Runge freilich die Zustimmung vieler anderer
ersetzen konnte; denn Franz Sternbald war ihm in seinem
ersten dunkeln Tasten nach der neuen Kunst eine erlö-
sende Offenbarung gewesen. Mit Genugthuung sah Tieck
in Runges Bildern den Zusammenhang von Mathematik,
Musik und Farben deutlich vor Augen; aber anderseits
tadelte er das allzuweitgehende Allegorisieren und sah mit
Bedenken, welches Ubergewicht hier die Betrachtung über
die hervorbringende Kraft erlangt hatte. „Alle echte Kunst,
sei sie welche sie wolle," schrieb er ihm, „ist nur Armierung
unseres Geistes, ein Fernrohr unserer inneren Sinne, durch
welches wir neue Sterne am Firmamente unseres Gemüths
entdecken wollen; das geheimste Wunder in uns, welches
VER SACRUM.
wir nicht aussprechen, nicht denken und nicht fühlen
können, diese innerste Liebe sucht ja eben in wehmüthiger.
liebender Ängstlichkeit und zitterndem Entzücken nach
den magischen, symbolischen Zeichen der Kunst, stellt sie
anders und will sie neu gebrauchen. Aber," fügt er her-
nach mahnend hinzu, „wenn wir etwas schaffen wollen,
müssen wir unserem Tiefsinn eine willkürliche Grenze
setzen; so entsteht alle Wirklichkeit, alle Schöpfung, dass
die Liebe sich auch in der Liebe ein Ziel, einen Tod setzt:
die liebende Angst zieht sich plötzlich in sich zurück und
übergibt ihr Liebstes der Gleichgiltigkeit, der Existenz, sonst
könnte nie etwas entstehen."
Runge aber scheute sich nicht, mit einer Folgerich-
tigkeit, die man immerhin bewundern muss, die äussersten
Schlüsse aus seiner Uberzeugung von der Kunst zu ziehen.
Was thäte es, wenn ich ein theoretischer Künstler würde ?
Freien ist gut, Nichtfreien ist besser. So gebe es auch
in der Kunst etwas, das besser sei, als Kunstwerke machen.
Das Machen, das ihm so schwer wurde, konnte ihm oft
als etwas Feindseliges, Hassenswürdiges erscheinen. Immer
vergleicht er, was man kann, mit dem, was man thun
könnte. Er will ja nichts, als sich äussern, sich mittheilen.
Wäre der Körper nicht, dieser schwere Vorhang, der Seele
von Seele trennt, hätten die Menschen einen Sinn, der sie
beschäftigte, sich gegenseitig unmittelbar wahrzunehmen,
brauchte man keine Kunst. „Ich wollte, es wäre nicht
nöthig, dass ich die Kunst treibe, denn wir sollen über die
Kunst hinaus, und man wird sie in der Ewigkeit nicht
kennen."
Die Kunstkritiker, die nach Runges frühem Tode
das Wort über ihn ergriffen, betonten alle, dass seine
Kunst eine Kunst der Arabeske sei. In der modernen
Literatur ist es nicht anders: viele Bücher gleichen reizen-
den Arabesken, denen nichts fehlt, als der feste Kern, den
sie umranken sollten. Zierrat, Decoration, was als krönen-
der Schmuck aus dem Stamme herauswächst, ist selb-
ständig geworden und schwankt als ein befremdendes
Wunder in der Luft.
„Und wie sollen wir die Weise nennen, in der diese
Bilder gedacht erscheinen ?" Mit diesen Worten beschliesst
der Mystiker Görres seine begeisterte Besprechung des
verstorbenen Malers. „Sollen wir sie Arabesken heissen ?
Wir würden ihm Unrecht thun, indem wir, was tiefer
Ernst und Sinn gebildet, vergleichen wollten mit dem, was
bloss aus spielendem Scherz einer heiteren Phantastik her-
vorgegangen. Die Arabeske ist Waldblume in dem Zauber-
lande, die höhere Kunst aber windet Kränze aus den
Blumen und kränzt damit die Götterbilder.
Nennen wir sie daher lieber Hieroglyphik der Kunst,
plastische Symbolik."