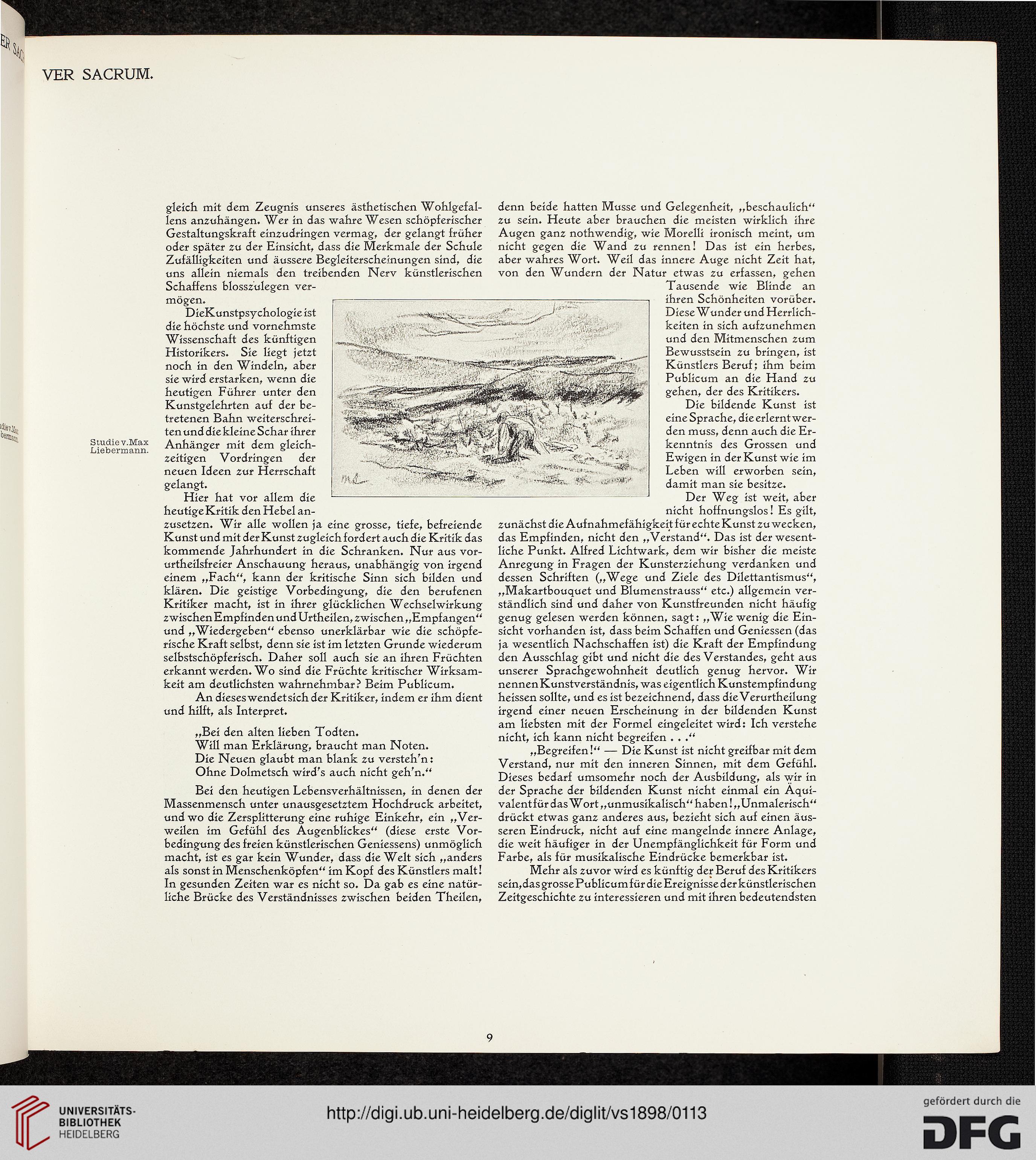VER SACRUM.
Studie v.Max
.Liebermann.
gleich mit dem Zeugnis unseres ästhetischen Wohlgefal-
lens anzuhängen. Wer in das wahre Wesen schöpferischer
Gestaltungskraft einzudringen vermag, der gelangt früher
oder später zu der Einsicht, dass die Merkmale der Schule
Zufälligkeiten und äussere Begleiterscheinungen sind, die
uns allein niemals den treibenden Nerv künstlerischen
Schaffens blosszulegen ver-
mögen.
DieKunstpsychologie ist
die höchste und vornehmste
Wissenschaft des künftigen
Historikers. Sie liegt jetzt
noch in den Windeln, aber
sie wird erstarken, wenn die
heutigen Führer unter den
von
Kunstgelehrten auf der be-
tretenen Bahn weiterschrei-
ten und die kleine Schar ihrer
Anhänger mit dem gleich-
zeitigen Vordringen der
neuen Ideen zur Herrschaft
gelangt.
Hier hat vor allem die '-
heutige Kritik den Hebel an-
zusetzen. Wir alle wollen ja eine grosse, tiefe, befreiende
Kunst und mit der Kunst zugleich fordert auch die Kritik das
kommende Jahrhundert in die Schranken. Nur aus vor-
urtheilsfreier Anschauung heraus, unabhängig von irgend
einem „Fach", kann der kritische Sinn sich bilden und
klären. Die geistige Vorbedingung, die den berufenen
Kritiker macht, ist in ihrer glücklichen Wechselwirkung
zwischen Empfinden und Urtheilen, zwischen „Empfangen"
und „Wiedergeben" ebenso unerklärbar wie die schöpfe-
rische Kraft selbst, denn sie ist im letzten Grunde wiederum
selbstschöpferisch. Daher soll auch sie an ihren Früchten
erkannt werden. Wo sind die Früchte kritischer Wirksam-
keit am deutlichsten wahrnehmbar? Beim Publicum.
An dieses wendet sich der Kritiker, indem er ihm dient
und hilft, als Interpret.
„Bei den alten lieben Todten.
Will man Erklärung, braucht man Noten.
Die Neuen glaubt man blank zu versteh'n:
Ohne Dolmetsch wird's auch nicht geh'n."
Bei den heutigen Lebensverhältnissen, in denen der
Massenmensch unter unausgesetztem Hochdruck arbeitet,
und wo die Zersplitterung eine ruhige Einkehr, ein „Ver-
weilen im Gefühl des Augenblickes" (diese erste Vor-
bedingung des freien künstlerischen Geniessens) unmöglich
macht, ist es gar kein Wunder, dass die Welt sich „anders
als sonst in Menschenköpfen" im Kopf des Künstlers malt!
In gesunden Zeiten war es nicht so. Da gab es eine natür-
liche Brücke des Verständnisses zwischen beiden Theilen,
denn beide hatten Müsse und Gelegenheit, „beschaulich"
zu sein. Heute aber brauchen die meisten wirklich ihre
Augen ganz nothwendig, wie Morelli ironisch meint, um
nicht gegen die Wand zu rennen! Das ist ein herbes,
aber wahres Wort. Weil das innere Auge nicht Zeit hat,
den Wundern der Natur etwas zu erfassen, gehen
Tausende wie Blinde an
ihren Schönheiten vorüber.
Diese Wunder und Herrlich-
keiten in sich aufzunehmen
und den Mitmenschen zum
Bewusstsein zu bringen, ist
Künstlers Beruf; ihm beim
Publicum an die Hand zu
gehen, der des Kritikers.
Die bildende Kunst ist
eine Sprache, die erlernt wer-
den muss, denn auch die Er-
kenntnis des Grossen und
Ewigen in der Kunst wie im
Leben will erworben sein,
damit man sie besitze.
Der Weg ist weit, aber
nicht hoffnungslos! Es gilt,
zunächst die Aufnahmefähigkeit für echte Kunst zu wecken,
das Empfinden, nicht den „Verstand". Das ist der wesent-
liche Punkt. Alfred Lichtwark, dem wir bisher die meiste
Anregung in Fragen der Kunsterziehung verdanken und
dessen Schriften („Wege und Ziele des Dilettantismus",
„Makartbouquet und Blumenstrauss" etc.) allgemein ver-
ständlich sind und daher von Kunstfreunden nicht häufig
genug gelesen werden können, sagt: „Wie wenig die Ein-
sicht vorhanden ist, dass beim Schaffen und Geniessen (das
ja wesentlich Nachschaffen ist) die Kraft der Empfindung
den Ausschlag gibt und nicht die des Verstandes, geht aus
unserer Sprachgewohnheit deutlich genug hervor. Wir
nennen Kunstverständnis, was eigentlich Kunstempfindung
heissen sollte, und es ist bezeichnend, dass die Verurtheilung
irgend einer neuen Erscheinung in der bildenden Kunst
am liebsten mit der Formel eingeleitet wird: Ich verstehe
nicht, ich kann nicht begreifen . . ."
„Begreifen!" — Die Kunst ist nicht greifbar mit dem
Verstand, nur mit den inneren Sinnen, mit dem Gefühl.
Dieses bedarf umsomehr noch der Ausbildung, als wir in
der Sprache der bildenden Kunst nicht einmal ein Aqui-
valentfür das Wort „unmusikalisch" haben! „Unmalerisch"
drückt etwas ganz anderes aus, bezieht sich auf einen äus-
seren Eindruck, nicht auf eine mangelnde innere Anlage,
die weit häufiger in der Unempfänglichkeit für Form und
Farbe, als für musikalische Eindrücke bemerkbar ist.
Mehr als zuvor wird es künftig der Beruf des Kritikers
sein,das grosse Publicum für die Ereignisse der künstlerischen
Zeitgeschichte zu interessieren und mit ihren bedeutendsten
9
Studie v.Max
.Liebermann.
gleich mit dem Zeugnis unseres ästhetischen Wohlgefal-
lens anzuhängen. Wer in das wahre Wesen schöpferischer
Gestaltungskraft einzudringen vermag, der gelangt früher
oder später zu der Einsicht, dass die Merkmale der Schule
Zufälligkeiten und äussere Begleiterscheinungen sind, die
uns allein niemals den treibenden Nerv künstlerischen
Schaffens blosszulegen ver-
mögen.
DieKunstpsychologie ist
die höchste und vornehmste
Wissenschaft des künftigen
Historikers. Sie liegt jetzt
noch in den Windeln, aber
sie wird erstarken, wenn die
heutigen Führer unter den
von
Kunstgelehrten auf der be-
tretenen Bahn weiterschrei-
ten und die kleine Schar ihrer
Anhänger mit dem gleich-
zeitigen Vordringen der
neuen Ideen zur Herrschaft
gelangt.
Hier hat vor allem die '-
heutige Kritik den Hebel an-
zusetzen. Wir alle wollen ja eine grosse, tiefe, befreiende
Kunst und mit der Kunst zugleich fordert auch die Kritik das
kommende Jahrhundert in die Schranken. Nur aus vor-
urtheilsfreier Anschauung heraus, unabhängig von irgend
einem „Fach", kann der kritische Sinn sich bilden und
klären. Die geistige Vorbedingung, die den berufenen
Kritiker macht, ist in ihrer glücklichen Wechselwirkung
zwischen Empfinden und Urtheilen, zwischen „Empfangen"
und „Wiedergeben" ebenso unerklärbar wie die schöpfe-
rische Kraft selbst, denn sie ist im letzten Grunde wiederum
selbstschöpferisch. Daher soll auch sie an ihren Früchten
erkannt werden. Wo sind die Früchte kritischer Wirksam-
keit am deutlichsten wahrnehmbar? Beim Publicum.
An dieses wendet sich der Kritiker, indem er ihm dient
und hilft, als Interpret.
„Bei den alten lieben Todten.
Will man Erklärung, braucht man Noten.
Die Neuen glaubt man blank zu versteh'n:
Ohne Dolmetsch wird's auch nicht geh'n."
Bei den heutigen Lebensverhältnissen, in denen der
Massenmensch unter unausgesetztem Hochdruck arbeitet,
und wo die Zersplitterung eine ruhige Einkehr, ein „Ver-
weilen im Gefühl des Augenblickes" (diese erste Vor-
bedingung des freien künstlerischen Geniessens) unmöglich
macht, ist es gar kein Wunder, dass die Welt sich „anders
als sonst in Menschenköpfen" im Kopf des Künstlers malt!
In gesunden Zeiten war es nicht so. Da gab es eine natür-
liche Brücke des Verständnisses zwischen beiden Theilen,
denn beide hatten Müsse und Gelegenheit, „beschaulich"
zu sein. Heute aber brauchen die meisten wirklich ihre
Augen ganz nothwendig, wie Morelli ironisch meint, um
nicht gegen die Wand zu rennen! Das ist ein herbes,
aber wahres Wort. Weil das innere Auge nicht Zeit hat,
den Wundern der Natur etwas zu erfassen, gehen
Tausende wie Blinde an
ihren Schönheiten vorüber.
Diese Wunder und Herrlich-
keiten in sich aufzunehmen
und den Mitmenschen zum
Bewusstsein zu bringen, ist
Künstlers Beruf; ihm beim
Publicum an die Hand zu
gehen, der des Kritikers.
Die bildende Kunst ist
eine Sprache, die erlernt wer-
den muss, denn auch die Er-
kenntnis des Grossen und
Ewigen in der Kunst wie im
Leben will erworben sein,
damit man sie besitze.
Der Weg ist weit, aber
nicht hoffnungslos! Es gilt,
zunächst die Aufnahmefähigkeit für echte Kunst zu wecken,
das Empfinden, nicht den „Verstand". Das ist der wesent-
liche Punkt. Alfred Lichtwark, dem wir bisher die meiste
Anregung in Fragen der Kunsterziehung verdanken und
dessen Schriften („Wege und Ziele des Dilettantismus",
„Makartbouquet und Blumenstrauss" etc.) allgemein ver-
ständlich sind und daher von Kunstfreunden nicht häufig
genug gelesen werden können, sagt: „Wie wenig die Ein-
sicht vorhanden ist, dass beim Schaffen und Geniessen (das
ja wesentlich Nachschaffen ist) die Kraft der Empfindung
den Ausschlag gibt und nicht die des Verstandes, geht aus
unserer Sprachgewohnheit deutlich genug hervor. Wir
nennen Kunstverständnis, was eigentlich Kunstempfindung
heissen sollte, und es ist bezeichnend, dass die Verurtheilung
irgend einer neuen Erscheinung in der bildenden Kunst
am liebsten mit der Formel eingeleitet wird: Ich verstehe
nicht, ich kann nicht begreifen . . ."
„Begreifen!" — Die Kunst ist nicht greifbar mit dem
Verstand, nur mit den inneren Sinnen, mit dem Gefühl.
Dieses bedarf umsomehr noch der Ausbildung, als wir in
der Sprache der bildenden Kunst nicht einmal ein Aqui-
valentfür das Wort „unmusikalisch" haben! „Unmalerisch"
drückt etwas ganz anderes aus, bezieht sich auf einen äus-
seren Eindruck, nicht auf eine mangelnde innere Anlage,
die weit häufiger in der Unempfänglichkeit für Form und
Farbe, als für musikalische Eindrücke bemerkbar ist.
Mehr als zuvor wird es künftig der Beruf des Kritikers
sein,das grosse Publicum für die Ereignisse der künstlerischen
Zeitgeschichte zu interessieren und mit ihren bedeutendsten
9