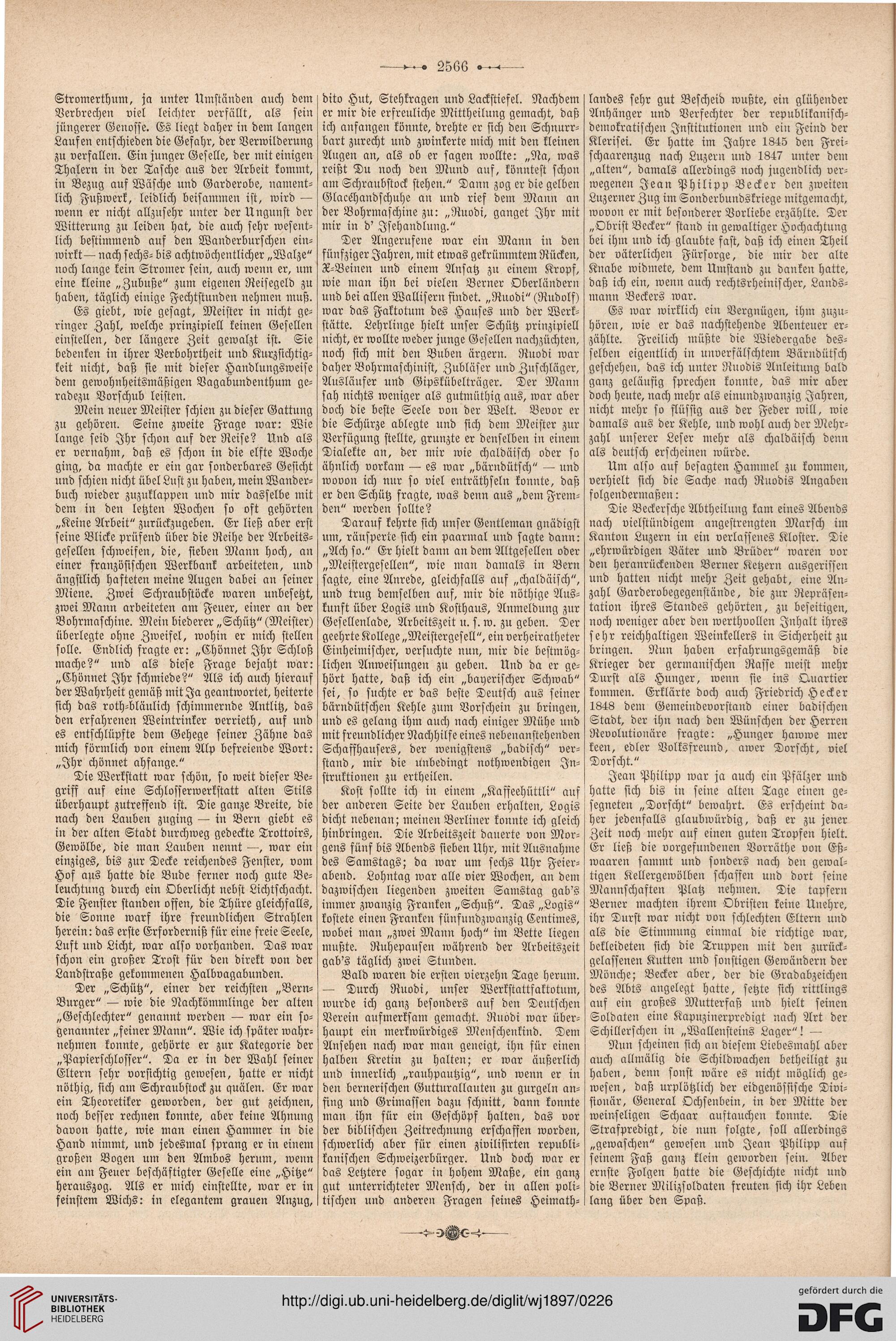Stromerthum, ja unter Umständen auch dem
Verbrechen viel leichter verfällt, als sein
jüngerer Genosse. Es liegt daher in dem langen
Laufen entschieden die Gefahr, der Verwilderung
zu verfallen. Ein junger Geselle, der mit einigen
Thalern in der Tasche aus der Arbeit kommt,
in Bezug auf Wäsche und Garderobe, nament-
lich Fußwerk, leidlich beisammen ist, wird —
wenn er nicht allzusehr unter der Ungunst der
Witterung zu leiden hat, die auch sehr wesent-
lich bestimmend auf den Wanderburschen ein-
wirkt— nach sechs- bis achtwöchentlicher „Walze"
noch lange kein Stromer sein, auch wenn er, nm
eine kleine „Zubuße" zum eigenen Reisegeld zu
haben, täglich einige Fechtstunden nehmen muß.
Es giebt, wie gesagt, Meister in nicht ge-
ringer Zahl, welche prinzipiell keinen Gesellen
einstellen, der längere Zeit gewalzt ist. Sie
bedenken in ihrer Verbohrtheit und Kurzsichtig-
keit nicht, daß sie mit dieser Handlungsweise
dem gewohnheitsmäßigen Vagabundenthum ge-
radezu Vorschub leisten.
Mein neuer Meister schien zu dieser Gattung
zu gehören. Seine zweite Frage war: Wie
lange seid Ihr schon auf der Reise? Und als
er vernahm, daß es schon in die elfte Woche
ging, da machte er ein gar sonderbares Gesicht
und schien nicht Übel Lust zu haben, mein Wander-
buch wieder zuzuklappen und mir dasselbe mit
dem in den letzten Wochen so oft gehörten
„Keine Arbeit" zurückzugeben. Er ließ aber erst
seine Blicke prüfend über die Reihe der Arbeits-
gesellen schweifen, die, sieben Mann hoch, an
einer französischen Werkbank arbeiteten, und
ängstlich hafteten meine Augen dabei an seiner
Miene. Zwei Schraubstöcke waren unbesetzt,
zwei Mann arbeiteten am Feuer, einer an der
Bohrmaschine. Mein biederer „Schütz" (Meister)
überlegte ohne Zweifel, wohin er mich stellen
solle. Endlich fragte er: „Chönnet Ihr Schloß
mache?" und als diese Frage bejaht wär:
„Chönnet Ihr schmiede?" Als ich auch hierauf
der Wahrheit gemäß mit Ja geantwortet, heiterte
sich das roth-bläulich schimmernde Antlitz, das
den erfahrenen Weintrinker verrieth, auf und
es entschlüpfte dem Gehege seiner Zähne das
mich förmlich von einem Alp befreiende Wort:
„Ihr chönnet ahfange."
Die Werkstatt war schön, so weit dieser Be-
griff auf eine Schlosserwerkstatt alten Stils
überhaupt zutreffend ist. Die ganze Breite, die
nach den Lauben zuging — in Bern giebt es
in der alten Stadt durchweg gedeckte Trottoirs,
Gewölbe, die man Lauben nennt —, war ein
einziges, bis zur Decke reichendes Fenster, vom
Hof aus hatte die Bude ferner noch gute Be-
leuchtung durch ein Oberlicht nebst Lichtschacht.
Die Fenster standen offen, die Thüre gleichfalls,
die Sonne warf ihre freundlichen Strahlen
herein: das erste Erforderniß für eine freie Seele,
Luft und Licht, war also vorhanden. Das war
schon ein großer Trost für den direkt von der
Landstraße gekommenen Halbvagabunden.
Der „Schütz", einer der reichsten „Bern-
Burger" — wie die Nachkömmlinge der alten
„Geschlechter" genannt werden — war ein so-
genannter „feiner Mann". Wie ich später wahr-
nehmen konnte, gehörte er zur Kategorie der
„Papierschlosser". Da er in der Wahl seiner
Eltern sehr vorsichtig gewesen, hatte er nicht
nöthig, sich am Schraubstock zu quälen. Er war
ein Theoretiker geworden, der gut zeichnen,
noch besser rechnen konnte, aber keine Ahnung
davon hatte, wie man einen Hammer in die
Hand nimmt, und jedesmal sprang er in einem
großen Bogen um den Ambos herum, wenn
ein am Feuer beschäftigter Geselle eine „Hitze"
herauszog. Als er mich einstellte, war er in
feinstem Wichs: in elegantem grauen Anzug,
-—- - - 2566 . -
dito Hut, Stehkragen und Lackstiefel. Nachdem
er mir die erfreuliche Mittheilung gemacht, daß
ich anfangen könnte, drehte er sich den Schnurr-
bart zurecht und zwinkerte mich mit den kleinen
Augen an, als ob er sagen wollte: „Na, was
reißt Du noch den Mund auf, könntest schon
am Schraubstock stehen." Dann zog er die gelben
Glacehandschuhe an und rief dem Mann an
der Bohrmaschine zu: „Ruodi, ganget Ihr mit
mir in d' Jsehandlung."
Der Angerufene war ein Mann in den
fünfziger Jahren, mit etwas gekrümmtem Rücken,
X-Beinen und einem Ansatz zu einem Kropf,
wie man ihn bei vielen Berner Oberländern
und bei allen Wallisern findet. „Ruodi" (Rudolf)
war das Faktotum des Hauses und der Werk-
stätte. Lehrlinge hielt unser Schütz prinzipiell
nicht, er wollte weder junge Gesellen nachzüchten,
noch sich mit den Buben ärgern. Ruodi war
daher Bohrmaschinist, Zubläser und Zuschläger,
Ausläufer und Gipskübeltrüger. Der Mann
sah nichts weniger als gutmüthig aus, war aber
doch die beste Seele von der Welt. Bevor er
die Schürze ablegte und sich dem Meister zur
Verfügung stellte, grunzte er denselben in einem
Dialekte an, der mir wie chaldäisch oder so
ähnlich vorkam — es war „bärndütsch" — und
wovon ich nur so viel enträthseln konnte, daß
er den Schütz fragte, was denn aus „dem Frem-
den" werden sollte?
Darauf kehrte sich unser Gentleman gnädigst
um, räusperte sich ein paarmal und sagte dann:
„Ach so." Er hielt dann an dem Altgesellen oder
„Meistergesellen", wie man damals in Bern
sagte, eine Anrede, gleichfalls auf „chaldäisch",
und trug demselben auf, mir die nöthige Aus-
kunft über Logis und Kosthaus, Anmeldung zur
Gesellenlade, Arbeitszeit u. s. w. zu geben. Der
geehrte Kollege „Meistergesell", ein verheiratheter
Einheimischer, versuchte nun, mir die bestmög-
lichen Anweisungen zu geben. Und da er ge-
hört hatte, daß ich ein „bayerischer Schwab"
sei, so suchte er das beste Deutsch ans seiner
bärndütschen Kehle zum Vorschein zu bringen,
und es gelang ihm auch nach einiger Mühe und
mit freundlicher Nachhilfe eines nebenanstehenden
Schaffhausers, der wenigstens „badisch" ver-
stand, mir die unbedingt nothwendigen In-
struktionen zu ertheilen.
Kost sollte ich in einem „Kafseehüttli" auf
der anderen Seite der Lauben erhalten, Logis
dicht nebenan; meinen Berliner konnte ich gleich
hinbringen. Die Arbeitszeit dauerte von Mor-
gens fünf bis Abends sieben Uhr, mit Ausnahme
des Samstags; da war um sechs Uhr Feier-
abend. Lohntag war alle vier Wochen, an dem
dazwischen liegenden zweiten Samstag gab's
immer zwanzig Franken „Schuß". Das „Logis"
kostete einen Franken fünfundzwanzig Centimes,
wobei man „zwei Mann hoch" im Bette liegen
mußte. Ruhepausen während der Arbeitszeit
gab's täglich zwei Stunden.
Bald waren die ersten vierzehn Tage herum.
— Durch Ruodi, unser Werkstattfaktotum,
wurde ich ganz besonders auf den Deutschen
Verein aufmerksam gemacht. Ruodi war über-
haupt ein merkwürdiges Menschenkind. Dem
Ansehen nach war man geneigt, ihn für einen
halben Kretin zu halten; er war äußerlich
und innerlich „rauhpautzig", und wenn er in
den bernerischen Gutturallauten zu gurgeln an-
fing und Grimassen dazu schnitt, dann konnte
man ihn für ein Geschöpf halten, das vor
der biblischen Zeitrechnung erschaffen worden,
schwerlich aber für einen zivilisirten republi-
kanischen Schweizerbürger. Und doch war er
das Letztere sogar in hohem Maße, ein ganz
gut unterrichteter Mensch, der in allen poli-
tischen und anderen Fragen seines Heimath-
landes sehr gut Bescheid wußte, ein glühender
Anhänger und Verfechter der republikanisch-
demokratischen Institutionen und ein Feind der
Klerisei. Er hatte im Jahre 1845 den Frei-
schaarenzug nach Luzern und 1847 unter dem
„alten", damals allerdings noch jugendlich ver-
wegenen Jean Philipp Becker den zweiten
Luzerner Zug im Sonderbundskriege mitgemacht,
wovon er mit besonderer Vorliebe erzählte. Der
„Obrist Becker" stand in gewaltiger Hochachtung
bei ihm und ich glaubte fast, daß ich einen Theil
der väterlichen Fürsorge, die mir der alte
Knabe widmete, dem Umstand zu danken hatte,
daß ich ein, wenn auch rechtsrheinischer, Lands-
mann Beckers war.
Es war wirklich ein Vergnügen, ihm zuzu-
hören, wie er das nachstehende Abenteuer er-
zählte. Freilich müßte die Wiedergabe des-
selben eigentlich in unverfälschtem Bärndütsch
geschehen, das ich unter Ruodis Anleitung bald
ganz geläufig sprechen konnte, das mir aber
doch heute, nach mehr als einundzwanzig Jahren,
nicht mehr so flüssig aus der Feder will, wie
damals aus der Kehle, und wohl auch der Mehr-
zahl unserer Leser mehr als chaldäisch denn
als deutsch erscheinen würde.
Um also auf besagten Hammel zu kommen,
verhielt sich die Sache nach Ruodis Angaben
folgendermaßen:
Die Beckersche Abtheilung kam eines Abends
nach vielstündigem angestrengten Marsch im
Kanton Luzern in ein verlassenes Kloster. Die
„ehrwürdigen Väter und Brüder" waren vor
den heranrückenden Berner Ketzern ausgerissen
und hatten nicht mehr Zeit gehabt, eine An-
zahl Garderobegegenstände, die zur Repräsen-
tation ihres Standes gehörten, zu beseitigen,
noch weniger aber den werthvollen Inhalt ihres
sehr reichhaltigen Weinkellers in Sicherheit zu
bringen. Nun haben erfahrungsgemäß die
Krieger der germanischen Rasse meist mehr
Durst als Hunger, wenn sie ins Quartier
kommen. Erklärte doch auch Friedrich Hecker
1848 dem Gemeindevorstand einer badischen
Stadt, der ihn nach den Wünschen der Herren
Revolutionäre fragte: „Hunger hawwe mer
keen, edler Volksfreund, awer Dorscht, viel
Dorscht."
Jean Philipp war ja auch ein Pfälzer und
hatte sich bis in seine alten Tage einen ge-
segneten „Dorscht" bewahrt. Es erscheint da-
her jedenfalls glaubwürdig, daß er zu jener
Zeit noch mehr auf einen guten Tropfen hielt.
Er ließ die vorgefundenen Vorräthe von Eß-
waaren sammt und sonders nach den gewal-
tigen Kellergewölben schaffen und dort seine
Mannschaften Platz nehmen. Die tapfer»
Berner machten ihrem Obristen keine Unehre,
ihr Durst war nicht von schlechten Eltern und
als die Stimmung einmal die richtige war,
bekleideten sich die Truppen mit den zurück-
gelassenen Kutten und sonstigen Gewändern der
Mönche; Becker aber, der die Gradabzeichen
des Abts angelegt hatte, setzte sich rittlings
auf ein großes Mutterfaß und hielt seinen
Soldaten eine Kapuzinerpredigt nach Art der
Schillerschen in „Wallensteins Lager"! —
Nun scheinen sich an diesem Liebesmahl aber
auch allmälig die Schildwachen betheiligt zu
haben, denn sonst wäre es nicht möglich ge-
wesen, daß urplötzlich der eidgenössische Divi-
sionär, General Ochsenbein, in der Mitte der
weinseligen Schaar auftauchen konnte. Die
Strafpredigt, die nun folgte, soll allerdings
„gewaschen" gewesen und Jean Philipp auf
seinem Faß ganz klein geworden sein. Aber
ernste Folgen hatte die Geschichte nicht und
die Berner Milizsoldaten freuten sich ihr Leben
lang über den Spaß.
Verbrechen viel leichter verfällt, als sein
jüngerer Genosse. Es liegt daher in dem langen
Laufen entschieden die Gefahr, der Verwilderung
zu verfallen. Ein junger Geselle, der mit einigen
Thalern in der Tasche aus der Arbeit kommt,
in Bezug auf Wäsche und Garderobe, nament-
lich Fußwerk, leidlich beisammen ist, wird —
wenn er nicht allzusehr unter der Ungunst der
Witterung zu leiden hat, die auch sehr wesent-
lich bestimmend auf den Wanderburschen ein-
wirkt— nach sechs- bis achtwöchentlicher „Walze"
noch lange kein Stromer sein, auch wenn er, nm
eine kleine „Zubuße" zum eigenen Reisegeld zu
haben, täglich einige Fechtstunden nehmen muß.
Es giebt, wie gesagt, Meister in nicht ge-
ringer Zahl, welche prinzipiell keinen Gesellen
einstellen, der längere Zeit gewalzt ist. Sie
bedenken in ihrer Verbohrtheit und Kurzsichtig-
keit nicht, daß sie mit dieser Handlungsweise
dem gewohnheitsmäßigen Vagabundenthum ge-
radezu Vorschub leisten.
Mein neuer Meister schien zu dieser Gattung
zu gehören. Seine zweite Frage war: Wie
lange seid Ihr schon auf der Reise? Und als
er vernahm, daß es schon in die elfte Woche
ging, da machte er ein gar sonderbares Gesicht
und schien nicht Übel Lust zu haben, mein Wander-
buch wieder zuzuklappen und mir dasselbe mit
dem in den letzten Wochen so oft gehörten
„Keine Arbeit" zurückzugeben. Er ließ aber erst
seine Blicke prüfend über die Reihe der Arbeits-
gesellen schweifen, die, sieben Mann hoch, an
einer französischen Werkbank arbeiteten, und
ängstlich hafteten meine Augen dabei an seiner
Miene. Zwei Schraubstöcke waren unbesetzt,
zwei Mann arbeiteten am Feuer, einer an der
Bohrmaschine. Mein biederer „Schütz" (Meister)
überlegte ohne Zweifel, wohin er mich stellen
solle. Endlich fragte er: „Chönnet Ihr Schloß
mache?" und als diese Frage bejaht wär:
„Chönnet Ihr schmiede?" Als ich auch hierauf
der Wahrheit gemäß mit Ja geantwortet, heiterte
sich das roth-bläulich schimmernde Antlitz, das
den erfahrenen Weintrinker verrieth, auf und
es entschlüpfte dem Gehege seiner Zähne das
mich förmlich von einem Alp befreiende Wort:
„Ihr chönnet ahfange."
Die Werkstatt war schön, so weit dieser Be-
griff auf eine Schlosserwerkstatt alten Stils
überhaupt zutreffend ist. Die ganze Breite, die
nach den Lauben zuging — in Bern giebt es
in der alten Stadt durchweg gedeckte Trottoirs,
Gewölbe, die man Lauben nennt —, war ein
einziges, bis zur Decke reichendes Fenster, vom
Hof aus hatte die Bude ferner noch gute Be-
leuchtung durch ein Oberlicht nebst Lichtschacht.
Die Fenster standen offen, die Thüre gleichfalls,
die Sonne warf ihre freundlichen Strahlen
herein: das erste Erforderniß für eine freie Seele,
Luft und Licht, war also vorhanden. Das war
schon ein großer Trost für den direkt von der
Landstraße gekommenen Halbvagabunden.
Der „Schütz", einer der reichsten „Bern-
Burger" — wie die Nachkömmlinge der alten
„Geschlechter" genannt werden — war ein so-
genannter „feiner Mann". Wie ich später wahr-
nehmen konnte, gehörte er zur Kategorie der
„Papierschlosser". Da er in der Wahl seiner
Eltern sehr vorsichtig gewesen, hatte er nicht
nöthig, sich am Schraubstock zu quälen. Er war
ein Theoretiker geworden, der gut zeichnen,
noch besser rechnen konnte, aber keine Ahnung
davon hatte, wie man einen Hammer in die
Hand nimmt, und jedesmal sprang er in einem
großen Bogen um den Ambos herum, wenn
ein am Feuer beschäftigter Geselle eine „Hitze"
herauszog. Als er mich einstellte, war er in
feinstem Wichs: in elegantem grauen Anzug,
-—- - - 2566 . -
dito Hut, Stehkragen und Lackstiefel. Nachdem
er mir die erfreuliche Mittheilung gemacht, daß
ich anfangen könnte, drehte er sich den Schnurr-
bart zurecht und zwinkerte mich mit den kleinen
Augen an, als ob er sagen wollte: „Na, was
reißt Du noch den Mund auf, könntest schon
am Schraubstock stehen." Dann zog er die gelben
Glacehandschuhe an und rief dem Mann an
der Bohrmaschine zu: „Ruodi, ganget Ihr mit
mir in d' Jsehandlung."
Der Angerufene war ein Mann in den
fünfziger Jahren, mit etwas gekrümmtem Rücken,
X-Beinen und einem Ansatz zu einem Kropf,
wie man ihn bei vielen Berner Oberländern
und bei allen Wallisern findet. „Ruodi" (Rudolf)
war das Faktotum des Hauses und der Werk-
stätte. Lehrlinge hielt unser Schütz prinzipiell
nicht, er wollte weder junge Gesellen nachzüchten,
noch sich mit den Buben ärgern. Ruodi war
daher Bohrmaschinist, Zubläser und Zuschläger,
Ausläufer und Gipskübeltrüger. Der Mann
sah nichts weniger als gutmüthig aus, war aber
doch die beste Seele von der Welt. Bevor er
die Schürze ablegte und sich dem Meister zur
Verfügung stellte, grunzte er denselben in einem
Dialekte an, der mir wie chaldäisch oder so
ähnlich vorkam — es war „bärndütsch" — und
wovon ich nur so viel enträthseln konnte, daß
er den Schütz fragte, was denn aus „dem Frem-
den" werden sollte?
Darauf kehrte sich unser Gentleman gnädigst
um, räusperte sich ein paarmal und sagte dann:
„Ach so." Er hielt dann an dem Altgesellen oder
„Meistergesellen", wie man damals in Bern
sagte, eine Anrede, gleichfalls auf „chaldäisch",
und trug demselben auf, mir die nöthige Aus-
kunft über Logis und Kosthaus, Anmeldung zur
Gesellenlade, Arbeitszeit u. s. w. zu geben. Der
geehrte Kollege „Meistergesell", ein verheiratheter
Einheimischer, versuchte nun, mir die bestmög-
lichen Anweisungen zu geben. Und da er ge-
hört hatte, daß ich ein „bayerischer Schwab"
sei, so suchte er das beste Deutsch ans seiner
bärndütschen Kehle zum Vorschein zu bringen,
und es gelang ihm auch nach einiger Mühe und
mit freundlicher Nachhilfe eines nebenanstehenden
Schaffhausers, der wenigstens „badisch" ver-
stand, mir die unbedingt nothwendigen In-
struktionen zu ertheilen.
Kost sollte ich in einem „Kafseehüttli" auf
der anderen Seite der Lauben erhalten, Logis
dicht nebenan; meinen Berliner konnte ich gleich
hinbringen. Die Arbeitszeit dauerte von Mor-
gens fünf bis Abends sieben Uhr, mit Ausnahme
des Samstags; da war um sechs Uhr Feier-
abend. Lohntag war alle vier Wochen, an dem
dazwischen liegenden zweiten Samstag gab's
immer zwanzig Franken „Schuß". Das „Logis"
kostete einen Franken fünfundzwanzig Centimes,
wobei man „zwei Mann hoch" im Bette liegen
mußte. Ruhepausen während der Arbeitszeit
gab's täglich zwei Stunden.
Bald waren die ersten vierzehn Tage herum.
— Durch Ruodi, unser Werkstattfaktotum,
wurde ich ganz besonders auf den Deutschen
Verein aufmerksam gemacht. Ruodi war über-
haupt ein merkwürdiges Menschenkind. Dem
Ansehen nach war man geneigt, ihn für einen
halben Kretin zu halten; er war äußerlich
und innerlich „rauhpautzig", und wenn er in
den bernerischen Gutturallauten zu gurgeln an-
fing und Grimassen dazu schnitt, dann konnte
man ihn für ein Geschöpf halten, das vor
der biblischen Zeitrechnung erschaffen worden,
schwerlich aber für einen zivilisirten republi-
kanischen Schweizerbürger. Und doch war er
das Letztere sogar in hohem Maße, ein ganz
gut unterrichteter Mensch, der in allen poli-
tischen und anderen Fragen seines Heimath-
landes sehr gut Bescheid wußte, ein glühender
Anhänger und Verfechter der republikanisch-
demokratischen Institutionen und ein Feind der
Klerisei. Er hatte im Jahre 1845 den Frei-
schaarenzug nach Luzern und 1847 unter dem
„alten", damals allerdings noch jugendlich ver-
wegenen Jean Philipp Becker den zweiten
Luzerner Zug im Sonderbundskriege mitgemacht,
wovon er mit besonderer Vorliebe erzählte. Der
„Obrist Becker" stand in gewaltiger Hochachtung
bei ihm und ich glaubte fast, daß ich einen Theil
der väterlichen Fürsorge, die mir der alte
Knabe widmete, dem Umstand zu danken hatte,
daß ich ein, wenn auch rechtsrheinischer, Lands-
mann Beckers war.
Es war wirklich ein Vergnügen, ihm zuzu-
hören, wie er das nachstehende Abenteuer er-
zählte. Freilich müßte die Wiedergabe des-
selben eigentlich in unverfälschtem Bärndütsch
geschehen, das ich unter Ruodis Anleitung bald
ganz geläufig sprechen konnte, das mir aber
doch heute, nach mehr als einundzwanzig Jahren,
nicht mehr so flüssig aus der Feder will, wie
damals aus der Kehle, und wohl auch der Mehr-
zahl unserer Leser mehr als chaldäisch denn
als deutsch erscheinen würde.
Um also auf besagten Hammel zu kommen,
verhielt sich die Sache nach Ruodis Angaben
folgendermaßen:
Die Beckersche Abtheilung kam eines Abends
nach vielstündigem angestrengten Marsch im
Kanton Luzern in ein verlassenes Kloster. Die
„ehrwürdigen Väter und Brüder" waren vor
den heranrückenden Berner Ketzern ausgerissen
und hatten nicht mehr Zeit gehabt, eine An-
zahl Garderobegegenstände, die zur Repräsen-
tation ihres Standes gehörten, zu beseitigen,
noch weniger aber den werthvollen Inhalt ihres
sehr reichhaltigen Weinkellers in Sicherheit zu
bringen. Nun haben erfahrungsgemäß die
Krieger der germanischen Rasse meist mehr
Durst als Hunger, wenn sie ins Quartier
kommen. Erklärte doch auch Friedrich Hecker
1848 dem Gemeindevorstand einer badischen
Stadt, der ihn nach den Wünschen der Herren
Revolutionäre fragte: „Hunger hawwe mer
keen, edler Volksfreund, awer Dorscht, viel
Dorscht."
Jean Philipp war ja auch ein Pfälzer und
hatte sich bis in seine alten Tage einen ge-
segneten „Dorscht" bewahrt. Es erscheint da-
her jedenfalls glaubwürdig, daß er zu jener
Zeit noch mehr auf einen guten Tropfen hielt.
Er ließ die vorgefundenen Vorräthe von Eß-
waaren sammt und sonders nach den gewal-
tigen Kellergewölben schaffen und dort seine
Mannschaften Platz nehmen. Die tapfer»
Berner machten ihrem Obristen keine Unehre,
ihr Durst war nicht von schlechten Eltern und
als die Stimmung einmal die richtige war,
bekleideten sich die Truppen mit den zurück-
gelassenen Kutten und sonstigen Gewändern der
Mönche; Becker aber, der die Gradabzeichen
des Abts angelegt hatte, setzte sich rittlings
auf ein großes Mutterfaß und hielt seinen
Soldaten eine Kapuzinerpredigt nach Art der
Schillerschen in „Wallensteins Lager"! —
Nun scheinen sich an diesem Liebesmahl aber
auch allmälig die Schildwachen betheiligt zu
haben, denn sonst wäre es nicht möglich ge-
wesen, daß urplötzlich der eidgenössische Divi-
sionär, General Ochsenbein, in der Mitte der
weinseligen Schaar auftauchen konnte. Die
Strafpredigt, die nun folgte, soll allerdings
„gewaschen" gewesen und Jean Philipp auf
seinem Faß ganz klein geworden sein. Aber
ernste Folgen hatte die Geschichte nicht und
die Berner Milizsoldaten freuten sich ihr Leben
lang über den Spaß.