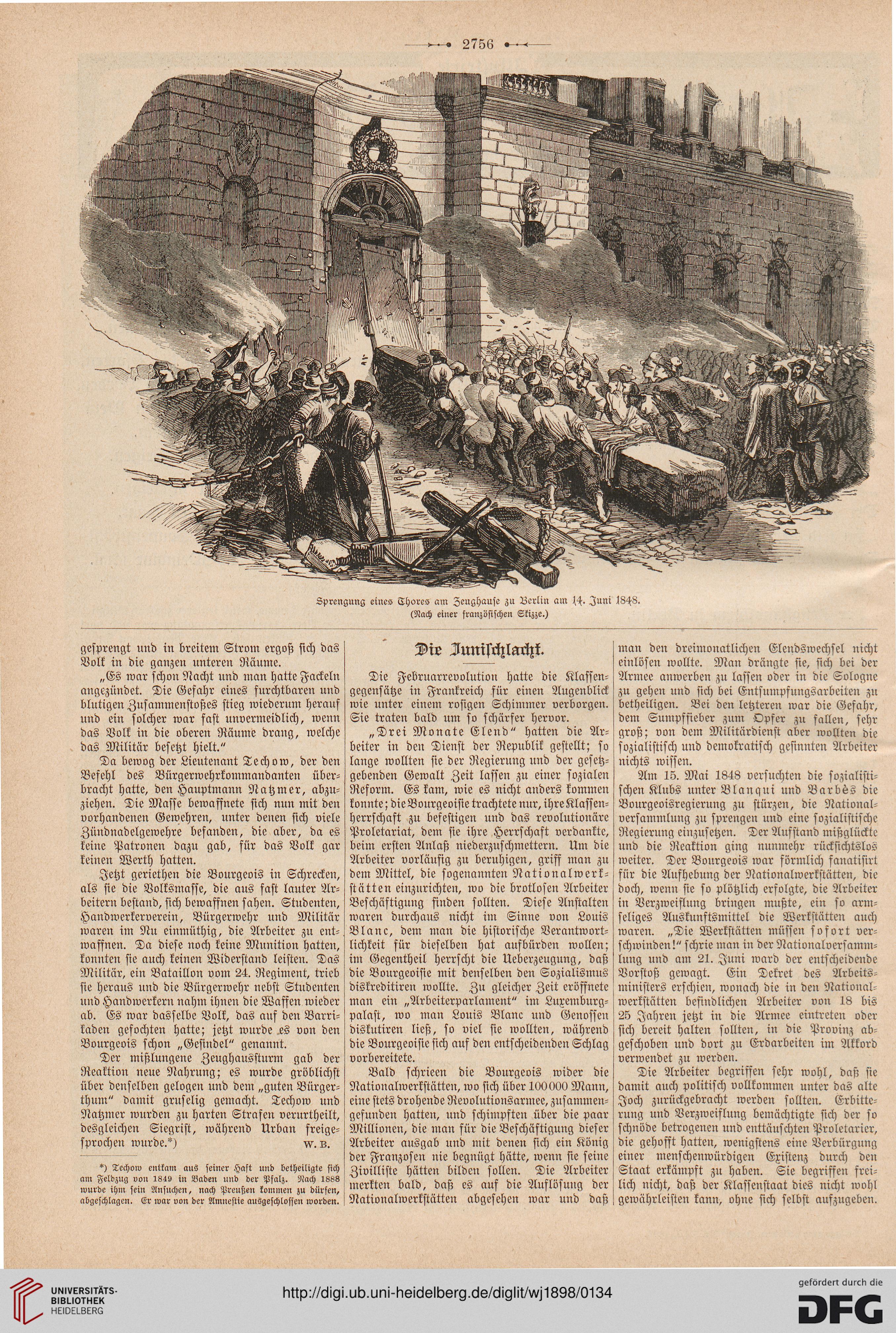2756
Sprengung eines Chores am Zenghause zn Berlin am J,4. Juni !848.
(Nach einer französischen Skizze.)
gesprengt und in breitem Strom ergoß sich dos
Volk in die ganzen unteren Räume.
„Es mar schon Nacht und man hatte Fackeln
angezündet. Die Gefahr eines furchtbaren und
blutigen Zusammenstoßes stieg wiederum herauf
und ein solcher war fast unvermeidlich, wenn
das Volk in die oberen Räume drang, welche
das Militär besetzt hielt."
Da bewog der Lieutenant Techow, der den
Befehl des Bürgerwehrkommandanten über-
bracht hatte, den Hauptmann Natzmer, abzu-
ziehen. Die Masse bewaffnete sich nun mit den
vorhandenen Gewehren, unter denen sich viele
Zündnadelgcwehre befanden, die aber, da es
keine Patronen dazu gab, für das Volk gar
keinen Werth hatten.
Jetzt geriethen die Bourgeois in Schrecken,
als sie die Volksmasse, die aus fast lauter Ar-
beitern bestand, sich bewaffnen sahen. Studenten,
Handwerkerverein, Bürgerwehr und Militär
waren im Nu einmüthig, die Arbeiter zu ent-
waffnen. Da diese noch keine Munition hatten,
konnten sie auch keinen Widerstand leisten. Das
Militär, ein Bataillon vom 24. Regiment, trieb
sie heraus und die Bürgerwehr nebst Studenten
unb Handwerkern nahm ihnen die Waffen wieder
ab. Es war dasselbe Volk, das auf den Barri-
kaden gefachten hatte; jetzt wurde £§ von den
Bourgeois schon „Gesindel" genannt.
Der mißlungene Zeughaussturm gab der
Reaktion neue Nahrung; es wurde gröblichst
über denselben gelogen und dem „guten Bürger-
thum" damit gruselig gemacht. Techow und
Natzmer wurden zu harten Strafen verurtheilt,
desgleichen Siegrist, während Urban freige-
sprochen wurde?) w. b.
*) Techow entkam aus seiner Haft und betheiligte sich
am Feldzug von 1849 in Baden und der Pfalz. Nach 1888
wurde ihm sein Ansuchen, nach Preußen kommen zu dürfen,
abgeschlagen. Er war von der Amnestie ausgeschlossen worden.
Dir Iunischlscht.
Die Februarrevolution hatte die Klassen-
gegensätze in Frankreich für einen Augenblick
wie unter einem rosigen Schimmer verborgen.
Sie traten bald um so schärfer hervor.
„Drei Monate Elend" hatten die Ar-
beiter in den Dienst der Republik gestellt; so
lange wollten sie der Regierung und der gesetz-
gebenden Gewalt Zeit lassen zu einer sozialen
Reform. Es kam, wie es nicht anders kommen
konnte; die Bourgeoisie trachtete nur, ihre Klassen-
herrschaft zu befestigen und das revolutionäre
Proletariat, dem sie ihre Herrschaft verdankte,
beim ersten Anlaß niederzuschmettern. Um die
Arbeiter vorläufig zu beruhigen, griff man zu
dem Mittel, die sogenannten Nationalwerk-
stätten einzurichten, wo die brotlosen Arbeiter
Beschäftigung finden sollten. Diese Anstalten
waren durchaus nicht im Sinne von Louis
Blanc, dem man die historische Verantwort-
lichkeit für dieselben hat aufbürden wollen;
im Gegentheil herrscht die Ueberzeugung, daß
die Bourgeoisie mit denselben den Sozialismus
diskreditiren wollte. Zu gleicher Zeit eröffnete
man ein „Arbeiterparlament" im Luxemburg-
palast, wo man Louis Blanc und Genossen
diskutiren ließ, so viel sie wollten, während
die Bourgeoisie sich auf den entscheidenden Schlag
vorbereitete.
Bald schrieen die Bourgeois wider die
Nationalwerkstätten, wo sich über 100000 Mann,
eine stets drohende Revolutionsarmee, zusammen-
gefunden hatten, und schimpften über die paar
Millionen, die man für die Beschäftigung dieser
Arbeiter ausgab und mit denen sich ein König
der Franzosen nie begnügt hätte, wenn sie seine
Zivilliste hätten bilden sollen. Die Arbeiter
merkten bald, daß es auf die Auflösung der
Nationalwerkstätten abgesehen war und daß
man den dreimonatlichen Elendswechsel nicht
einlösen wollte. Man drängte sie, sich bei der
Armee anwerben zu lassen oder in die Sologne
zu gehen und sich bei Entsumpfungsarbeiten zn
betheiligen. Bei den letzteren war die Gefahr,
dem Sumpffieber zum Opfer zu fallen, sehr
groß; von dem Militärdienst aber wollten die
sozialistisch und demokratisch gesinnten Arbeiter
nichts wissen.
Am 15. Mai 1848 versuchten die sozialisti-
schen Klubs unter Blanqui und Barbös die
Bourgeoisregierung zu stürzen, die National-
versammlung zu sprengen und eine sozialistische
Regierung einzusetzen. Der Aufstand mißglückte
und die Reaktion ging nunmehr rücksichtslos
weiter. Der Bourgeois war förmlich fanatisirt
für die Aufhebung der Nationalwerkstätten, die
doch, wenn sie so plötzlich erfolgte, die Arbeiter
in Verzweiflung bringen mußte, ein so arm-
seliges Auskunftsmittel die Werkstätten auch
waren. „Die Werkstätten müssen sofort ver-
schwinden!" schrie man in der Nationalversamm-
lung und am 21. Juni ward der entscheidende
Vorstoß gewagt. Ein Dekret des Arbeits-
ministers erschien, wonach die in den National-
werkstätten befindlichen Arbeiter von 18 bis
25 Jahren jetzt in die Armee eintreten oder
sich bereit halten sollten, in die Provinz ab-
geschoben und dort zu Erdarbeiten im Akkord
verwendet zu werden.
Die Arbeiter begriffen sehr wohl, daß sie
damit auch politisch vollkommen unter das alte
Joch zurückgebracht werden sollten. Erbitte-
rung und Verzweiflung bemächtigte sich der so
schnöde betrogenen und enttäuschten Proletarier,
die gehofft hatten, wenigstens eine Verbürgung
einer menschenwürdigen Existenz durch den
Staat erkämpft zu haben. Sie begriffen frei-
lich nicht, daß der Klassenstaat dies nicht wohl
gewährleisten kann, ohne sich selbst aufzugeben.
Sprengung eines Chores am Zenghause zn Berlin am J,4. Juni !848.
(Nach einer französischen Skizze.)
gesprengt und in breitem Strom ergoß sich dos
Volk in die ganzen unteren Räume.
„Es mar schon Nacht und man hatte Fackeln
angezündet. Die Gefahr eines furchtbaren und
blutigen Zusammenstoßes stieg wiederum herauf
und ein solcher war fast unvermeidlich, wenn
das Volk in die oberen Räume drang, welche
das Militär besetzt hielt."
Da bewog der Lieutenant Techow, der den
Befehl des Bürgerwehrkommandanten über-
bracht hatte, den Hauptmann Natzmer, abzu-
ziehen. Die Masse bewaffnete sich nun mit den
vorhandenen Gewehren, unter denen sich viele
Zündnadelgcwehre befanden, die aber, da es
keine Patronen dazu gab, für das Volk gar
keinen Werth hatten.
Jetzt geriethen die Bourgeois in Schrecken,
als sie die Volksmasse, die aus fast lauter Ar-
beitern bestand, sich bewaffnen sahen. Studenten,
Handwerkerverein, Bürgerwehr und Militär
waren im Nu einmüthig, die Arbeiter zu ent-
waffnen. Da diese noch keine Munition hatten,
konnten sie auch keinen Widerstand leisten. Das
Militär, ein Bataillon vom 24. Regiment, trieb
sie heraus und die Bürgerwehr nebst Studenten
unb Handwerkern nahm ihnen die Waffen wieder
ab. Es war dasselbe Volk, das auf den Barri-
kaden gefachten hatte; jetzt wurde £§ von den
Bourgeois schon „Gesindel" genannt.
Der mißlungene Zeughaussturm gab der
Reaktion neue Nahrung; es wurde gröblichst
über denselben gelogen und dem „guten Bürger-
thum" damit gruselig gemacht. Techow und
Natzmer wurden zu harten Strafen verurtheilt,
desgleichen Siegrist, während Urban freige-
sprochen wurde?) w. b.
*) Techow entkam aus seiner Haft und betheiligte sich
am Feldzug von 1849 in Baden und der Pfalz. Nach 1888
wurde ihm sein Ansuchen, nach Preußen kommen zu dürfen,
abgeschlagen. Er war von der Amnestie ausgeschlossen worden.
Dir Iunischlscht.
Die Februarrevolution hatte die Klassen-
gegensätze in Frankreich für einen Augenblick
wie unter einem rosigen Schimmer verborgen.
Sie traten bald um so schärfer hervor.
„Drei Monate Elend" hatten die Ar-
beiter in den Dienst der Republik gestellt; so
lange wollten sie der Regierung und der gesetz-
gebenden Gewalt Zeit lassen zu einer sozialen
Reform. Es kam, wie es nicht anders kommen
konnte; die Bourgeoisie trachtete nur, ihre Klassen-
herrschaft zu befestigen und das revolutionäre
Proletariat, dem sie ihre Herrschaft verdankte,
beim ersten Anlaß niederzuschmettern. Um die
Arbeiter vorläufig zu beruhigen, griff man zu
dem Mittel, die sogenannten Nationalwerk-
stätten einzurichten, wo die brotlosen Arbeiter
Beschäftigung finden sollten. Diese Anstalten
waren durchaus nicht im Sinne von Louis
Blanc, dem man die historische Verantwort-
lichkeit für dieselben hat aufbürden wollen;
im Gegentheil herrscht die Ueberzeugung, daß
die Bourgeoisie mit denselben den Sozialismus
diskreditiren wollte. Zu gleicher Zeit eröffnete
man ein „Arbeiterparlament" im Luxemburg-
palast, wo man Louis Blanc und Genossen
diskutiren ließ, so viel sie wollten, während
die Bourgeoisie sich auf den entscheidenden Schlag
vorbereitete.
Bald schrieen die Bourgeois wider die
Nationalwerkstätten, wo sich über 100000 Mann,
eine stets drohende Revolutionsarmee, zusammen-
gefunden hatten, und schimpften über die paar
Millionen, die man für die Beschäftigung dieser
Arbeiter ausgab und mit denen sich ein König
der Franzosen nie begnügt hätte, wenn sie seine
Zivilliste hätten bilden sollen. Die Arbeiter
merkten bald, daß es auf die Auflösung der
Nationalwerkstätten abgesehen war und daß
man den dreimonatlichen Elendswechsel nicht
einlösen wollte. Man drängte sie, sich bei der
Armee anwerben zu lassen oder in die Sologne
zu gehen und sich bei Entsumpfungsarbeiten zn
betheiligen. Bei den letzteren war die Gefahr,
dem Sumpffieber zum Opfer zu fallen, sehr
groß; von dem Militärdienst aber wollten die
sozialistisch und demokratisch gesinnten Arbeiter
nichts wissen.
Am 15. Mai 1848 versuchten die sozialisti-
schen Klubs unter Blanqui und Barbös die
Bourgeoisregierung zu stürzen, die National-
versammlung zu sprengen und eine sozialistische
Regierung einzusetzen. Der Aufstand mißglückte
und die Reaktion ging nunmehr rücksichtslos
weiter. Der Bourgeois war förmlich fanatisirt
für die Aufhebung der Nationalwerkstätten, die
doch, wenn sie so plötzlich erfolgte, die Arbeiter
in Verzweiflung bringen mußte, ein so arm-
seliges Auskunftsmittel die Werkstätten auch
waren. „Die Werkstätten müssen sofort ver-
schwinden!" schrie man in der Nationalversamm-
lung und am 21. Juni ward der entscheidende
Vorstoß gewagt. Ein Dekret des Arbeits-
ministers erschien, wonach die in den National-
werkstätten befindlichen Arbeiter von 18 bis
25 Jahren jetzt in die Armee eintreten oder
sich bereit halten sollten, in die Provinz ab-
geschoben und dort zu Erdarbeiten im Akkord
verwendet zu werden.
Die Arbeiter begriffen sehr wohl, daß sie
damit auch politisch vollkommen unter das alte
Joch zurückgebracht werden sollten. Erbitte-
rung und Verzweiflung bemächtigte sich der so
schnöde betrogenen und enttäuschten Proletarier,
die gehofft hatten, wenigstens eine Verbürgung
einer menschenwürdigen Existenz durch den
Staat erkämpft zu haben. Sie begriffen frei-
lich nicht, daß der Klassenstaat dies nicht wohl
gewährleisten kann, ohne sich selbst aufzugeben.