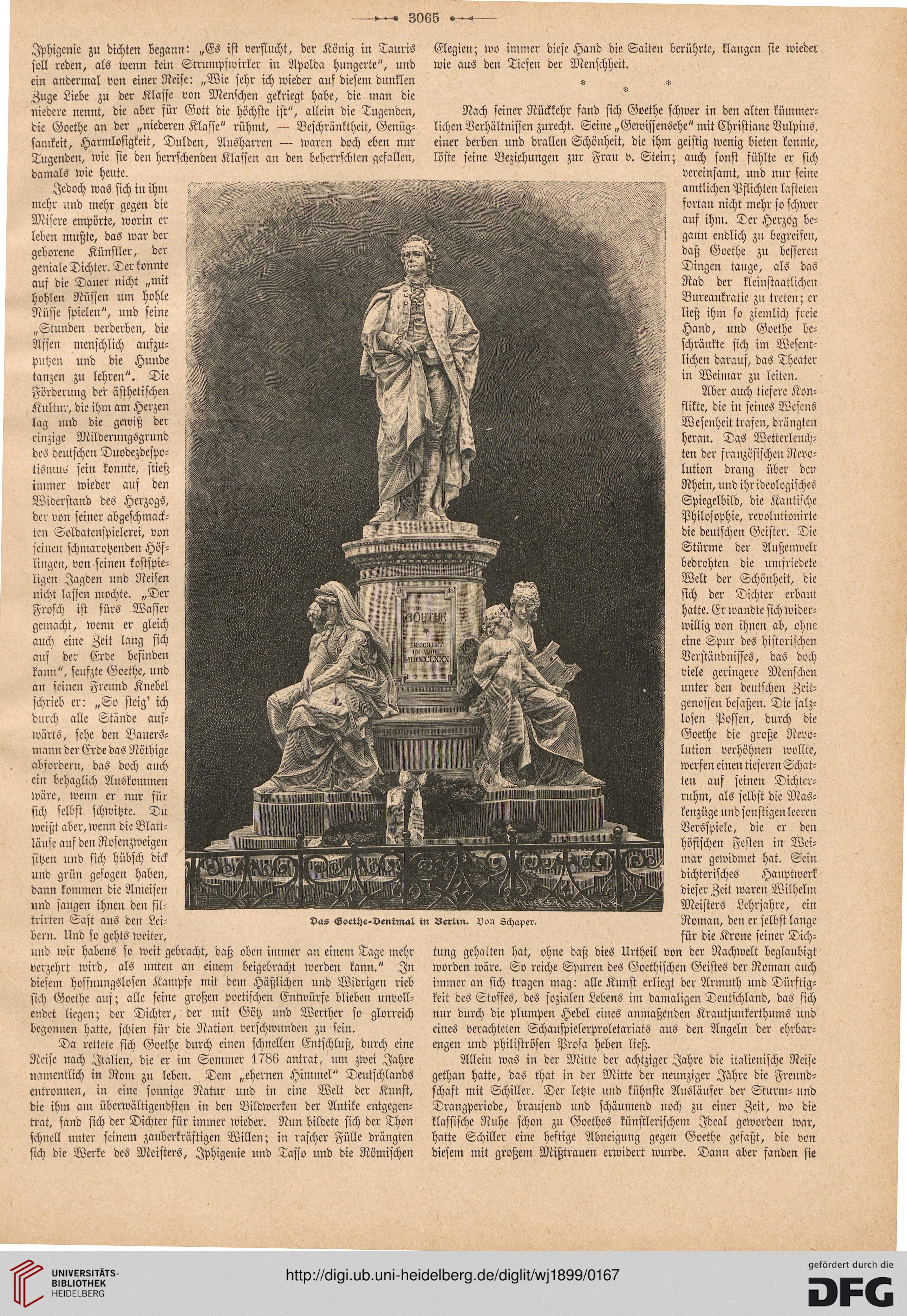3065
Iphigenie zu dichten begann: „Es ist verflucht, der König in Tauris
soll reden, als wenn kein Strumpfwirker in Apolda hungerte", und
ein andermal von einer Reise: „Wie sehr ich wieder auf diesem dunklen
Zuge Liebe zu der Klasse von Menschen gekriegt habe, die man die
niedere nennt, die aber für Gott die höchste ist", allein die Tugenden,
die Goethe an der „niederen Klasse" rühmt, — Beschränktheit, Genüg-
samkeit, Harmlosigkeit, Dulden, Ausharren — waren doch eben nur
Tugenden, wie sie den herrschenden Klassen an den beherrschten gefallen,
damals wie heute.
Jedoch was sich in ihm
mehr und mehr gegen die
Misere empörte, worin er
leben mußte, das war der
geborene Künstler, der
geniale Dichter. Der konnte
auf die Dauer nicht „mit
hohlen Nüssen um hohle
Nüsse spielen", und seine
„Stunden verderben, die
Affen menschlich aufzu-
puhen und die Hunde
tanzen zu lehren". Die
Förderung der ästhetischen
Kultur, die ihm am Herzen
lag und die gewiß der
einzige Milderungsgrund
des deutschen Duodezdespo-
tismus sein konnte, stieß
immer wieder auf den
Widerstand des Herzogs,
der von seiner abgeschmack-
tcn Soldatenspielerei, von
seinen schmarotzenden Höf-
lingen, von seinen kostspie-
ligen Jagden und Reisen
nicht lassen mochte. „Der
Frosch ist fürs Wasser
gemacht, wenn er gleich
auch eine Zeit lang sich
auf der Erde befinden
kann", seufzte Goethe, und
an seinen Freund Knebel
schrieb er: „So steig' ich
durch alle Stände auf-
ivärts, sehe den Bauers-
mann der Erde das Röthige
abfordern, das doch auch
ein behaglich Auskommen
tväre, wenn er nur für
sich selbst schwitzte. Du
tveißt aber, wenn die Blatt-
läuse auf den Rosenzweigen
sitzen und sich hübsch dick
und grün gesogen haben,
dann kommen die Ameisen
und saugen ihnen den fil-
trirten Saft aus den Lei-
bern. Und so gehts weiter,
und wir Habens so weit gebracht, daß oben irnmer an einem Tage mehr
verzehrt wird, als unten an einem beigebracht werden kann." In
diesem hoffnungslosen Kampfe mit dem Häßlichen und Widrigen rieb
sich Goethe auf; alle seine großen poetischen Entwürfe blieben unvoll-
endet liegen; der Dichter, der mit Götz und Werther so glorreich
begonnen hatte, schien für die Nation verschwunden zu sein.
Da rettete sich Goethe durch einen schnellen Entschluß, durch eine
Reise nach Italien, die er im Sommer 1786 antrat, um zwei Jahre
namentlich in Rom zu leben. Dem „ehernen Himmel" Deutschlands
entronnen, in eine sonnige Natur und in eine Welt der Kunst,
die ihm am überwältigendsten in den Bildwerken der Antike entgegen-
trat, fand sich der Dichter für immer wieder. Nun bildete sich der Thon
schnell unter seinem zauberkräftigen Willen; in rascher Fülle drängten
sich die Werke des Meisters, Iphigenie und Tassv und die Römischen
Elegien; wo immer diese Hand die Saiten berührte, klangen sie wieder
wie aus den Tiefen der Menschheit.
-i- *
*
Nach seiner Rückkehr fand sich Goethe schiver in den alten kümmer-
lichen Verhältnissen zurecht. Seine „Gewissensehe" mit Christiane Vulpius,
einer derben und drallen Schönheit, die ihm geistig wenig bieten konnte,
löste seine Beziehungen zur Frau v. Stein; auch sonst fühlte er sich
vereinsamt, und nur seine
amtlichen Pflichten lasteten
fortan nicht mehr so schwer
auf ihm. Der Herzog be-
gann endlich zu begreifen,
daß Goethe zu besseren
Dingen tauge, als das
Rad der kleinstaatlichen
Bureaukratie zu treten; er
ließ ihm so ziemlich freie
Hand, und Goethe be-
schränkte sich im Wesent-
lichen darauf, das Theater
in Weimar zu leiten.
Aber auch tiefere Kon-
flikte, die in seines Wesens
Wesenheit trafen, drängten
heran. Das Wetterleuch-
ten der französischen Revo-
lution drang über den
Rhein, und ihr ideologisches
Spiegelbild, die Kantische
Philosophie, revolutionirte
die deutschen Geister. Die
Stürme der Außenwelt
bedrohten die umfriedete
Welt der Schönheit, die
sich der Dichter erbaut
hatte. Er tvandte sich wider-
willig von ihnen ab, ohne
eine Spur des historischen
Verständnisses, das doch
viele geringere Menschen
unter den deutschen Zeit-
genossen besaßen. Die salz-
losen Possen, durch die
Goethe die große Revo-
lution verhöhnen wollte,
werfen einen tieferen Schat-
ten auf seinen Dichter-
ruhm, als selbst die MaS-
kenzüge und sonstigen leeren
Versspiele, die er den
höfischen Festen in Wei-
mar gewidmet hat. Sein
dichterisches Hauptwerk
dieser Zeit waren Wilhelm
Meisters Lehrjahre, ein
Roman, den er selbst lange
für die Krone seiner Dich-
tung gehalten hat, ohne daß dies Urtheil von der Nachwelt beglaubigt
worden wäre. So reiche Spuren des Goethischen Geistes der Roman auch
immer an sich tragen mag: alle Kunst erliegt der Armuth und Dürftig-
keit des Stoffes, des sozialen Lebens im damaligen Deutschland, das sich
nur durch die plumpen Hebel eines anmaßenden Krautjunkerthums und
eines verachteten Schauspielerproletariats ans den Angeln der ehrbar-
engen und philiströsen Prosa heben ließ.
Allein was in der Mitte der achtziger Jahre die italienische Reise
gethan hatte, das that in der Mitte der neunziger Jahre die Freund-
schaft mit Schiller. Der letzte und kühnste Ausläufer der Sturm- und
Drangperiode, brausend und schäumend noch zu einer Zeit, wo die
klassische Ruhe schon zu Goethes künstlerischem Ideal geworden war,
hatte Schiller eine heftige Abneigung gegen Goethe gefaßt, die von
diesem mit großem Mißtrauen erwidert wurde. Dann aber fanden sie
Das Goethe-Denkmal tn Berlin, von Schaper.
Iphigenie zu dichten begann: „Es ist verflucht, der König in Tauris
soll reden, als wenn kein Strumpfwirker in Apolda hungerte", und
ein andermal von einer Reise: „Wie sehr ich wieder auf diesem dunklen
Zuge Liebe zu der Klasse von Menschen gekriegt habe, die man die
niedere nennt, die aber für Gott die höchste ist", allein die Tugenden,
die Goethe an der „niederen Klasse" rühmt, — Beschränktheit, Genüg-
samkeit, Harmlosigkeit, Dulden, Ausharren — waren doch eben nur
Tugenden, wie sie den herrschenden Klassen an den beherrschten gefallen,
damals wie heute.
Jedoch was sich in ihm
mehr und mehr gegen die
Misere empörte, worin er
leben mußte, das war der
geborene Künstler, der
geniale Dichter. Der konnte
auf die Dauer nicht „mit
hohlen Nüssen um hohle
Nüsse spielen", und seine
„Stunden verderben, die
Affen menschlich aufzu-
puhen und die Hunde
tanzen zu lehren". Die
Förderung der ästhetischen
Kultur, die ihm am Herzen
lag und die gewiß der
einzige Milderungsgrund
des deutschen Duodezdespo-
tismus sein konnte, stieß
immer wieder auf den
Widerstand des Herzogs,
der von seiner abgeschmack-
tcn Soldatenspielerei, von
seinen schmarotzenden Höf-
lingen, von seinen kostspie-
ligen Jagden und Reisen
nicht lassen mochte. „Der
Frosch ist fürs Wasser
gemacht, wenn er gleich
auch eine Zeit lang sich
auf der Erde befinden
kann", seufzte Goethe, und
an seinen Freund Knebel
schrieb er: „So steig' ich
durch alle Stände auf-
ivärts, sehe den Bauers-
mann der Erde das Röthige
abfordern, das doch auch
ein behaglich Auskommen
tväre, wenn er nur für
sich selbst schwitzte. Du
tveißt aber, wenn die Blatt-
läuse auf den Rosenzweigen
sitzen und sich hübsch dick
und grün gesogen haben,
dann kommen die Ameisen
und saugen ihnen den fil-
trirten Saft aus den Lei-
bern. Und so gehts weiter,
und wir Habens so weit gebracht, daß oben irnmer an einem Tage mehr
verzehrt wird, als unten an einem beigebracht werden kann." In
diesem hoffnungslosen Kampfe mit dem Häßlichen und Widrigen rieb
sich Goethe auf; alle seine großen poetischen Entwürfe blieben unvoll-
endet liegen; der Dichter, der mit Götz und Werther so glorreich
begonnen hatte, schien für die Nation verschwunden zu sein.
Da rettete sich Goethe durch einen schnellen Entschluß, durch eine
Reise nach Italien, die er im Sommer 1786 antrat, um zwei Jahre
namentlich in Rom zu leben. Dem „ehernen Himmel" Deutschlands
entronnen, in eine sonnige Natur und in eine Welt der Kunst,
die ihm am überwältigendsten in den Bildwerken der Antike entgegen-
trat, fand sich der Dichter für immer wieder. Nun bildete sich der Thon
schnell unter seinem zauberkräftigen Willen; in rascher Fülle drängten
sich die Werke des Meisters, Iphigenie und Tassv und die Römischen
Elegien; wo immer diese Hand die Saiten berührte, klangen sie wieder
wie aus den Tiefen der Menschheit.
-i- *
*
Nach seiner Rückkehr fand sich Goethe schiver in den alten kümmer-
lichen Verhältnissen zurecht. Seine „Gewissensehe" mit Christiane Vulpius,
einer derben und drallen Schönheit, die ihm geistig wenig bieten konnte,
löste seine Beziehungen zur Frau v. Stein; auch sonst fühlte er sich
vereinsamt, und nur seine
amtlichen Pflichten lasteten
fortan nicht mehr so schwer
auf ihm. Der Herzog be-
gann endlich zu begreifen,
daß Goethe zu besseren
Dingen tauge, als das
Rad der kleinstaatlichen
Bureaukratie zu treten; er
ließ ihm so ziemlich freie
Hand, und Goethe be-
schränkte sich im Wesent-
lichen darauf, das Theater
in Weimar zu leiten.
Aber auch tiefere Kon-
flikte, die in seines Wesens
Wesenheit trafen, drängten
heran. Das Wetterleuch-
ten der französischen Revo-
lution drang über den
Rhein, und ihr ideologisches
Spiegelbild, die Kantische
Philosophie, revolutionirte
die deutschen Geister. Die
Stürme der Außenwelt
bedrohten die umfriedete
Welt der Schönheit, die
sich der Dichter erbaut
hatte. Er tvandte sich wider-
willig von ihnen ab, ohne
eine Spur des historischen
Verständnisses, das doch
viele geringere Menschen
unter den deutschen Zeit-
genossen besaßen. Die salz-
losen Possen, durch die
Goethe die große Revo-
lution verhöhnen wollte,
werfen einen tieferen Schat-
ten auf seinen Dichter-
ruhm, als selbst die MaS-
kenzüge und sonstigen leeren
Versspiele, die er den
höfischen Festen in Wei-
mar gewidmet hat. Sein
dichterisches Hauptwerk
dieser Zeit waren Wilhelm
Meisters Lehrjahre, ein
Roman, den er selbst lange
für die Krone seiner Dich-
tung gehalten hat, ohne daß dies Urtheil von der Nachwelt beglaubigt
worden wäre. So reiche Spuren des Goethischen Geistes der Roman auch
immer an sich tragen mag: alle Kunst erliegt der Armuth und Dürftig-
keit des Stoffes, des sozialen Lebens im damaligen Deutschland, das sich
nur durch die plumpen Hebel eines anmaßenden Krautjunkerthums und
eines verachteten Schauspielerproletariats ans den Angeln der ehrbar-
engen und philiströsen Prosa heben ließ.
Allein was in der Mitte der achtziger Jahre die italienische Reise
gethan hatte, das that in der Mitte der neunziger Jahre die Freund-
schaft mit Schiller. Der letzte und kühnste Ausläufer der Sturm- und
Drangperiode, brausend und schäumend noch zu einer Zeit, wo die
klassische Ruhe schon zu Goethes künstlerischem Ideal geworden war,
hatte Schiller eine heftige Abneigung gegen Goethe gefaßt, die von
diesem mit großem Mißtrauen erwidert wurde. Dann aber fanden sie
Das Goethe-Denkmal tn Berlin, von Schaper.