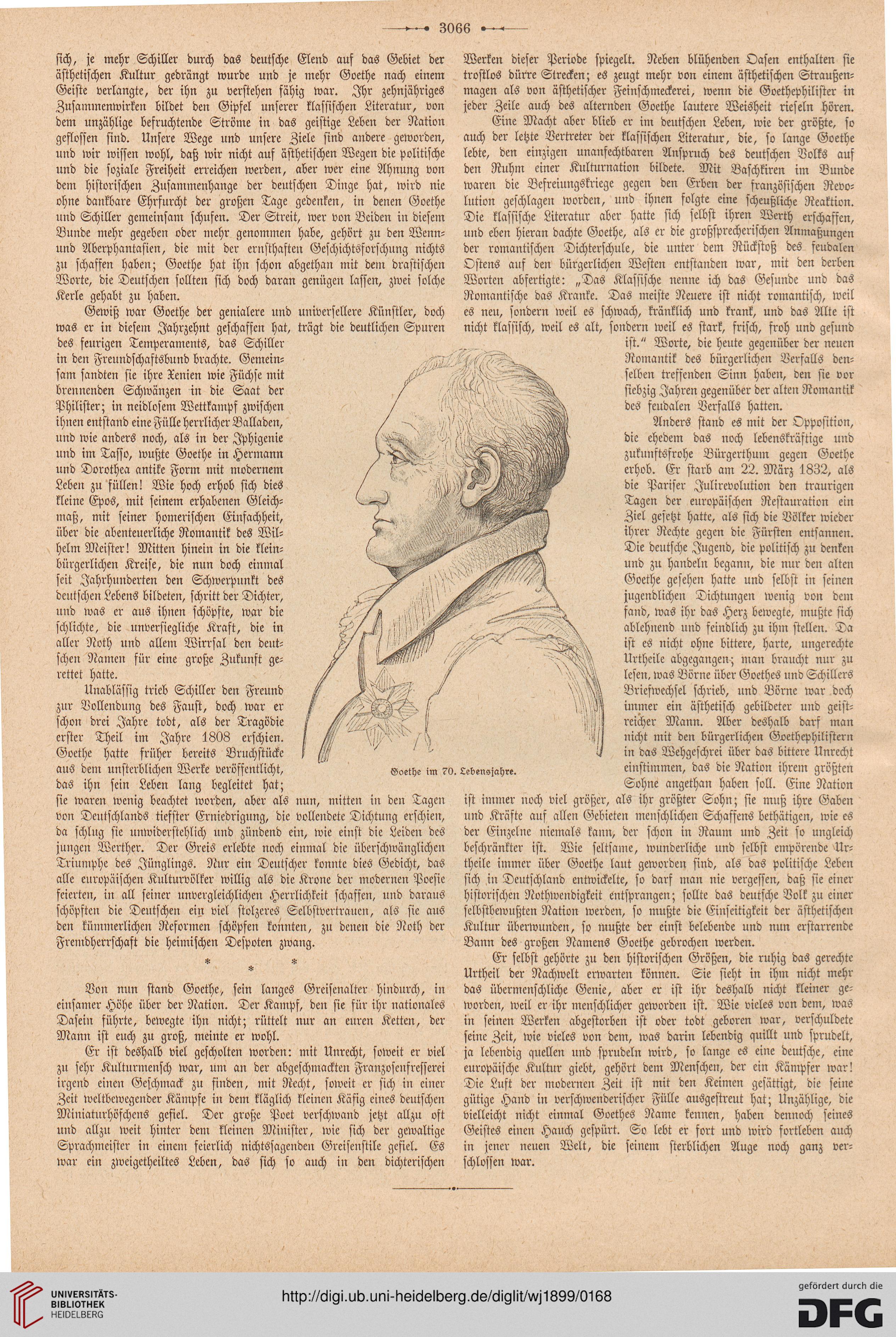3066
sich, je mehr Schiller durch das deutsche Elend auf das Gebiet der
ästhetischen Kultur gedrängt wurde und je mehr Goethe nach einem
Geiste verlangte, der ihn zu verstehen fähig war. Ihr zehnjähriges
Zusammenwirken bildet den Gipfel unserer klassischen Literatur, von
dem unzählige befruchtende Ströme in das geistige Leben der Nation
geflossen sind. Unsere Wege und unsere Ziele sind andere geworden,
und wir wissen wohl, daß wir nicht auf ästhetischen Wegen die politische
und die soziale Freiheit erreichen werden, aber wer eine Ahnung von
dem historischen Zusammenhänge der deutschen Dinge hat, wird nie
ohne dankbare Ehrfurcht der großen Tage gedenken, in denen Goethe
und Schiller gemeinsam schufen. Der Streit, wer von Beiden in diesem
Bunde mehr gegeben oder mehr genommen habe, gehört zu den Wenn-
und Aberphantasien, die mit der ernsthaften Geschichtsforschung nichts
zu schaffen haben; Goethe hat ihn schon abgethan mit dem drastischen
Worte, die Deutschen sollten sich doch daran genügen lassen, zwei solche
Kerle gehabt zu haben.
Gewiß war Goethe der genialere und universellere Künstler, doch
was er in diesem Jahrzehnt geschaffen hat, trägt die deutlichen Spuren
des feurigen Temperaments, das Schiller
in den Freundschaftsbund brachte. Gemein-
sam sandten sie ihre Genien wie Füchse mit
brennenden Schwänzen in die Saat der
Philister; in neidlosem Wettkampf zwischen
ihnen entstand eine Fülle herrlicher Balladen,
und wie anders noch, als in der Iphigenie
und im Tasso, wußte Goethe in Hermann
und Dorothea antike Form mit modernem
Leben zu füllen! Wie hoch erhob sich dies
kleine Epos, mit seinem erhabenen Gleich-
maß, mit seiner homerischen Einfachheit,
über die abenteuerliche Romantik des Wil-
helm Meister! Mitten hinein in die klein-
bürgerlichen Kreise, die nun doch einmal
seit Jahrhunderten den Schwerpunkt des
deutschen Lebens bildeten, schritt der Dichter,
und was er aus ihnen schöpfte, war die
schlichte, die unversiegliche Kraft, die in
aller Noth und allem Wirrsal den deut-
schen Namen für eine große Zukunft ge-
rettet hatte.
Unablässig trieb Schiller den Freund
zur Vollendung des Faust, doch war er
schon drei Jahre tobt, als der Tragödie
erster Theil im Jahre 1808 erschien.
Goethe hatte früher bereits Bruchstücke
aus dem unsterblichen Werke veröffentlicht,
das ihn sein Leben lang begleitet hat;
sie waren wenig beachtet worden, aber als nun, mitten in den Tagen
von Deutschlands tiefster Erniedrigung, die vollendete Dichtung erschien,
da schlug sie unwiderstehlich und zündend ein, wie einst die Leiden des
jungen Werther. Der Greis erlebte noch einmal die überschwänglichen
Triumphe des Jünglings. Nur ein Deutscher konnte dies Gedicht, das
alle europäischen Kulturvölker willig als die Krone der modernen Poesie
feierten, in all seiner unvergleichlichen Herrlichkeit schaffen, und daraus
schöpften die Deutschen ein viel stolzeres Selbstvertrauen, als sie aus
den kümmerlichen Reformen schöpfen konnten, zu denen die Noth der
Fremdherrschaft die heimischen Despoten zwang.
Von nun stand Goethe, sein langes Greisenalter hindurch, in
einsamer Höhe über der Nation. Der Kampf, den sie für ihr nationales
Dasein führte, bewegte ihn nicht; rüttelt nur an euren Ketten, der
Mann ist euch zu groß, meinte er wohl.
Er ist deshalb viel gescholten worden: mit Unrecht, soweit er viel
zu sehr Kulturmensch war, um an der abgeschmackten Franzosenfresserei
irgend einen Geschmack zu finden, mit Recht, soweit er sich in einer
Zeit weltbewegender Kämpfe in dem kläglich kleinen Käfig eines deutschen
Miniaturhöfchens gefiel. Der große Poet verschwand jetzt allzu oft
und allzu weit hinter den: kleinen Minister, wie sich der gewaltige
Sprachmeister in einem feierlich nichtssagenden Greisenstile gefiel. ES
war ein zweigetheiltes Leben, das sich so auch in den dichterischen
Goethe im 70. Lebensjahre.
Werken dieser Periode spiegelt. Neben blühenden Oasen enthalten sie
trostlos dürre Strecken; es zeugt mehr von einem ästhetischen Straußen-
magen als von ästhetischer Feinschmeckerei, wenn die Goethephilister in
jeder Zeile auch des alternden Goethe lautere Weisheit rieseln hören.
Eine Macht aber blieb er im deutschen Leben, wie der größte, so
auch der letzte Vertreter der klassischen Literatur, die, so lange Goethe
lebte, den einzigen unanfechtbaren Anspruch des deutschen Volks auf
den Ruhm einer Kulturnation bildete. Mit Baschkiren im Bunde
waren die Befreiungskriege gegen den Erben der französischen Revo-
lution geschlagen worden, und ihnen folgte eine scheußliche Reaktion.
Die klassische Literatur aber hatte sich selbst ihren Werth erschaffen,
und eben hieran dachte Goethe, als er die großsprecherischen Anmaßungen
der romantischen Dichterschule, die unter dem Rückstoß des feudalen
Ostens auf den bürgerlichen Westen entstanden war, mit den derben
Worten abfertigte: „Das Klassische nenne ich das Gesunde und das
Romantische das Kranke. Das meiste Neuere ist nicht romantisch, weil
es neu, sondern weil es schwach, kränklich und krank, und das Alte ist
nicht klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund
ist." Worte, die heute gegenüber der neuen
Romantik des bürgerlichen Verfalls den-
selben treffenden Sinn haben, den sie vor
siebzig Jahren gegenüber der alten Romantik
des feudalen Verfalls hatten.
Anders stand es mit der Opposition,
die ehedem das noch lebenskräftige und
zukunftsfrohe Bürgerthum gegen Goethe
erhob. Er starb am 22. März 1832, als
die Pariser Julirevolution den traurigen
Tagen der europäischen Restauration ein
Ziel gesetzt hatte, als sich die Völker wieder
ihrer Rechte gegen die Fürsten entsannen.
Die deutsche Jugend, die politisch zu denken
und zu handeln begann, die nur den alten
Goethe gesehen hatte und selbst in seinen
jugendlichen Dichtungen wenig von dem
fand, was ihr das Herz bewegte, mußte sich
ablehnend und feindlich zu ihm stellen. Da
ist es nicht ohne bittere, harte, ungerechte
Urtheile abgegangen; man braucht nur zu
lesen, was Börne über Goethes und Schillers
Briefwechsel schrieb, und Börne war doch
immer ein ästhetisch gebildeter und geist-
reicher Mann. Aber deshalb darf man
nicht mit den bürgerlichen Goethephilistern
in das Wehgeschrei über das bittere Unrecht
einstimmen, das die Nation ihrem größten
Sohne angethan haben soll. Eine Nation
ist immer noch viel größer, als ihr größter Sohn; sie muß ihre Gaben
und Kräfte auf allen Gebieten menschlichen Schaffens bethätigen, wie es
der Einzelne niemals kann, der schon in Raum und Zeit so ungleich
beschränkter ist. Wie seltsame, wunderliche und selbst empörende Ur-
theile immer über Goethe laut geworden sind, als das politische Leben
sich sn Deutschland entwickelte, so darf man nie vergessen, daß sie einer
historischen Nothwendigkeit entsprangen; sollte das deutsche Volk zu einer
selbstbewußten Nation werden, so mußte die Einseitigkeit der ästhetischen
Kultur überwunden, so mußte der einst belebende und nun erstarrende
Bann des großen Namens Goethe gebrochen werden.
Er selbst gehörte zu den historischen Größen, die ruhig das gerechte
Urtheil der Nachwelt erwarten können. Sie sieht in ihm nicht mehr
das übermenschliche Genie, aber er ist ihr deshalb nicht kleiner ge-
worden, weil er ihr menschlicher geworden ist. Wie vieles von dem, was
in seinen Werken abgestorben ist oder tobt geboren war, verschuldete
seine Zeit, wie vieles von dem, was darin lebendig quillt und sprudelt,
ja lebendig quellen und sprudeln wird, so lange es eine deutsche, eine
europäische Kultur giebt, gehört dem Menschen, der ein Kämpfer war!
Die Luft der modernen Zeit ist mit den Keimen gesättigt, die seine
gütige Hand in verschwenderischer Fülle ausgestreut hat; Unzählige, die
vielleicht nicht einmal Goethes Name kennen, haben dennoch seines
Geistes einen Hauch gespürt. So lebt er fort und wird fortleben auch
in jener neuen Welt, die seinem sterblichen Auge noch ganz ver-
schlossen war.
sich, je mehr Schiller durch das deutsche Elend auf das Gebiet der
ästhetischen Kultur gedrängt wurde und je mehr Goethe nach einem
Geiste verlangte, der ihn zu verstehen fähig war. Ihr zehnjähriges
Zusammenwirken bildet den Gipfel unserer klassischen Literatur, von
dem unzählige befruchtende Ströme in das geistige Leben der Nation
geflossen sind. Unsere Wege und unsere Ziele sind andere geworden,
und wir wissen wohl, daß wir nicht auf ästhetischen Wegen die politische
und die soziale Freiheit erreichen werden, aber wer eine Ahnung von
dem historischen Zusammenhänge der deutschen Dinge hat, wird nie
ohne dankbare Ehrfurcht der großen Tage gedenken, in denen Goethe
und Schiller gemeinsam schufen. Der Streit, wer von Beiden in diesem
Bunde mehr gegeben oder mehr genommen habe, gehört zu den Wenn-
und Aberphantasien, die mit der ernsthaften Geschichtsforschung nichts
zu schaffen haben; Goethe hat ihn schon abgethan mit dem drastischen
Worte, die Deutschen sollten sich doch daran genügen lassen, zwei solche
Kerle gehabt zu haben.
Gewiß war Goethe der genialere und universellere Künstler, doch
was er in diesem Jahrzehnt geschaffen hat, trägt die deutlichen Spuren
des feurigen Temperaments, das Schiller
in den Freundschaftsbund brachte. Gemein-
sam sandten sie ihre Genien wie Füchse mit
brennenden Schwänzen in die Saat der
Philister; in neidlosem Wettkampf zwischen
ihnen entstand eine Fülle herrlicher Balladen,
und wie anders noch, als in der Iphigenie
und im Tasso, wußte Goethe in Hermann
und Dorothea antike Form mit modernem
Leben zu füllen! Wie hoch erhob sich dies
kleine Epos, mit seinem erhabenen Gleich-
maß, mit seiner homerischen Einfachheit,
über die abenteuerliche Romantik des Wil-
helm Meister! Mitten hinein in die klein-
bürgerlichen Kreise, die nun doch einmal
seit Jahrhunderten den Schwerpunkt des
deutschen Lebens bildeten, schritt der Dichter,
und was er aus ihnen schöpfte, war die
schlichte, die unversiegliche Kraft, die in
aller Noth und allem Wirrsal den deut-
schen Namen für eine große Zukunft ge-
rettet hatte.
Unablässig trieb Schiller den Freund
zur Vollendung des Faust, doch war er
schon drei Jahre tobt, als der Tragödie
erster Theil im Jahre 1808 erschien.
Goethe hatte früher bereits Bruchstücke
aus dem unsterblichen Werke veröffentlicht,
das ihn sein Leben lang begleitet hat;
sie waren wenig beachtet worden, aber als nun, mitten in den Tagen
von Deutschlands tiefster Erniedrigung, die vollendete Dichtung erschien,
da schlug sie unwiderstehlich und zündend ein, wie einst die Leiden des
jungen Werther. Der Greis erlebte noch einmal die überschwänglichen
Triumphe des Jünglings. Nur ein Deutscher konnte dies Gedicht, das
alle europäischen Kulturvölker willig als die Krone der modernen Poesie
feierten, in all seiner unvergleichlichen Herrlichkeit schaffen, und daraus
schöpften die Deutschen ein viel stolzeres Selbstvertrauen, als sie aus
den kümmerlichen Reformen schöpfen konnten, zu denen die Noth der
Fremdherrschaft die heimischen Despoten zwang.
Von nun stand Goethe, sein langes Greisenalter hindurch, in
einsamer Höhe über der Nation. Der Kampf, den sie für ihr nationales
Dasein führte, bewegte ihn nicht; rüttelt nur an euren Ketten, der
Mann ist euch zu groß, meinte er wohl.
Er ist deshalb viel gescholten worden: mit Unrecht, soweit er viel
zu sehr Kulturmensch war, um an der abgeschmackten Franzosenfresserei
irgend einen Geschmack zu finden, mit Recht, soweit er sich in einer
Zeit weltbewegender Kämpfe in dem kläglich kleinen Käfig eines deutschen
Miniaturhöfchens gefiel. Der große Poet verschwand jetzt allzu oft
und allzu weit hinter den: kleinen Minister, wie sich der gewaltige
Sprachmeister in einem feierlich nichtssagenden Greisenstile gefiel. ES
war ein zweigetheiltes Leben, das sich so auch in den dichterischen
Goethe im 70. Lebensjahre.
Werken dieser Periode spiegelt. Neben blühenden Oasen enthalten sie
trostlos dürre Strecken; es zeugt mehr von einem ästhetischen Straußen-
magen als von ästhetischer Feinschmeckerei, wenn die Goethephilister in
jeder Zeile auch des alternden Goethe lautere Weisheit rieseln hören.
Eine Macht aber blieb er im deutschen Leben, wie der größte, so
auch der letzte Vertreter der klassischen Literatur, die, so lange Goethe
lebte, den einzigen unanfechtbaren Anspruch des deutschen Volks auf
den Ruhm einer Kulturnation bildete. Mit Baschkiren im Bunde
waren die Befreiungskriege gegen den Erben der französischen Revo-
lution geschlagen worden, und ihnen folgte eine scheußliche Reaktion.
Die klassische Literatur aber hatte sich selbst ihren Werth erschaffen,
und eben hieran dachte Goethe, als er die großsprecherischen Anmaßungen
der romantischen Dichterschule, die unter dem Rückstoß des feudalen
Ostens auf den bürgerlichen Westen entstanden war, mit den derben
Worten abfertigte: „Das Klassische nenne ich das Gesunde und das
Romantische das Kranke. Das meiste Neuere ist nicht romantisch, weil
es neu, sondern weil es schwach, kränklich und krank, und das Alte ist
nicht klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund
ist." Worte, die heute gegenüber der neuen
Romantik des bürgerlichen Verfalls den-
selben treffenden Sinn haben, den sie vor
siebzig Jahren gegenüber der alten Romantik
des feudalen Verfalls hatten.
Anders stand es mit der Opposition,
die ehedem das noch lebenskräftige und
zukunftsfrohe Bürgerthum gegen Goethe
erhob. Er starb am 22. März 1832, als
die Pariser Julirevolution den traurigen
Tagen der europäischen Restauration ein
Ziel gesetzt hatte, als sich die Völker wieder
ihrer Rechte gegen die Fürsten entsannen.
Die deutsche Jugend, die politisch zu denken
und zu handeln begann, die nur den alten
Goethe gesehen hatte und selbst in seinen
jugendlichen Dichtungen wenig von dem
fand, was ihr das Herz bewegte, mußte sich
ablehnend und feindlich zu ihm stellen. Da
ist es nicht ohne bittere, harte, ungerechte
Urtheile abgegangen; man braucht nur zu
lesen, was Börne über Goethes und Schillers
Briefwechsel schrieb, und Börne war doch
immer ein ästhetisch gebildeter und geist-
reicher Mann. Aber deshalb darf man
nicht mit den bürgerlichen Goethephilistern
in das Wehgeschrei über das bittere Unrecht
einstimmen, das die Nation ihrem größten
Sohne angethan haben soll. Eine Nation
ist immer noch viel größer, als ihr größter Sohn; sie muß ihre Gaben
und Kräfte auf allen Gebieten menschlichen Schaffens bethätigen, wie es
der Einzelne niemals kann, der schon in Raum und Zeit so ungleich
beschränkter ist. Wie seltsame, wunderliche und selbst empörende Ur-
theile immer über Goethe laut geworden sind, als das politische Leben
sich sn Deutschland entwickelte, so darf man nie vergessen, daß sie einer
historischen Nothwendigkeit entsprangen; sollte das deutsche Volk zu einer
selbstbewußten Nation werden, so mußte die Einseitigkeit der ästhetischen
Kultur überwunden, so mußte der einst belebende und nun erstarrende
Bann des großen Namens Goethe gebrochen werden.
Er selbst gehörte zu den historischen Größen, die ruhig das gerechte
Urtheil der Nachwelt erwarten können. Sie sieht in ihm nicht mehr
das übermenschliche Genie, aber er ist ihr deshalb nicht kleiner ge-
worden, weil er ihr menschlicher geworden ist. Wie vieles von dem, was
in seinen Werken abgestorben ist oder tobt geboren war, verschuldete
seine Zeit, wie vieles von dem, was darin lebendig quillt und sprudelt,
ja lebendig quellen und sprudeln wird, so lange es eine deutsche, eine
europäische Kultur giebt, gehört dem Menschen, der ein Kämpfer war!
Die Luft der modernen Zeit ist mit den Keimen gesättigt, die seine
gütige Hand in verschwenderischer Fülle ausgestreut hat; Unzählige, die
vielleicht nicht einmal Goethes Name kennen, haben dennoch seines
Geistes einen Hauch gespürt. So lebt er fort und wird fortleben auch
in jener neuen Welt, die seinem sterblichen Auge noch ganz ver-
schlossen war.