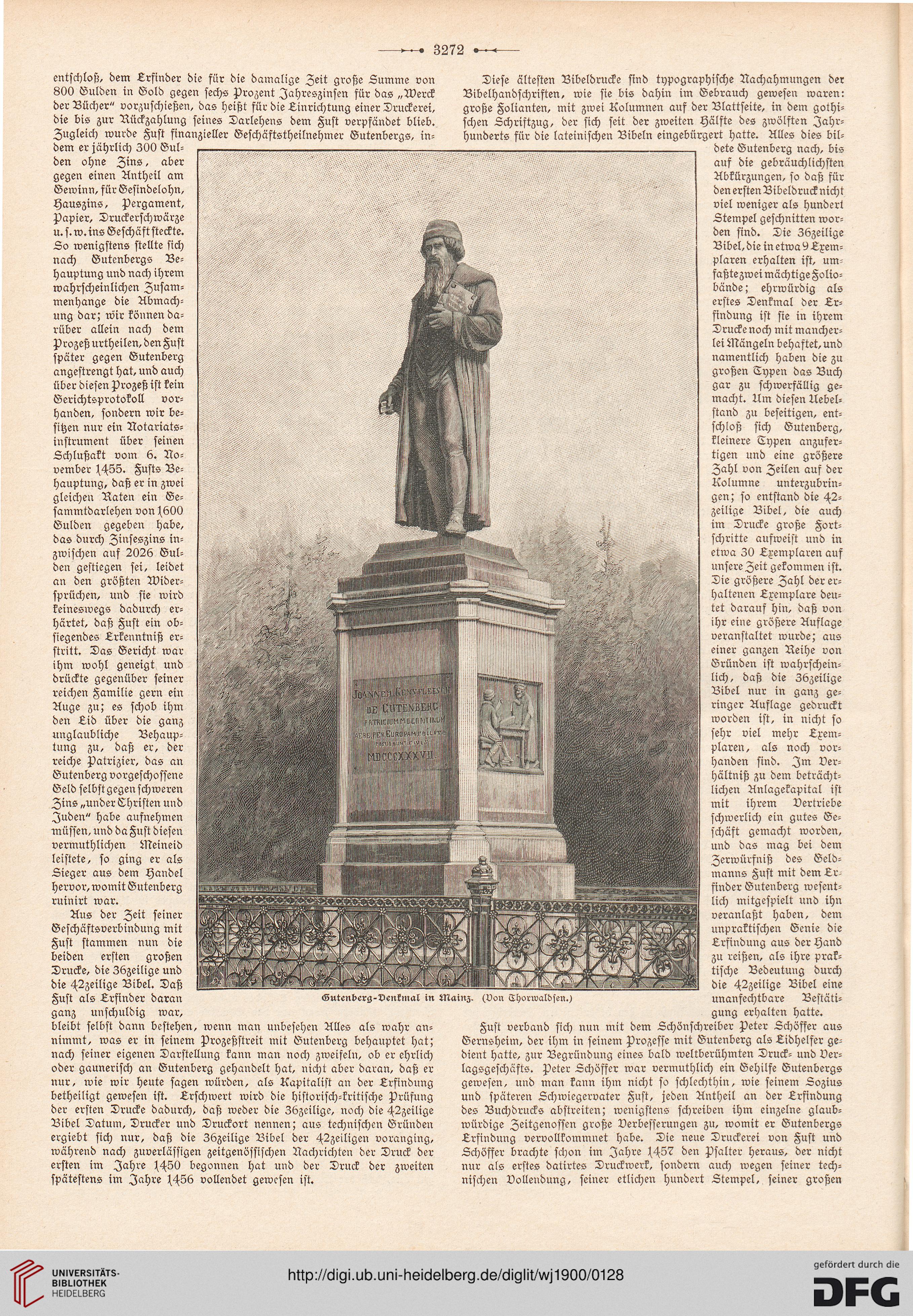3272 .
entschloß, dem Erfinder die für die damalige Zeit große Summe von
800 Gulden in Gold gegen sechs Prozent Jahreszinsen für das „Merck
der Bücher" vorzuschießen, das heißt für die Einrichtung einer Druckerei,
die bis zur Rückzahlung feines Darlehens dem Fust verpfändet blieb.
Zugleich wurde Fust finanzieller Geschäftstheilnehmer Gutenbergs, in-
dem er jährlich ZOO dul-
den ohne Zins, aber
gegen einen Antheil am
Gewinn, für Gesindelohn,
Hauszins, Pergament,
Papier, Druckerschwärze
u. s. w. ins Geschäftsteckte.
So wenigstens stellte sich
nach Gutenbergs Be-
hauptung und nach ihrem
wahrscheinlichen Zusam-
menhänge die Abmach-
ung dar; wir können da-
rüber allein nach dem
Prozeß urtheilen, den Fust
später gegen Gutenberg
angestrengt hat, und auch
über diesen Prozeß ist kein
Gerichtsprotokoll vor-
handen, sondern wir be-
sitzen nur ein Notariats-
instrument über seinen
Schlußakt vom 6. No-
vember 1455. Fusts Be-
hauptung, daß er in zwei
gleichen Raten ein Ge-
sammtdarlehen von 1600
Gulden gegeben habe,
das durch Zinseszins in-
zwischen auf 2026 Gul-
den gestiegen sei, leidet
an den größten Wider-
sprüchen, und sie wird
keineswegs dadurch er-
härtet, daß Fust ein ob-
siegendes Lrkenntniß er-
stritt. Das Gericht war
ihm wohl geneigt und
drückte gegenüber seiner
reichen Familie gern ein
Auge zu; es schob ihm
den Lid über die ganz
unglaubliche Behaup-
tung zu, daß er, der
reiche Patrizier, das an
Gutenberg vorgeschossene
Geld selbstgegenschweren
Zins „under Christen und
Juden" habe aufnehmen
müssen, und da Fust diesen
vermutlichen Meineid
leistete, so ging er als
Sieger aus dem Handel
hervor, womit Gutenberg
ruinirt war.
Aus der Zeit seiner
Geschäftsverbindung mit
Fust stammen nun die
beiden ersten großen
Drucke, die 36zeilige und
die 42zeilige Bibel. Daß
Fust als Erfinder daran
ganz unschuldig war,
bleibt selbst dann bestehen, wenn man unbesehen Alles als wahr an-
nimmt, was er in seinem prozeßstreit mit Gutenberg behauptet hat;
nach seiner eigenen Darstellung kann man noch zweifeln, ob er ehrlich
oder gaunerisch an Gutenberg gehandelt hat, nicht aber daran, daß er
nur, wie wir heute sagen würden, als Kapitalist an der Erfindung
betheiligt gewesen ist. Erschwert wird die historisch-kritische Prüfung
der ersten Drucke dadurch, daß weder die 36zeilige, noch die 42zeilige
Bibel Datum, Drucker und Druckort nennen; aus technischen Gründen
ergiebt sich nur, daß die 36zeilige Bibel der ^2zeiligen voranging,
während nach zuverlässigen zeitgenössischen Nachrichten der Druck der
ersten im Jahre 1450 begonnen hat und der Druck der zweiten
spätestens im Jahre 1456 vollendet gewesen ist.
Diese ältesten Bibeldrucke sind typographische Nachahmungen der
Bibelhandschriften, wie sie bis dahin im Gebrauch gewesen waren:
große Folianten, mit zwei Kolumnen auf der Blattfeite, in dem gothi-
schen Schriftzug, der sich seit der zweiten Hälfte des zwölften Jahr-
hunderts für die lateinischen Bibeln eingebürgert hatte. Alles dies bil-
dete Gutenberg nach, bis
auf die gebräuchlichsten
Abkürzungen, so daß für
den ersten Bibeldruck nicht
viel weniger als hundert
Stempel geschnitten wor-
den sind. Die 36zeilige
Bibel, die in etwa 9 Exem-
plaren erhalten ist, um-
faßtezweimächtigeFolio-
bände; ehrwürdig als
erstes Denkmal der Er-
findung ist sie in ihrem
Drucke noch mit mancher-
lei Mängeln behaftet, und
namentlich haben die zu
großen Typen das Buch
gar zu schwerfällig ge-
macht. Um diesen Uebel-
stand zu beseitigen, ent-
schloß sich Gutenberg,
kleinere Typen anzufer-
tigen und eine größere
Zahl von Zeilen auf der
Kolumne unterzubrin-
gen; so entstand die 42-
zeilige Bibel, die auch
im Drucke große Fort-
schritte aufweist und in
etwa 30 Exemplaren auf
unsere Zeit gekommen ist.
Die größere Zahl der er-
haltenen Exemplare deu-
tet darauf hin, daß von
ihr eine größere Auflage
veranstaltet wurde; aus
einer ganzen Reihe von
Gründen ist wahrschein-
lich, daß die 36zeilige
Bibel nur in ganz ge-
ringer Auflage gedruckt
worden ist, in nicht so
sehr viel mehr Exem-
plaren, als noch vor-
handen sind. Im ver-
hältniß zu dem beträcht-
lichen Anlagekapital ist
mit ihrem Vertriebe
schwerlich ein gutes Ge-
schäft gemacht worden,
und das mag bei dem
Zsrwürfniß des Geld-
manns Fust mit dem Er-
finder Gutenberg wesent-
lich mitgespielt und ihn
veranlaßt haben, dem
unpraktischen Genie die
Erfindung aus der Hand
zu reißen, als ihre prak-
tische Bedeutung durch
die 42zeilige Bibel eine
unanfechtbare Bestäti-
gung erhalten hatte.
Fust verband sich nun mit dem Schönschreiber Peter Schöffer aus
Gernsheim, der ihm in seinem Prozesse mit Gutenberg als Lidhelfer ge-
dient hatte, zur Begründung eines bald weltberühmten Druck- und Ver-
lagsgeschäfts. Peter Schöffer war vermuthlich ein Gehilfe Gutenbergs
gewesen, und man kann ihm nicht so schlechthin, wie seinem Sozius
und späteren Schwiegervater Fust, jeden Antheil an der Erfindung
des Buchdrucks abstreiten; wenigstens schreiben ihm einzelne glaub-
würdige Zeitgenossen große Verbesserungen zu, womit er Gutenbergs
Erfindung vervollkommnet habe. Die neue Druckerei von Fust und
Schöffer brachte schon im Jahre 1452 den Psalter heraus, der nicht
nur als erstes datirtes Druckwerk, sondern auch wegen seiner tech-
nischen Vollendung, seiner etlichen hundert Stempel, seiner großen
Gutenberg-Venkmal in Mainz, (von Thorwaldsen.)
entschloß, dem Erfinder die für die damalige Zeit große Summe von
800 Gulden in Gold gegen sechs Prozent Jahreszinsen für das „Merck
der Bücher" vorzuschießen, das heißt für die Einrichtung einer Druckerei,
die bis zur Rückzahlung feines Darlehens dem Fust verpfändet blieb.
Zugleich wurde Fust finanzieller Geschäftstheilnehmer Gutenbergs, in-
dem er jährlich ZOO dul-
den ohne Zins, aber
gegen einen Antheil am
Gewinn, für Gesindelohn,
Hauszins, Pergament,
Papier, Druckerschwärze
u. s. w. ins Geschäftsteckte.
So wenigstens stellte sich
nach Gutenbergs Be-
hauptung und nach ihrem
wahrscheinlichen Zusam-
menhänge die Abmach-
ung dar; wir können da-
rüber allein nach dem
Prozeß urtheilen, den Fust
später gegen Gutenberg
angestrengt hat, und auch
über diesen Prozeß ist kein
Gerichtsprotokoll vor-
handen, sondern wir be-
sitzen nur ein Notariats-
instrument über seinen
Schlußakt vom 6. No-
vember 1455. Fusts Be-
hauptung, daß er in zwei
gleichen Raten ein Ge-
sammtdarlehen von 1600
Gulden gegeben habe,
das durch Zinseszins in-
zwischen auf 2026 Gul-
den gestiegen sei, leidet
an den größten Wider-
sprüchen, und sie wird
keineswegs dadurch er-
härtet, daß Fust ein ob-
siegendes Lrkenntniß er-
stritt. Das Gericht war
ihm wohl geneigt und
drückte gegenüber seiner
reichen Familie gern ein
Auge zu; es schob ihm
den Lid über die ganz
unglaubliche Behaup-
tung zu, daß er, der
reiche Patrizier, das an
Gutenberg vorgeschossene
Geld selbstgegenschweren
Zins „under Christen und
Juden" habe aufnehmen
müssen, und da Fust diesen
vermutlichen Meineid
leistete, so ging er als
Sieger aus dem Handel
hervor, womit Gutenberg
ruinirt war.
Aus der Zeit seiner
Geschäftsverbindung mit
Fust stammen nun die
beiden ersten großen
Drucke, die 36zeilige und
die 42zeilige Bibel. Daß
Fust als Erfinder daran
ganz unschuldig war,
bleibt selbst dann bestehen, wenn man unbesehen Alles als wahr an-
nimmt, was er in seinem prozeßstreit mit Gutenberg behauptet hat;
nach seiner eigenen Darstellung kann man noch zweifeln, ob er ehrlich
oder gaunerisch an Gutenberg gehandelt hat, nicht aber daran, daß er
nur, wie wir heute sagen würden, als Kapitalist an der Erfindung
betheiligt gewesen ist. Erschwert wird die historisch-kritische Prüfung
der ersten Drucke dadurch, daß weder die 36zeilige, noch die 42zeilige
Bibel Datum, Drucker und Druckort nennen; aus technischen Gründen
ergiebt sich nur, daß die 36zeilige Bibel der ^2zeiligen voranging,
während nach zuverlässigen zeitgenössischen Nachrichten der Druck der
ersten im Jahre 1450 begonnen hat und der Druck der zweiten
spätestens im Jahre 1456 vollendet gewesen ist.
Diese ältesten Bibeldrucke sind typographische Nachahmungen der
Bibelhandschriften, wie sie bis dahin im Gebrauch gewesen waren:
große Folianten, mit zwei Kolumnen auf der Blattfeite, in dem gothi-
schen Schriftzug, der sich seit der zweiten Hälfte des zwölften Jahr-
hunderts für die lateinischen Bibeln eingebürgert hatte. Alles dies bil-
dete Gutenberg nach, bis
auf die gebräuchlichsten
Abkürzungen, so daß für
den ersten Bibeldruck nicht
viel weniger als hundert
Stempel geschnitten wor-
den sind. Die 36zeilige
Bibel, die in etwa 9 Exem-
plaren erhalten ist, um-
faßtezweimächtigeFolio-
bände; ehrwürdig als
erstes Denkmal der Er-
findung ist sie in ihrem
Drucke noch mit mancher-
lei Mängeln behaftet, und
namentlich haben die zu
großen Typen das Buch
gar zu schwerfällig ge-
macht. Um diesen Uebel-
stand zu beseitigen, ent-
schloß sich Gutenberg,
kleinere Typen anzufer-
tigen und eine größere
Zahl von Zeilen auf der
Kolumne unterzubrin-
gen; so entstand die 42-
zeilige Bibel, die auch
im Drucke große Fort-
schritte aufweist und in
etwa 30 Exemplaren auf
unsere Zeit gekommen ist.
Die größere Zahl der er-
haltenen Exemplare deu-
tet darauf hin, daß von
ihr eine größere Auflage
veranstaltet wurde; aus
einer ganzen Reihe von
Gründen ist wahrschein-
lich, daß die 36zeilige
Bibel nur in ganz ge-
ringer Auflage gedruckt
worden ist, in nicht so
sehr viel mehr Exem-
plaren, als noch vor-
handen sind. Im ver-
hältniß zu dem beträcht-
lichen Anlagekapital ist
mit ihrem Vertriebe
schwerlich ein gutes Ge-
schäft gemacht worden,
und das mag bei dem
Zsrwürfniß des Geld-
manns Fust mit dem Er-
finder Gutenberg wesent-
lich mitgespielt und ihn
veranlaßt haben, dem
unpraktischen Genie die
Erfindung aus der Hand
zu reißen, als ihre prak-
tische Bedeutung durch
die 42zeilige Bibel eine
unanfechtbare Bestäti-
gung erhalten hatte.
Fust verband sich nun mit dem Schönschreiber Peter Schöffer aus
Gernsheim, der ihm in seinem Prozesse mit Gutenberg als Lidhelfer ge-
dient hatte, zur Begründung eines bald weltberühmten Druck- und Ver-
lagsgeschäfts. Peter Schöffer war vermuthlich ein Gehilfe Gutenbergs
gewesen, und man kann ihm nicht so schlechthin, wie seinem Sozius
und späteren Schwiegervater Fust, jeden Antheil an der Erfindung
des Buchdrucks abstreiten; wenigstens schreiben ihm einzelne glaub-
würdige Zeitgenossen große Verbesserungen zu, womit er Gutenbergs
Erfindung vervollkommnet habe. Die neue Druckerei von Fust und
Schöffer brachte schon im Jahre 1452 den Psalter heraus, der nicht
nur als erstes datirtes Druckwerk, sondern auch wegen seiner tech-
nischen Vollendung, seiner etlichen hundert Stempel, seiner großen
Gutenberg-Venkmal in Mainz, (von Thorwaldsen.)