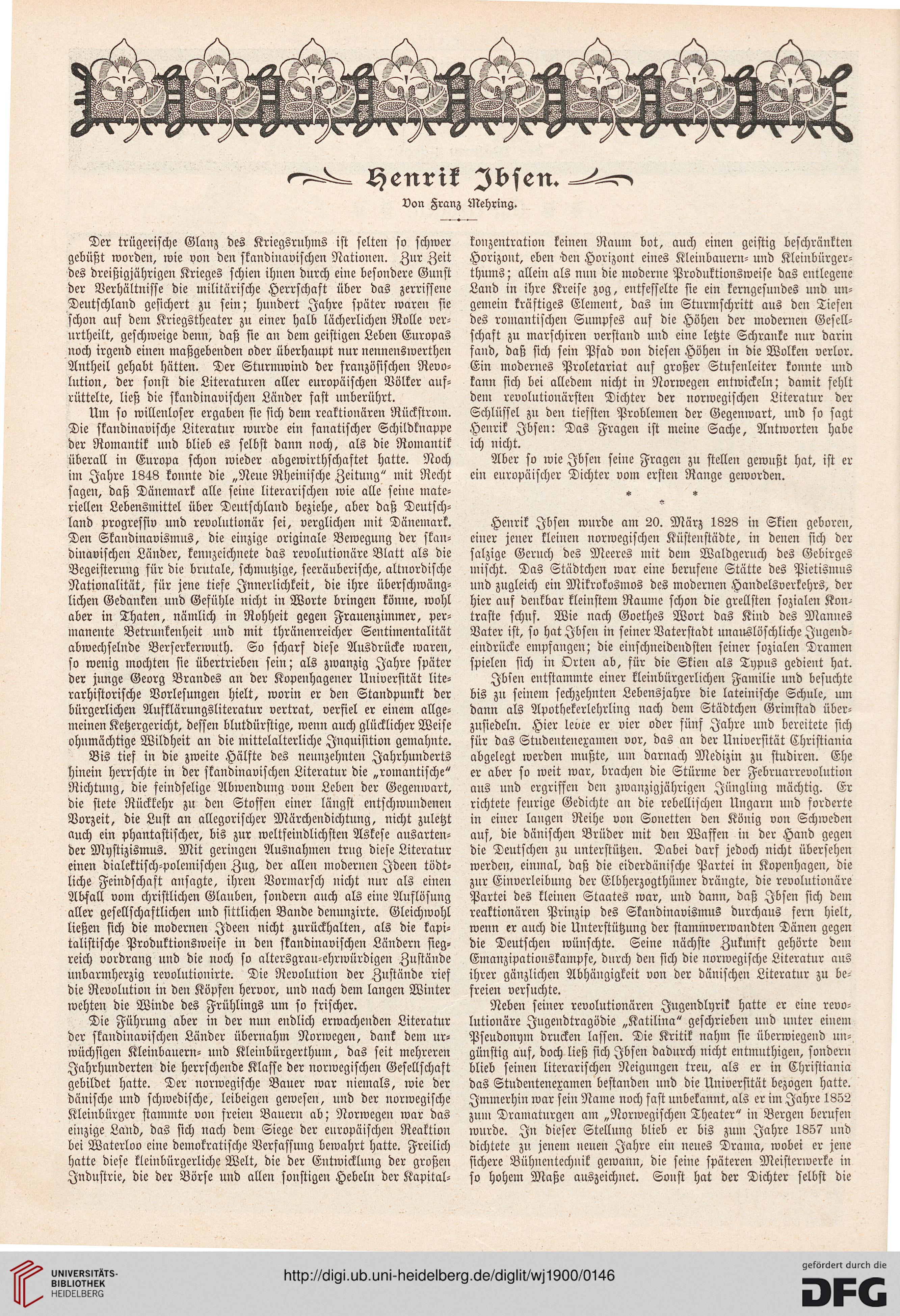von 8ranz Mehring.
Der trügerische Glanz des Kriegsruhms ist selten so schwer
gebüßt worden, wie von den skandinavischen Nationen. Zur Zeit
des dreißigjährigen Krieges schien ihnen durch eine besondere Gunst
der Verhältnisse die militärische Herrschaft über das zerrissene
Deutschland gesichert zu sein; hundert Jahre später waren sie
schon auf dem Kriegstheater zu einer halb lächerlichen Rolle ver-
urtheilt, geschweige denn, daß sie an dem geistigen Leben Europas
noch irgend einen maßgebenden oder überhaupt nur nennenswerthen
Antheil gehabt hätten. Der Sturmwind der französischen Revo-
lution, der sonst die Literaturen aller europäischen Völker auf-
rüttelte, ließ die skandinavischen Länder fast unberührt.
Um so willenloser ergaben sie sich dem reaktionären Rückstrom.
Die skandinavische Literatur wurde ein fanatischer Schildknappe
der Romantik und blieb es selbst dann noch, als die Romantik
überall in Europa schon wieder abgewirthschastet hatte. Noch
im Jahre 1848 konnte die „Neue Rheinische Zeitung" mit Recht
sagen, daß Dänemark alle seine literarischen wie alle seine inate-
riellen Lebensmittel über Deutschland beziehe, aber daß Deutsch-
land progressiv und revolutionär sei, verglichen mit Dänemark.
Den Skandinavismus, die einzige originale Bewegung der skan-
dinavischen Länder, kennzeichnete das revolutionäre Blatt als die
Begeisterung für die brutale, schmutzige, seeräuberische, altnordische
Nationalität, für jene tiefe Innerlichkeit, die ihre überschwäng-
lichen Gedanken und Gefühle nicht in Worte bringen könne, wohl
aber in Thaten, nämlich in Rohheit gegen Frauenzimmer, per-
manente Betrunkenheit und mit thränenreicher Sentimentalität
abwechselnde Berserkerwuth. So scharf diese Ausdrücke waren,
so wenig mochten sie übertrieben sein; als zwanzig Jahre später
der junge Georg Brandes an der Kopenhagener Universität lite-
rarhistorische Vorlesungen hielt, worin er den Standpunkt der
bürgerlichen Aufklärungsliteratur vertrat, verfiel er einem allge-
meinen Ketzergericht, dessen blutdürstige, wenn auch glücklicher Weise
ohnmächtige Wildheit an die mittelalterliche Inquisition gemahnte.
Bis tief in die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
hinein herrschte in der skandinavischen Literatur die „romantische"
Richtung, die feindselige Abwendung voin Leben der Gegenwart,
die stete Rückkehr zu den Stoffen einer längst entschwundenen
Vorzeit, die Lust an allegorischer Märchendichtung, nicht zuletzt
auch ein phantastischer, bis zur weltfeindlichsten Askese ausarten-
der Mystizismus. Mit geringen Ausnahmen trug diese Literatur
einen dialektisch-polemischen Zug, der allen modernen Ideen tödt-
liche Feindschaft ansagte, ihren Vormarsch nicht nur als einen
Abfall vom christlichen Glauben, sondern auch als eine Auslösung
aller gesellschaftlichen und sittlichen Bande denunzirte. Gleichwohl
ließen sich die modernen Ideen nicht zurückhalten, als die kapi-
talistische Produktionsweise in den skandinavischen Ländern sieg-
reich vordrang und die noch so altersgrau-ehrwürdigen Zustände
unbarmherzig revolutionirte. Die Revolution der Zustände rief
die Revolution in den Köpfen hervor, und nach dem langen Winter
wehten die Winde des Frühlings um so frischer.
Die Führung aber in der nun endlich erwachenden Literatur
der skandinavischen Länder übernahm Norwegen, dank dem ur-
wüchsigen Kleinbauern- und Kleinbürgerthum, das seit mehreren
Jahrhunderten die herrschende Klasse der norwegischen Gesellschaft
gebildet hatte. Der norwegische Bauer war niemals, wie der
dänische und schwedische, leibeigen gewesen, und der norwegische
Kleinbürger stammte von freien Bauern ab; Norwegen war das
einzige Land, das sich nach dem Siege der europäischen Reaktion
bei Waterloo eine demokratische Verfassung bewahrt hatte. Freilich
hatte diese kleinbürgerliche Welt, die der Entwicklung der großen
Industrie, die der Börse und allen sonstigen Hebeln der Kapital-
konzentration keinen Raum bot, auch einen geistig beschränkten
Horizont, eben den Horizont eines Kleinbauern- und Kleinbürger-
thums ; allein als nun die moderne Produktionsweise das entlegene
Land in ihre Kreise zog, entfesselte sie ein kerngesundes und un-
gemein kräftiges Element, das im Sturmschritt aus den Tiefen
des romantischen Sumpfes auf die Höhen der modernen Gesell-
schaft zu marschiren verstand und eine letzte Schranke nur darin
fand, daß sich sein Pfad von diesen Höhen in die Wolken verlor.
Ein modernes Proletariat auf großer Stufenleiter konnte und
kann sich bei alledem nicht in Norwegen entwickeln; damit fehlt
dem revolutionärsten Dichter der norwegischen Literatur der
Schlüssel zu den tiefsten Problemen der Gegenwart, und so sagt
Henrik Ibsen: Das Fragen ist meine Sache, Antworten habe
ich nicht.
Aber so wie Ibsen seine Fragen zu stellen gewußt hat, ist er
ein europäischer Dichter vom ersten Range geworden.
Henrik Ibsen wurde am 20. März 1828 in Skien geboren,
einer jener kleinen norwegischen Küstenstädte, in denen sich der
salzige Geruch des Meeres mit dem Waldgeruch des Gebirges
mischt. Das Städtchen war eine berufene Stätte des Pietismus
und zugleich ein Mikrokosmos des modernen Handelsverkehrs, der
hier auf denkbar kleinstem Raume schon die grellsten sozialen Kon-
traste schuf. Wie nach Goethes Wort das Kind des Mannes
Vater ist, so hat Ibsen in seiner Vaterstadt unauslöschliche Jugend-
eindrücke empfangen; die einschneidendsten seiner sozialen Dramen
spielen sich in Orten ab, für die Skien als Typus gedient hat.
Jblen entstammte einer kleinbürgerlichen Familie und besuchte
bis zu seinem sechzehnten Lebensjahre die lateinische Schule, um
dann als Apothekerlehrling nach dem Städtchen Grimstad über-
zusiedeln. Hier leote er vier oder fünf Jahre und bereitete sich
für das Studentenexamen vor, das an der Universität Christiania
abgelegt werden mußte, um darnach Medizin zu studiren. Ehe
er aber so weit war, brachen die Stürme der Februarrevolution
aus und ergriffen den zwanzigjährigen Jüngling mächtig. Er
richtete feurige Gedichte an die rebellischen Ungarn und forderte
in einer langen Reihe von Sonetten den König von Schweden
auf, die dänischen Brüder mit den Waffen in der Hand gegen
die Deutschen zu unterstützen. Dabei darf jedoch nicht übersehen
werden, eininal, daß die eiderdänische Partei in Kopenhagen, die
zur Einverleibung der Elbherzogthümer drängte, die revolutionäre
Partei des kleinen Staates war, und dann, daß Ibsen sich dem
reaktionären Prinzip des Skandinavismus durchaus fern hielt,
wenn er auch die Unterstützung der stammverwandten Dänen gegen
die Deutschen wünschte. Seine nächste Zukunft gehörte dem
Emanzipationskampfe, durch den sich die norwegische Literatur aus
ihrer gänzlichen Abhängigkeit von der dänischen Literatur zu be-
freien versuchte.
Neben seiner revolutionären Jugendlyrik hatte er eine revo-
lutionäre Jugendtragödie „Katilina" geschrieben und unter einem
Pseudonym drucken lassen. Die Kritik nahm sie überwiegend un-
günstig auf, doch ließ sich Ibsen dadurch nicht entmuthigen, sondern
blieb seinen literarischen Neigungen treu, als er in Christiania
das Studentenexamen bestanden und die Universität bezogen hatte.
Immerhin war sein Name noch fast unbekannt, als er im Jahre 1852
zum Dramaturgen am „Norwegischen Theater" in Bergen berufen
wurde. In dieser Stellung blieb er bis zum Jahre 1857 und
dichtete zu jenem neuen Jahre ein neues Drama, wobei er jene
sichere Bühnentechnik gewann, die seine späteren Meisterwerke in
so hohem Maße auszeichnet. Sonst hat der Dichter selbst die
Der trügerische Glanz des Kriegsruhms ist selten so schwer
gebüßt worden, wie von den skandinavischen Nationen. Zur Zeit
des dreißigjährigen Krieges schien ihnen durch eine besondere Gunst
der Verhältnisse die militärische Herrschaft über das zerrissene
Deutschland gesichert zu sein; hundert Jahre später waren sie
schon auf dem Kriegstheater zu einer halb lächerlichen Rolle ver-
urtheilt, geschweige denn, daß sie an dem geistigen Leben Europas
noch irgend einen maßgebenden oder überhaupt nur nennenswerthen
Antheil gehabt hätten. Der Sturmwind der französischen Revo-
lution, der sonst die Literaturen aller europäischen Völker auf-
rüttelte, ließ die skandinavischen Länder fast unberührt.
Um so willenloser ergaben sie sich dem reaktionären Rückstrom.
Die skandinavische Literatur wurde ein fanatischer Schildknappe
der Romantik und blieb es selbst dann noch, als die Romantik
überall in Europa schon wieder abgewirthschastet hatte. Noch
im Jahre 1848 konnte die „Neue Rheinische Zeitung" mit Recht
sagen, daß Dänemark alle seine literarischen wie alle seine inate-
riellen Lebensmittel über Deutschland beziehe, aber daß Deutsch-
land progressiv und revolutionär sei, verglichen mit Dänemark.
Den Skandinavismus, die einzige originale Bewegung der skan-
dinavischen Länder, kennzeichnete das revolutionäre Blatt als die
Begeisterung für die brutale, schmutzige, seeräuberische, altnordische
Nationalität, für jene tiefe Innerlichkeit, die ihre überschwäng-
lichen Gedanken und Gefühle nicht in Worte bringen könne, wohl
aber in Thaten, nämlich in Rohheit gegen Frauenzimmer, per-
manente Betrunkenheit und mit thränenreicher Sentimentalität
abwechselnde Berserkerwuth. So scharf diese Ausdrücke waren,
so wenig mochten sie übertrieben sein; als zwanzig Jahre später
der junge Georg Brandes an der Kopenhagener Universität lite-
rarhistorische Vorlesungen hielt, worin er den Standpunkt der
bürgerlichen Aufklärungsliteratur vertrat, verfiel er einem allge-
meinen Ketzergericht, dessen blutdürstige, wenn auch glücklicher Weise
ohnmächtige Wildheit an die mittelalterliche Inquisition gemahnte.
Bis tief in die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
hinein herrschte in der skandinavischen Literatur die „romantische"
Richtung, die feindselige Abwendung voin Leben der Gegenwart,
die stete Rückkehr zu den Stoffen einer längst entschwundenen
Vorzeit, die Lust an allegorischer Märchendichtung, nicht zuletzt
auch ein phantastischer, bis zur weltfeindlichsten Askese ausarten-
der Mystizismus. Mit geringen Ausnahmen trug diese Literatur
einen dialektisch-polemischen Zug, der allen modernen Ideen tödt-
liche Feindschaft ansagte, ihren Vormarsch nicht nur als einen
Abfall vom christlichen Glauben, sondern auch als eine Auslösung
aller gesellschaftlichen und sittlichen Bande denunzirte. Gleichwohl
ließen sich die modernen Ideen nicht zurückhalten, als die kapi-
talistische Produktionsweise in den skandinavischen Ländern sieg-
reich vordrang und die noch so altersgrau-ehrwürdigen Zustände
unbarmherzig revolutionirte. Die Revolution der Zustände rief
die Revolution in den Köpfen hervor, und nach dem langen Winter
wehten die Winde des Frühlings um so frischer.
Die Führung aber in der nun endlich erwachenden Literatur
der skandinavischen Länder übernahm Norwegen, dank dem ur-
wüchsigen Kleinbauern- und Kleinbürgerthum, das seit mehreren
Jahrhunderten die herrschende Klasse der norwegischen Gesellschaft
gebildet hatte. Der norwegische Bauer war niemals, wie der
dänische und schwedische, leibeigen gewesen, und der norwegische
Kleinbürger stammte von freien Bauern ab; Norwegen war das
einzige Land, das sich nach dem Siege der europäischen Reaktion
bei Waterloo eine demokratische Verfassung bewahrt hatte. Freilich
hatte diese kleinbürgerliche Welt, die der Entwicklung der großen
Industrie, die der Börse und allen sonstigen Hebeln der Kapital-
konzentration keinen Raum bot, auch einen geistig beschränkten
Horizont, eben den Horizont eines Kleinbauern- und Kleinbürger-
thums ; allein als nun die moderne Produktionsweise das entlegene
Land in ihre Kreise zog, entfesselte sie ein kerngesundes und un-
gemein kräftiges Element, das im Sturmschritt aus den Tiefen
des romantischen Sumpfes auf die Höhen der modernen Gesell-
schaft zu marschiren verstand und eine letzte Schranke nur darin
fand, daß sich sein Pfad von diesen Höhen in die Wolken verlor.
Ein modernes Proletariat auf großer Stufenleiter konnte und
kann sich bei alledem nicht in Norwegen entwickeln; damit fehlt
dem revolutionärsten Dichter der norwegischen Literatur der
Schlüssel zu den tiefsten Problemen der Gegenwart, und so sagt
Henrik Ibsen: Das Fragen ist meine Sache, Antworten habe
ich nicht.
Aber so wie Ibsen seine Fragen zu stellen gewußt hat, ist er
ein europäischer Dichter vom ersten Range geworden.
Henrik Ibsen wurde am 20. März 1828 in Skien geboren,
einer jener kleinen norwegischen Küstenstädte, in denen sich der
salzige Geruch des Meeres mit dem Waldgeruch des Gebirges
mischt. Das Städtchen war eine berufene Stätte des Pietismus
und zugleich ein Mikrokosmos des modernen Handelsverkehrs, der
hier auf denkbar kleinstem Raume schon die grellsten sozialen Kon-
traste schuf. Wie nach Goethes Wort das Kind des Mannes
Vater ist, so hat Ibsen in seiner Vaterstadt unauslöschliche Jugend-
eindrücke empfangen; die einschneidendsten seiner sozialen Dramen
spielen sich in Orten ab, für die Skien als Typus gedient hat.
Jblen entstammte einer kleinbürgerlichen Familie und besuchte
bis zu seinem sechzehnten Lebensjahre die lateinische Schule, um
dann als Apothekerlehrling nach dem Städtchen Grimstad über-
zusiedeln. Hier leote er vier oder fünf Jahre und bereitete sich
für das Studentenexamen vor, das an der Universität Christiania
abgelegt werden mußte, um darnach Medizin zu studiren. Ehe
er aber so weit war, brachen die Stürme der Februarrevolution
aus und ergriffen den zwanzigjährigen Jüngling mächtig. Er
richtete feurige Gedichte an die rebellischen Ungarn und forderte
in einer langen Reihe von Sonetten den König von Schweden
auf, die dänischen Brüder mit den Waffen in der Hand gegen
die Deutschen zu unterstützen. Dabei darf jedoch nicht übersehen
werden, eininal, daß die eiderdänische Partei in Kopenhagen, die
zur Einverleibung der Elbherzogthümer drängte, die revolutionäre
Partei des kleinen Staates war, und dann, daß Ibsen sich dem
reaktionären Prinzip des Skandinavismus durchaus fern hielt,
wenn er auch die Unterstützung der stammverwandten Dänen gegen
die Deutschen wünschte. Seine nächste Zukunft gehörte dem
Emanzipationskampfe, durch den sich die norwegische Literatur aus
ihrer gänzlichen Abhängigkeit von der dänischen Literatur zu be-
freien versuchte.
Neben seiner revolutionären Jugendlyrik hatte er eine revo-
lutionäre Jugendtragödie „Katilina" geschrieben und unter einem
Pseudonym drucken lassen. Die Kritik nahm sie überwiegend un-
günstig auf, doch ließ sich Ibsen dadurch nicht entmuthigen, sondern
blieb seinen literarischen Neigungen treu, als er in Christiania
das Studentenexamen bestanden und die Universität bezogen hatte.
Immerhin war sein Name noch fast unbekannt, als er im Jahre 1852
zum Dramaturgen am „Norwegischen Theater" in Bergen berufen
wurde. In dieser Stellung blieb er bis zum Jahre 1857 und
dichtete zu jenem neuen Jahre ein neues Drama, wobei er jene
sichere Bühnentechnik gewann, die seine späteren Meisterwerke in
so hohem Maße auszeichnet. Sonst hat der Dichter selbst die