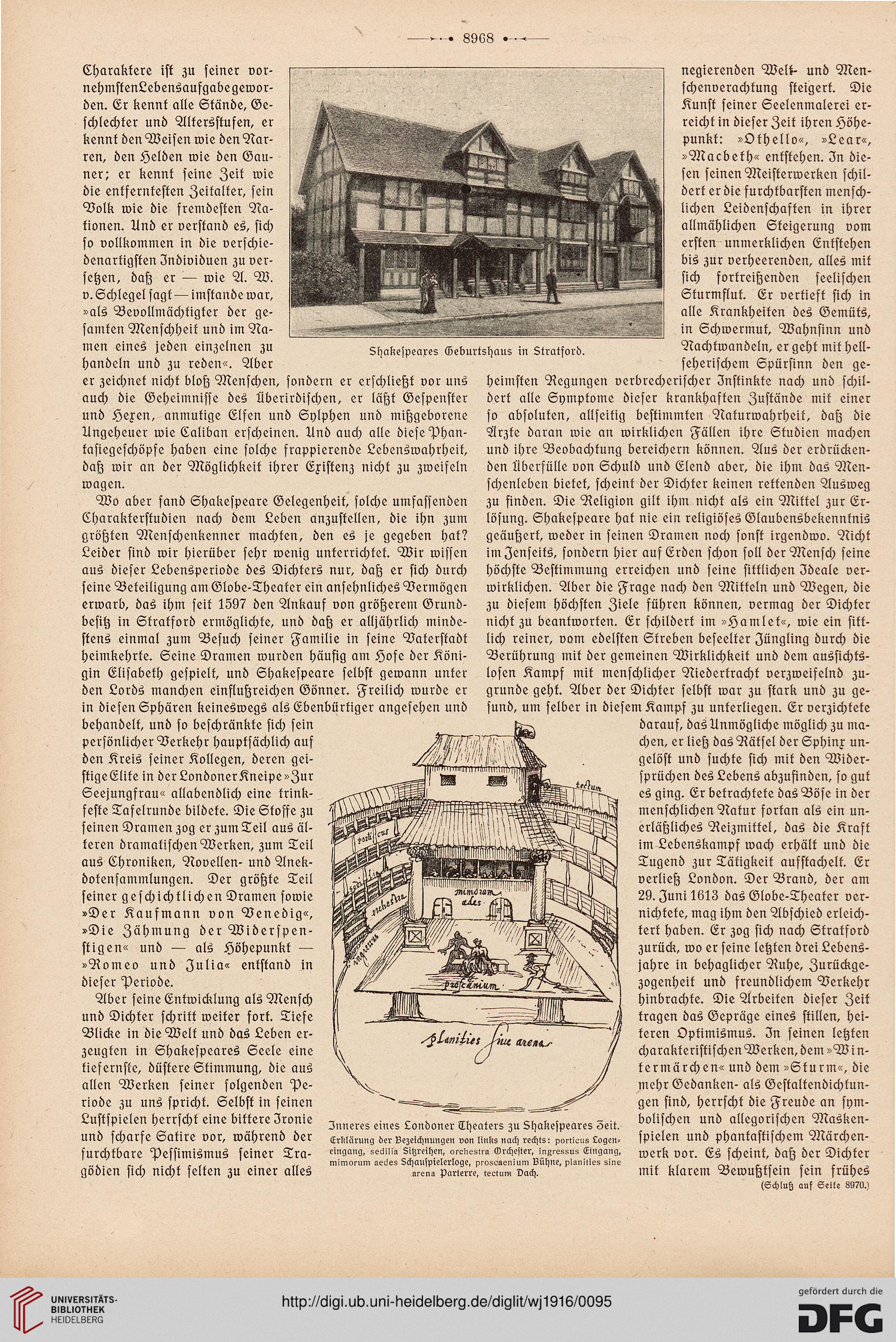->—- 8968
Charaktere ist zu seiner vor-
nehmstenLebensaufgabegewor-
den. Er kennt alle Stände, Ge-
schlechter und Altersstufen, er
kennt den Weisen wie den Nar-
ren, den Helden wie den Gau-
ner: er kennt seine Zeit wie
die entferntesten Zeitalter, sein
Volk wie die fremdesten Na-
tionen. Und er verstand es, sich
so vollkommen in die verschie-
denartigsten Individuen zu ver-
sehen, daß er — wie A. W.
v. Schlegel sagt — imstande war,
»als Bevollmächtigter der ge-
samten Menschheit und im Na-
men eines jeden einzelnen zu
handeln und zu reden«. Aber
er zeichnet nicht bloß Menschen, sondern er erschließt vor uns
auch die Geheimnisse des Überirdischen, er läßt Gespenster
und Hexen, anmutige Elfen und Sylphen und mißgeborene
Ungeheuer wie Caliban erscheinen. Und auch alle diese Phan-
tasiegeschöpfe haben eine solche frappierende Lebenswahrheit,
daß wir an der Möglichkeit ihrer Existenz nicht zu zweifeln
wagen.
Mo aber fand Shakespeare Gelegenheit, solche umfassenden
Charakterstudien nach dem Leben anzustellen, die ihn zum
größten Menschenkenner machten, den es je gegeben hat?
Leider sind wir hierüber sehr wenig unterrichtet. Wir wissen
aus dieser Lebensperiode des Dichters nur, daß er sich durch
seine Beteiligung am Globe-Theater ein ansehnliches Vermögen
erwarb, das ihm seit 1597 den Ankauf von größerem Grund-
besitz in Stratford ermöglichte, und daß er alljährlich minde-
stens einmal zum Besuch seiner Familie in seine Vaterstadt
heimkehrte. Seine Dramen wurden häufig am Hofe der Köni-
gin Elisabeth gespielt, und Shakespeare selbst gewann unter
den Lords manchen einflußreichen Gönner. Freilich wurde er
in diesen Sphären keineswegs als Ebenbürtiger angesehen und
behandelt, und so beschränkte sich sein
persönlicher Verkehr hauptsächlich auf
den Kreis seiner Kollegen, deren gei-
stigeElite in derLondonerKneipe»Zur
Seejungfrau« allabendlich eine trink-
feste Tafelrunde bildete. Die Stoffe zu
seinen Dramen zog er zum Teil aus äl-
teren dramatischen Werken, zum Teil
aus Chroniken, Novellen- und Anek-
dotensammlungen. Der größte Teil
seiner geschichtlichen Dramen sowie
»Der Kaufmann von Venedig«,
»Die Zähmung der Widerspen-
stigen« und — als Höhepunkt —
»Romeo und Zulia« entstand in
dieser Periode.
Aber seine Entwicklung als Mensch
und Dichter schritt weiter fort. Tiefe
Blicke in die Welt und das Leben er-
zeugten in Shakespeares Seele eine
tiefernste, düstere Stimmung, die aus
allen Merken seiner folgenden Pe-
riode zu uns spricht. Selbst in seinen
Lustspielen herrscht eine bittere Ironie
und scharfe Satire vor, während der
furchtbare Pessimismus seiner Tra-
gödien sich nicht selten zu einer alles
negierenden Welt- und Men-
schenverachtung steigert. Die
Kunst seiner Seelenmalerei er-
reicht in dieser Zeit ihren Höhe-
punkt: »Othello«, »Lear«,
»Macbeth« entstehen. In die-
sen seinen Meisterwerken schil-
dert er die furchtbarsten mensch-
lichen Leidenschaften in ihrer
allmählichen Steigerung vom
ersten unmerklichen Entstehen
bis zur verheerenden, alles mit
sich fortreißenden seelischen
Sturmflut. Er vertieft sich in
alle Krankheiten des Gemüts,
in Schwermut, Wahnsinn und
Nachtwandeln, er geht mit hell-
seherischem Spürsinn den ge-
heimsten Regungen verbrecherischer Instinkte nach und schil-
dert alle Symptome dieser krankhaften Zustände mit einer
so absoluten, allseitig bestimmten Naturwahrheit, daß die
Ärzte daran wie an wirklichen Fällen ihre Studien machen
und ihre Beobachtung bereichern können. Aus der erdrücken-
den überfülle von Schuld und Elend aber, die ihm daS Men-
schenleben bietet, scheint der Dichter keinen rettenden Ausweg
zu finden. Die Religion gilt ihm nicht als ein Mittel zur Er-
lösung. Shakespeare hat nie ein religiöses Glaubensbekenntnis
geäußert, weder in seinen Dramen noch sonst irgendwo. Nicht
im Jenseits, sondern hier auf Erden schon soll der Mensch seine
höchste Bestimmung erreichen und seine sittlichen Ideale ver-
wirklichen. Aber die Frage nach den Mitteln und Wegen, die
zu diesem höchsten Ziele führen können, vermag der Dichter
nicht zu beantworten. Er schildert im »Hamlet«, wie ein sitt-
lich reiner, vom edelsten Streben beseelter Jüngling durch die
Berührung mit der gemeinen Wirklichkeit und dem aussichts-
losen Kampf mit menschlicher Niedertracht verzweifelnd zu-
grunde geht. Aber der Dichter selbst war zu stark und zu ge-
sund, um selber in diesem Kampf zu unterliegen. Er verzichtete
darauf, das Unmögliche möglich zu ma-
chen, er ließ das Rätsel der Sphinx un-
gelöst und suchte sich mit den Wider-
sprüchen des Lebens abzufinden, so gut
es ging. Er betrachtete das Böse in der
menschlichen Natur fortan als ein un-
erläßliches Reizmittel, das die Kraft
im Lebenskampf wach erhält und die
Tugend zur Tätigkeit aufstachelt. Er
verließ London. Der Brand, der am
29. Zuni 1613 das Globe-Theater ver-
nichtete, mag ihm den Abschied erleich-
tert haben. Er zog sich nach Stratford
zurück, wo er seine letzten drei Lebens-
jahre in behaglicher Ruhe, Zurückge-
zogenheit und freundlichem Verkehr
hinbrachte. Die Arbeiten dieser Zeit
tragen das Gepräge eines stillen, hei-
teren Optimismus. In seinen letzten
charakteristischen Werken, dem »W i n-
termärchen« und dem »Sturm«, die
mehr Gedanken- als Gestaltendichtun-
gen sind, herrscht die Freude an sym-
bolischen und allegorischen Masken-
spielen und phantastischem Märchen-
werk vor. Es scheint, daß der Dichter
mit klarem Bewußtsein sein frühes
(Schluß auf Seile 8970.)
Shakespeares Geburtshaus in Stratford.
Inneres eines Londoner Theaters zu Shakespeares Zeit.
Erklärung der Bezeichnungen von links nach rechts: portieus Logen-
eingang, sedilia Litzreihen, orchestra Orchester, ingressus Eingang,
mimorum aedes Lchauspielerloge, proscaenium Bühne, planities sine
arena parterre, tectum Dach.
Charaktere ist zu seiner vor-
nehmstenLebensaufgabegewor-
den. Er kennt alle Stände, Ge-
schlechter und Altersstufen, er
kennt den Weisen wie den Nar-
ren, den Helden wie den Gau-
ner: er kennt seine Zeit wie
die entferntesten Zeitalter, sein
Volk wie die fremdesten Na-
tionen. Und er verstand es, sich
so vollkommen in die verschie-
denartigsten Individuen zu ver-
sehen, daß er — wie A. W.
v. Schlegel sagt — imstande war,
»als Bevollmächtigter der ge-
samten Menschheit und im Na-
men eines jeden einzelnen zu
handeln und zu reden«. Aber
er zeichnet nicht bloß Menschen, sondern er erschließt vor uns
auch die Geheimnisse des Überirdischen, er läßt Gespenster
und Hexen, anmutige Elfen und Sylphen und mißgeborene
Ungeheuer wie Caliban erscheinen. Und auch alle diese Phan-
tasiegeschöpfe haben eine solche frappierende Lebenswahrheit,
daß wir an der Möglichkeit ihrer Existenz nicht zu zweifeln
wagen.
Mo aber fand Shakespeare Gelegenheit, solche umfassenden
Charakterstudien nach dem Leben anzustellen, die ihn zum
größten Menschenkenner machten, den es je gegeben hat?
Leider sind wir hierüber sehr wenig unterrichtet. Wir wissen
aus dieser Lebensperiode des Dichters nur, daß er sich durch
seine Beteiligung am Globe-Theater ein ansehnliches Vermögen
erwarb, das ihm seit 1597 den Ankauf von größerem Grund-
besitz in Stratford ermöglichte, und daß er alljährlich minde-
stens einmal zum Besuch seiner Familie in seine Vaterstadt
heimkehrte. Seine Dramen wurden häufig am Hofe der Köni-
gin Elisabeth gespielt, und Shakespeare selbst gewann unter
den Lords manchen einflußreichen Gönner. Freilich wurde er
in diesen Sphären keineswegs als Ebenbürtiger angesehen und
behandelt, und so beschränkte sich sein
persönlicher Verkehr hauptsächlich auf
den Kreis seiner Kollegen, deren gei-
stigeElite in derLondonerKneipe»Zur
Seejungfrau« allabendlich eine trink-
feste Tafelrunde bildete. Die Stoffe zu
seinen Dramen zog er zum Teil aus äl-
teren dramatischen Werken, zum Teil
aus Chroniken, Novellen- und Anek-
dotensammlungen. Der größte Teil
seiner geschichtlichen Dramen sowie
»Der Kaufmann von Venedig«,
»Die Zähmung der Widerspen-
stigen« und — als Höhepunkt —
»Romeo und Zulia« entstand in
dieser Periode.
Aber seine Entwicklung als Mensch
und Dichter schritt weiter fort. Tiefe
Blicke in die Welt und das Leben er-
zeugten in Shakespeares Seele eine
tiefernste, düstere Stimmung, die aus
allen Merken seiner folgenden Pe-
riode zu uns spricht. Selbst in seinen
Lustspielen herrscht eine bittere Ironie
und scharfe Satire vor, während der
furchtbare Pessimismus seiner Tra-
gödien sich nicht selten zu einer alles
negierenden Welt- und Men-
schenverachtung steigert. Die
Kunst seiner Seelenmalerei er-
reicht in dieser Zeit ihren Höhe-
punkt: »Othello«, »Lear«,
»Macbeth« entstehen. In die-
sen seinen Meisterwerken schil-
dert er die furchtbarsten mensch-
lichen Leidenschaften in ihrer
allmählichen Steigerung vom
ersten unmerklichen Entstehen
bis zur verheerenden, alles mit
sich fortreißenden seelischen
Sturmflut. Er vertieft sich in
alle Krankheiten des Gemüts,
in Schwermut, Wahnsinn und
Nachtwandeln, er geht mit hell-
seherischem Spürsinn den ge-
heimsten Regungen verbrecherischer Instinkte nach und schil-
dert alle Symptome dieser krankhaften Zustände mit einer
so absoluten, allseitig bestimmten Naturwahrheit, daß die
Ärzte daran wie an wirklichen Fällen ihre Studien machen
und ihre Beobachtung bereichern können. Aus der erdrücken-
den überfülle von Schuld und Elend aber, die ihm daS Men-
schenleben bietet, scheint der Dichter keinen rettenden Ausweg
zu finden. Die Religion gilt ihm nicht als ein Mittel zur Er-
lösung. Shakespeare hat nie ein religiöses Glaubensbekenntnis
geäußert, weder in seinen Dramen noch sonst irgendwo. Nicht
im Jenseits, sondern hier auf Erden schon soll der Mensch seine
höchste Bestimmung erreichen und seine sittlichen Ideale ver-
wirklichen. Aber die Frage nach den Mitteln und Wegen, die
zu diesem höchsten Ziele führen können, vermag der Dichter
nicht zu beantworten. Er schildert im »Hamlet«, wie ein sitt-
lich reiner, vom edelsten Streben beseelter Jüngling durch die
Berührung mit der gemeinen Wirklichkeit und dem aussichts-
losen Kampf mit menschlicher Niedertracht verzweifelnd zu-
grunde geht. Aber der Dichter selbst war zu stark und zu ge-
sund, um selber in diesem Kampf zu unterliegen. Er verzichtete
darauf, das Unmögliche möglich zu ma-
chen, er ließ das Rätsel der Sphinx un-
gelöst und suchte sich mit den Wider-
sprüchen des Lebens abzufinden, so gut
es ging. Er betrachtete das Böse in der
menschlichen Natur fortan als ein un-
erläßliches Reizmittel, das die Kraft
im Lebenskampf wach erhält und die
Tugend zur Tätigkeit aufstachelt. Er
verließ London. Der Brand, der am
29. Zuni 1613 das Globe-Theater ver-
nichtete, mag ihm den Abschied erleich-
tert haben. Er zog sich nach Stratford
zurück, wo er seine letzten drei Lebens-
jahre in behaglicher Ruhe, Zurückge-
zogenheit und freundlichem Verkehr
hinbrachte. Die Arbeiten dieser Zeit
tragen das Gepräge eines stillen, hei-
teren Optimismus. In seinen letzten
charakteristischen Werken, dem »W i n-
termärchen« und dem »Sturm«, die
mehr Gedanken- als Gestaltendichtun-
gen sind, herrscht die Freude an sym-
bolischen und allegorischen Masken-
spielen und phantastischem Märchen-
werk vor. Es scheint, daß der Dichter
mit klarem Bewußtsein sein frühes
(Schluß auf Seile 8970.)
Shakespeares Geburtshaus in Stratford.
Inneres eines Londoner Theaters zu Shakespeares Zeit.
Erklärung der Bezeichnungen von links nach rechts: portieus Logen-
eingang, sedilia Litzreihen, orchestra Orchester, ingressus Eingang,
mimorum aedes Lchauspielerloge, proscaenium Bühne, planities sine
arena parterre, tectum Dach.