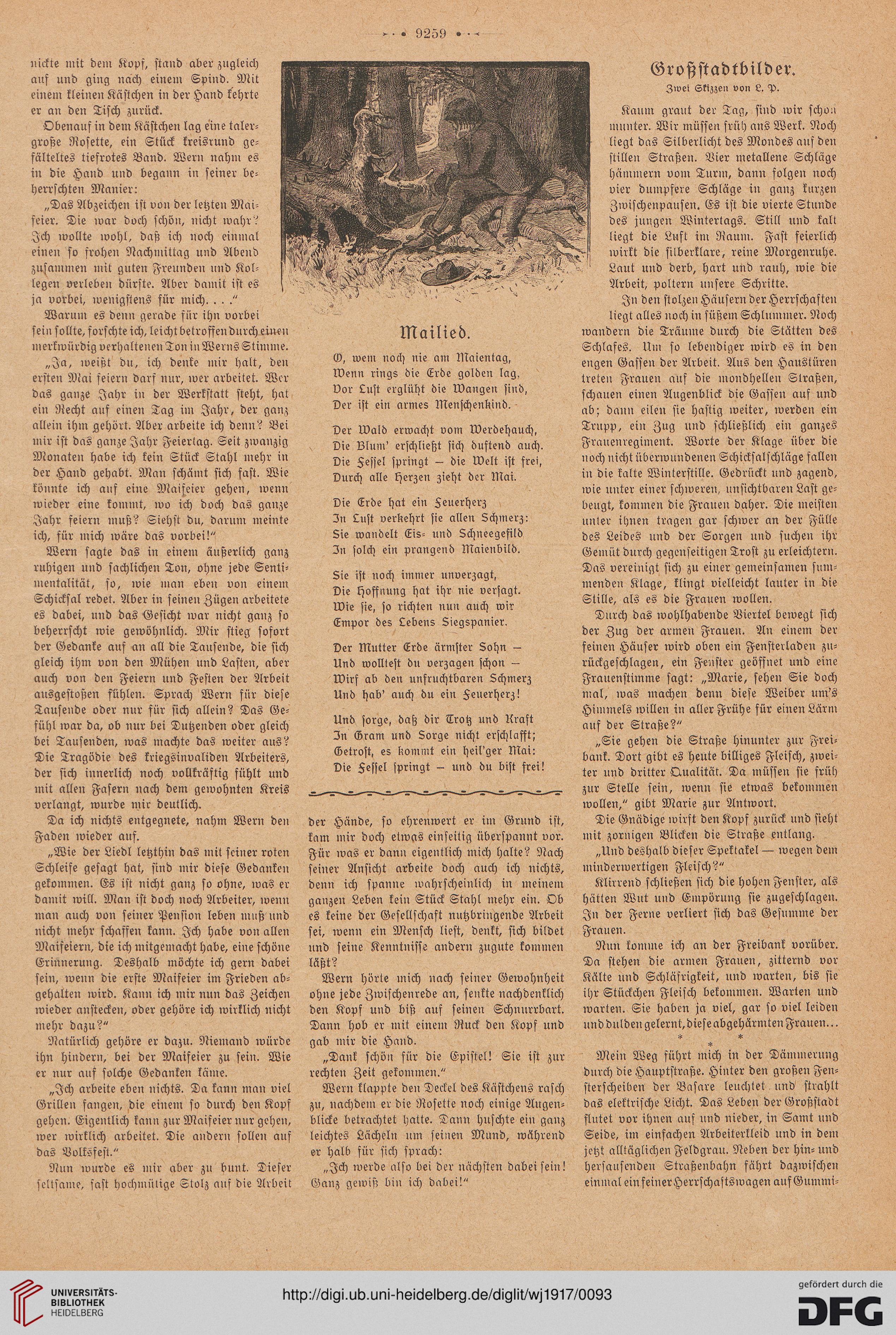9259
nickte mit dein Kopf, stand aber zngleich
ans und ging nach einem Spind. Mit
einem kleinen Kästchen in der Hand kehrte
er an den Tisch zurück.
Obenauf in dem Kästchen lag eine taler-
große Rosette, ein Stück kreisrund ge-
fälteltes tiefrotes Band. Wern nahm es
in die Hand und begann in seiner be-
herrschten Manier:
„Das Abzeichen ist von der letzten Mai-
feier. Die >var doch schön, nicht wahr?
Ich wollte >vohl, daß ich noch einmal
einen so frohen Nachinittag und Abend
zusammen mit guten Freunden und Kol-
legen verleben dürste. Aber damit ist es
ja vorbei, ivenigstens für mich. . . ."
Warum es denn gerade für ihn vorbei
sein sollte, forschte ich, leicht betroffen durch euren
merkwürdig verhaltenen To» in Werns Stimme.
„Ja, iveißt du, ich denke mir halt, den
ersten Aiai feiern darf nur, iver arbeitet. Wer
das ganze Jahr in der Werkstatt steht, hat
ein Recht auf einen Tag im Jahr, der ganz
allein ihm gehört. Aber arbeite ich denn? Bei
mir ist das ganze Jahr Feiertag. Seit zivanzig
Monaten habe ich kein Stück Stahl mehr in
der Hand gehabt. Man schämt sich fast. Wie
konnte ich auf eine Maifeier gehen, ivenn
wieder eine kommt, wo ich doch das ganze
Jahr feiern muß? Siehst du, darum meinte
ich, für mich wäre das vorbei!"
Wern sagte das in einem äußerlich ganz
ruhigen und sachlichen Ton, ohne jede Senti-
mentalität, so, wie man eben von einem
Schicksal redet. Aber in seinen Zügen arbeitete
es dabei, und das Gesicht ivar nicht ganz so
beherrscht wie gewöhnlich. Mir stieg sofort
der Gedanke auf an all die Tausende, die sich
gleich ihm von den Mühen und Lasten, aber
auch von den Feiern und Festen der Arbeit
ausgestoßen fühlen. Sprach Wern für diese
Tausende oder nur für sich allein? Das Ge-
fühl war da, ob nur bei Dutzenden oder gleich
bei Tausenden, was machte das weiter aus?
Die Tragödie des kriegsinvaliden Arbeiters,
der sich innerlich noch vollkräftig fühlt und
mit allen Fasern nach dem gewohnten Kreis
verlangt, wurde mir deutlich.
Da ich nichts entgegnete, nahm Wern den
Faden ivieder auf.
„Wie der Liedl letzthin das mit seiner roten
Schleife gesagt hat, sind mir diese Gedanken
gekommen. Es ist nicht ganz so ohne, was er
damit will. Man ist doch noch Arbeiter, wenn
man auch von seiner Pension leben muß und
nicht mehr schaffen kann. Ich habe von allen
Maifeiern, die ich mitgemacht habe, eine schöne
Erinnerung. Deshalb möchte ich gern dabei
sein, wenn die erste Maifeier im Frieden ab-
gehalten wird. Kann ich mir nun das Zeichen
wieder anstecke», oder gehöre ich wirklich nicht
mehr dazu?"
Natürlich gehöre er dazu. Niemand würde
ihn hindern, bei der Maifeier zu sein. Wie
er nur auf solche Gedanken käme.
„Ich arbeite eben nichts. Da kann man viel
Grillen fangen, die einem so durch den Kopf
gehen. Eigentlich kann zur Maifeier nur gehen,
wer wirklich arbeitet. Die andern sollen auf
das Volksfest."
Nun wurde es mir aber zu bunt. Dieser
seltsame, fast hochmütige Stolz auf die Arbeit
Mailied.
®, wem noch nie am llkaientag,
kvenn rings die Erde golden lag.
vor Lust erglüht die Ivangen sind,
Der ist ein armes Menschenkind.
Der lvaid erwacht vom lverdehauch,
vie Blum’ erschließt sich duftend auch.
Die Fessel springt — die lvelt ist frei,
Durch alle kserzen zieht der lllai.
vie Erde hat ei» Feuerherz
In Lust verkehrt sie allen Schmerz:
Sie wandelt Eis- und Schneegefitd
In solch ein prangend Maienbitd.
Sie ist noch immer unverzagt,
Vie Hoffnung hat ihr nie versagt,
wie sie, so richten nun auch wir
Empor des Lebens Siegspanier.
Der Mutter Erde ärmster Sohn —
Und wolltest du verzagen schon —
wirf ab den unfruchtbaren Schmerz
Und Hab' auch du ein Feuerherz!
Und sorge, daß dir Trotz und Urast
In Gram und Sorge nicht erjdjlafft;
Getrost, es kommt ein heil’ger Mai:
Die Fessel springt - und du bist frei!
der Hände, so ehrenwert er im Grund ist,
kam mir doch etwas einseitig überspannt vor.
Für was er dann eigentlich mich halte? Nach
seiner Ansicht arbeite doch auch ich nichts,
denn ich spanne ivahrscheinlich in meinem
ganzen Leben kein Stück Stahl mehr ein. Ob
es keine der Gesellschaft nutzbringende Arbeit
sei, wenn ein Mensch liest, denkt, sich bildet
und seine Kenntnisse andern zugute kommen
läßt?
Wern hörte mich nach seiner Gewohnheit
ohne jede Zwischenrede an, senkte nachdenklich
den Kopf und biß auf seine» Schnurrbart.
Dann hob er mit einem Ruck den Kopf und
gab mir die Hand.
„Dank schön für die Epistel! Sie ist zur
rechten Zeit gekommen."
Wern klappte den Deckel des Kästchens rasch
zu, nachdem er die Rosette noch einige Augen-
blicke betrachtet hatte. Dann huschte ein ganz
leichtes Lächeln um seinen Mund, während
er halb für sich sprach:
„Ich werde also bei der nächsten dabei sein!
Ganz gewiß bin ich dabei!"
Großstadtbilder.
Zwei Skizzen von L. P.
Kaum graut der Tag, sind wir schon
munter. Wir müssen früh ans Werk. Noch
liegt das Silberlicht des Mondes auf den
stillen Straßen. Bier metallene Schläge
hämmern vom Turni, dann folgen noch
vier dumpfere Schläge in ganz kurzen
Zwischenpausen. Es ist die vierte Stiinde
des jungen Wintertags. Still und kalt
liegt die Luft im Raum. Fast feierlich
wirft die silberklare, reine Morgenruhe.
Laut und derb, hart und rauh, wie die
Arbeit, poltern unsere Schritte.
In den stolzen Häusern der Herrschaften
liegt alles noch in süßem Schlummer. Noch
wandern die Träume durch die Stätten des
Schlafes. Ui» so lebendiger wird es in den
engen Gassen der Arbeit. Aus den Haustüren
treten Frauen ans die mondhellen Straßen,
schauen einen Augenblick die Gassen auf und
ab; dann eilen sie hastig weiter, ,verden ein
Trupp, ein Zug und schließlich ein ganzes
Frauenregiment. Worte der Klage über die
noch nicht überwundenen Schicksalschläge fallen
in die kalte Winterstille. Gedrückt und zagend,
wie unter einer schweren, unsichtbaren Last ge-
beugt, kommen die Frauen daher. Die meisten
unter ihnen tragen gar schwer an der Fülle
des Leides und der Sorgen und suchen ihr
Gemüt durch gegenseitigen Trost zu erleichtern.
Das vereinigt sich zu einer gemeinsamen sum-
menden Klage, klingt vielleicht lauter in die
Stille, als es die Frauen ivollen.
Diirch das wohlhabende Viertel beivegt sich
der Zug der armen Frauen. An einem der
feinen Häuser wird oben ein Fensterladen zu-
rückgeschlagen, ein Fenster geöffnet und eine
Frauenstimme sagt: „Marie, sehen Sie doch
n:al, was machen denn diese Weiber um's
Himmels willen in aller Frühe für einen Lärm
auf der Straße?"
„Sie gehen die Straße hinunter zur Frei-
bank. Dort gibt es heute billiges Fleisch, zwei-
ter und dritter Qualität. Da müssen sie früh
zur Stelle sein, wenn sie etwas bekommen
wollen," gibt Marie zur Antwort.
Die Gnädige wirft den Kopf zurück und steht
mit zornigen Blicke» die Straße entlang.
„Und deshalb dieser Spektakel — wegen dein
minderwertigen Fleisch?"
Klirrend schließen sich die hohen Fenster, als
hätten Wut und Empörung sie zugeschlagen.
In der Ferne verliert sich das Gesumme der
Frauen.
Nun komme ich an der Freibank vorüber.
Da stehen die armen Frauen, zitternd vor
Kälte und Schläfrigkeit, und warten, bis sie
ihr Stückchen Fleisch bekommen. Warten und
warten. Sie haben ja viel, gar so viel leiden
und dulde» gelernt, diese abgehärmten Frauen...
Mein Weg führt mich in der Dämmerung
durch die Hauptstraße. Hinter den großen Fen-
sterscheiben der Basare leuchtet und strahlt
das elektrische Licht. Das Leben der Großstadt
flutet vor ihnen auf und nieder, in Samt und
Seide, im einfachen Arbeiterkleid und in dem
jetzt alltäglichen Feldgrau. Neben der hin- und
hersausenden Straßenbahn fährt dazwischen
einmal einfeinerHerrschastswagen aufGummi-
nickte mit dein Kopf, stand aber zngleich
ans und ging nach einem Spind. Mit
einem kleinen Kästchen in der Hand kehrte
er an den Tisch zurück.
Obenauf in dem Kästchen lag eine taler-
große Rosette, ein Stück kreisrund ge-
fälteltes tiefrotes Band. Wern nahm es
in die Hand und begann in seiner be-
herrschten Manier:
„Das Abzeichen ist von der letzten Mai-
feier. Die >var doch schön, nicht wahr?
Ich wollte >vohl, daß ich noch einmal
einen so frohen Nachinittag und Abend
zusammen mit guten Freunden und Kol-
legen verleben dürste. Aber damit ist es
ja vorbei, ivenigstens für mich. . . ."
Warum es denn gerade für ihn vorbei
sein sollte, forschte ich, leicht betroffen durch euren
merkwürdig verhaltenen To» in Werns Stimme.
„Ja, iveißt du, ich denke mir halt, den
ersten Aiai feiern darf nur, iver arbeitet. Wer
das ganze Jahr in der Werkstatt steht, hat
ein Recht auf einen Tag im Jahr, der ganz
allein ihm gehört. Aber arbeite ich denn? Bei
mir ist das ganze Jahr Feiertag. Seit zivanzig
Monaten habe ich kein Stück Stahl mehr in
der Hand gehabt. Man schämt sich fast. Wie
konnte ich auf eine Maifeier gehen, ivenn
wieder eine kommt, wo ich doch das ganze
Jahr feiern muß? Siehst du, darum meinte
ich, für mich wäre das vorbei!"
Wern sagte das in einem äußerlich ganz
ruhigen und sachlichen Ton, ohne jede Senti-
mentalität, so, wie man eben von einem
Schicksal redet. Aber in seinen Zügen arbeitete
es dabei, und das Gesicht ivar nicht ganz so
beherrscht wie gewöhnlich. Mir stieg sofort
der Gedanke auf an all die Tausende, die sich
gleich ihm von den Mühen und Lasten, aber
auch von den Feiern und Festen der Arbeit
ausgestoßen fühlen. Sprach Wern für diese
Tausende oder nur für sich allein? Das Ge-
fühl war da, ob nur bei Dutzenden oder gleich
bei Tausenden, was machte das weiter aus?
Die Tragödie des kriegsinvaliden Arbeiters,
der sich innerlich noch vollkräftig fühlt und
mit allen Fasern nach dem gewohnten Kreis
verlangt, wurde mir deutlich.
Da ich nichts entgegnete, nahm Wern den
Faden ivieder auf.
„Wie der Liedl letzthin das mit seiner roten
Schleife gesagt hat, sind mir diese Gedanken
gekommen. Es ist nicht ganz so ohne, was er
damit will. Man ist doch noch Arbeiter, wenn
man auch von seiner Pension leben muß und
nicht mehr schaffen kann. Ich habe von allen
Maifeiern, die ich mitgemacht habe, eine schöne
Erinnerung. Deshalb möchte ich gern dabei
sein, wenn die erste Maifeier im Frieden ab-
gehalten wird. Kann ich mir nun das Zeichen
wieder anstecke», oder gehöre ich wirklich nicht
mehr dazu?"
Natürlich gehöre er dazu. Niemand würde
ihn hindern, bei der Maifeier zu sein. Wie
er nur auf solche Gedanken käme.
„Ich arbeite eben nichts. Da kann man viel
Grillen fangen, die einem so durch den Kopf
gehen. Eigentlich kann zur Maifeier nur gehen,
wer wirklich arbeitet. Die andern sollen auf
das Volksfest."
Nun wurde es mir aber zu bunt. Dieser
seltsame, fast hochmütige Stolz auf die Arbeit
Mailied.
®, wem noch nie am llkaientag,
kvenn rings die Erde golden lag.
vor Lust erglüht die Ivangen sind,
Der ist ein armes Menschenkind.
Der lvaid erwacht vom lverdehauch,
vie Blum’ erschließt sich duftend auch.
Die Fessel springt — die lvelt ist frei,
Durch alle kserzen zieht der lllai.
vie Erde hat ei» Feuerherz
In Lust verkehrt sie allen Schmerz:
Sie wandelt Eis- und Schneegefitd
In solch ein prangend Maienbitd.
Sie ist noch immer unverzagt,
Vie Hoffnung hat ihr nie versagt,
wie sie, so richten nun auch wir
Empor des Lebens Siegspanier.
Der Mutter Erde ärmster Sohn —
Und wolltest du verzagen schon —
wirf ab den unfruchtbaren Schmerz
Und Hab' auch du ein Feuerherz!
Und sorge, daß dir Trotz und Urast
In Gram und Sorge nicht erjdjlafft;
Getrost, es kommt ein heil’ger Mai:
Die Fessel springt - und du bist frei!
der Hände, so ehrenwert er im Grund ist,
kam mir doch etwas einseitig überspannt vor.
Für was er dann eigentlich mich halte? Nach
seiner Ansicht arbeite doch auch ich nichts,
denn ich spanne ivahrscheinlich in meinem
ganzen Leben kein Stück Stahl mehr ein. Ob
es keine der Gesellschaft nutzbringende Arbeit
sei, wenn ein Mensch liest, denkt, sich bildet
und seine Kenntnisse andern zugute kommen
läßt?
Wern hörte mich nach seiner Gewohnheit
ohne jede Zwischenrede an, senkte nachdenklich
den Kopf und biß auf seine» Schnurrbart.
Dann hob er mit einem Ruck den Kopf und
gab mir die Hand.
„Dank schön für die Epistel! Sie ist zur
rechten Zeit gekommen."
Wern klappte den Deckel des Kästchens rasch
zu, nachdem er die Rosette noch einige Augen-
blicke betrachtet hatte. Dann huschte ein ganz
leichtes Lächeln um seinen Mund, während
er halb für sich sprach:
„Ich werde also bei der nächsten dabei sein!
Ganz gewiß bin ich dabei!"
Großstadtbilder.
Zwei Skizzen von L. P.
Kaum graut der Tag, sind wir schon
munter. Wir müssen früh ans Werk. Noch
liegt das Silberlicht des Mondes auf den
stillen Straßen. Bier metallene Schläge
hämmern vom Turni, dann folgen noch
vier dumpfere Schläge in ganz kurzen
Zwischenpausen. Es ist die vierte Stiinde
des jungen Wintertags. Still und kalt
liegt die Luft im Raum. Fast feierlich
wirft die silberklare, reine Morgenruhe.
Laut und derb, hart und rauh, wie die
Arbeit, poltern unsere Schritte.
In den stolzen Häusern der Herrschaften
liegt alles noch in süßem Schlummer. Noch
wandern die Träume durch die Stätten des
Schlafes. Ui» so lebendiger wird es in den
engen Gassen der Arbeit. Aus den Haustüren
treten Frauen ans die mondhellen Straßen,
schauen einen Augenblick die Gassen auf und
ab; dann eilen sie hastig weiter, ,verden ein
Trupp, ein Zug und schließlich ein ganzes
Frauenregiment. Worte der Klage über die
noch nicht überwundenen Schicksalschläge fallen
in die kalte Winterstille. Gedrückt und zagend,
wie unter einer schweren, unsichtbaren Last ge-
beugt, kommen die Frauen daher. Die meisten
unter ihnen tragen gar schwer an der Fülle
des Leides und der Sorgen und suchen ihr
Gemüt durch gegenseitigen Trost zu erleichtern.
Das vereinigt sich zu einer gemeinsamen sum-
menden Klage, klingt vielleicht lauter in die
Stille, als es die Frauen ivollen.
Diirch das wohlhabende Viertel beivegt sich
der Zug der armen Frauen. An einem der
feinen Häuser wird oben ein Fensterladen zu-
rückgeschlagen, ein Fenster geöffnet und eine
Frauenstimme sagt: „Marie, sehen Sie doch
n:al, was machen denn diese Weiber um's
Himmels willen in aller Frühe für einen Lärm
auf der Straße?"
„Sie gehen die Straße hinunter zur Frei-
bank. Dort gibt es heute billiges Fleisch, zwei-
ter und dritter Qualität. Da müssen sie früh
zur Stelle sein, wenn sie etwas bekommen
wollen," gibt Marie zur Antwort.
Die Gnädige wirft den Kopf zurück und steht
mit zornigen Blicke» die Straße entlang.
„Und deshalb dieser Spektakel — wegen dein
minderwertigen Fleisch?"
Klirrend schließen sich die hohen Fenster, als
hätten Wut und Empörung sie zugeschlagen.
In der Ferne verliert sich das Gesumme der
Frauen.
Nun komme ich an der Freibank vorüber.
Da stehen die armen Frauen, zitternd vor
Kälte und Schläfrigkeit, und warten, bis sie
ihr Stückchen Fleisch bekommen. Warten und
warten. Sie haben ja viel, gar so viel leiden
und dulde» gelernt, diese abgehärmten Frauen...
Mein Weg führt mich in der Dämmerung
durch die Hauptstraße. Hinter den großen Fen-
sterscheiben der Basare leuchtet und strahlt
das elektrische Licht. Das Leben der Großstadt
flutet vor ihnen auf und nieder, in Samt und
Seide, im einfachen Arbeiterkleid und in dem
jetzt alltäglichen Feldgrau. Neben der hin- und
hersausenden Straßenbahn fährt dazwischen
einmal einfeinerHerrschastswagen aufGummi-