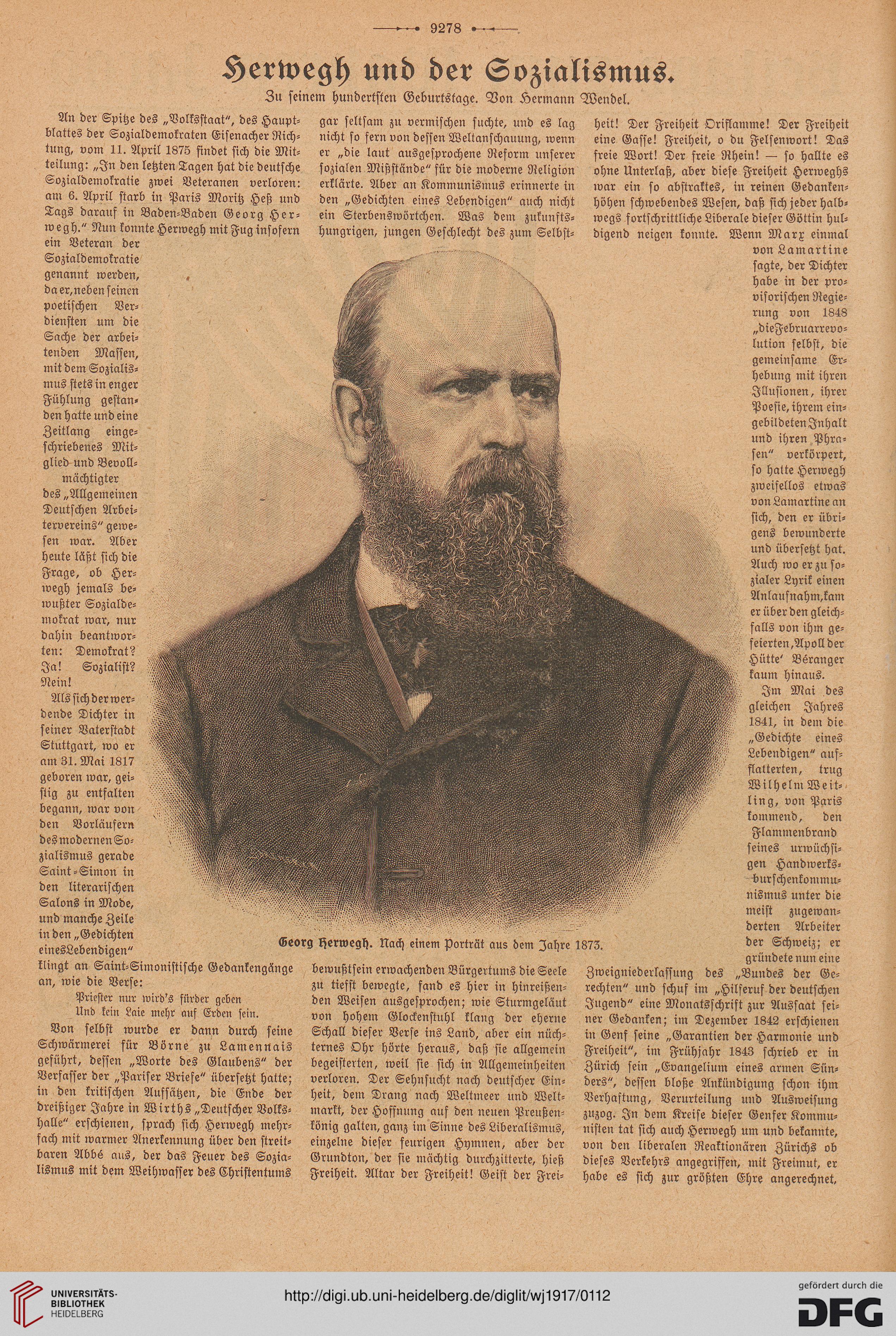9278
Herwegh und der Sozialismus.
Zu seinem hundertsten Geburtstage. Von Äermann Wendel.
An der Spitze des „Volksstaat", des Haupt-
blattes der Sozialdemokraten Eisenacher Rich-
tung, vom 11. April 1875 findet sich die Mit-
teilung: „In den letzten Tagen hat die deutsche
Sozialdemokratie zwei Veteranen verloren:
am 6. April starb in Paris Moritz Heß und
Tags darauf in Baden-Baden Georg Her-
me gh." Nun konnte Herwegh mit Fug insofern
ein Veteran der
Sozialdemokratie
genannt werden,
da er,neben seinen
poetischen Ver-
diensten um die
Sache der arbei-
tenden Massen,
mit dem Sozialis-
mus stets in enger
Fühlung gestan-
denhatte und eine
Zeitlang einge-
schriebenes Mit-
glied und Bevoll-
mächtigter
des „Allgemeinen
Deutschen Arbei-
tervereins" gewe-
sen war. Aber
heute läßt sich die
Frage, ob Her-
wegh jemals be-
wußter Sozialde-
mokrat war, nur
dahin beantwor-
ten: Demokrat?
Ja! Sozialist?
Nein!
Als sich der wer-
dende Dichter in
seiner Vaterstadt
Stuttgart, wo er
am 31. Mai 1817
geboren war, gei-
stig zu entfalten
begann, war von
den Vorläufern
desmodernenSo-
zialismus gerade
Saint-Simon in
den literarischen
Salons in Mode,
und manche Zeile
in den „Gedichten
einesLebendigen"
klingt an Saint-Simonistische Gedankengänge
an, wie die Verse:
Priester nur wird's fürder geben
Und kein Laie niehr auf Erde» sein.
Von selbst wurde er dann durch seine
Schwärmerei für Börne zu Lamennais
geführt, dessen „Worte des Glaubens" der
Verfasser der „Pariser Briefe" übersetzt hatte;
in den kritischen Aufsätzen, die Ende der
dreißiger Jahre in Wirths „Deutscher Volks-
Halle" erschienen, sprach sich Herwegh mehr-
fach mit warmer Anerkennung über den streit-
baren Abbö aus, der das Feuer des Sozia-
lismus mit dem Weihwasser des Christentums
heit! Der Freiheit Oriflamme! Der Freiheit
eine Gasse! Freiheit, o du Felsenwort! Das
freie Wort! Der freie Rhein! — so hallte es
ohne Unterlaß, aber diese Freiheit Herweghs
war ein so abstraktes, in reinen Gedanken-
höhen schwebendes Wesen, daß sich jeder halb-
wegs fortschrittliche Liberale dieser Göttin hul-
digend neigen konnte. Wenn Marx einmal
von Lamartine
sagte, der Dichter
habe in der pro-
visorischen Regie-
rung von 1848
„dieFebruarrevo-
lution selbst, die
gemeinsame Er-
hebung mit ihren
Illusionen, ihrer
Poesie, ihrem ein-
gebildeten Inhalt
und ihren Phra-
sen" verkörpert,
so hatte Herwegh
zweifellos etwas
von Lamartine an
sich, den er übri-
gens bewunderte
und übersetzt hat.
Auch wo er zu so-
zialer Lyrik einen
Anlaufnahm,kam
er überden gleich-
falls von ihm ge-
feierten,Apoll der
Hütte' Böranger
kaum hinaus.
Im Mai des
gleichen Jahres
1841, in dem die
„Gedichte eines
Lebendigen" auf-
flatterten, trug
Wilhelni Weit-
ling, von Paris
kommend, den
Flammenbrand
seines urwüchsi-
gen Handwerks-
burschenkommu-
nismus unter die
meist zugewan-
derten Arbeiter
der Schweiz; er
gründete nun eine
Zweigniederlassung des „Bundes der Ge-
rechten" und schuf im „Hilferuf der deutschen
Jugend" eine Monatsschrift zur Aussaat sei-
ner Gedanken; im Dezember 1842 erschienen
in Genf seine „Garantien der Harmonie und
Freiheit", im Frühjahr 1843 schrieb er in
Zürich sein „Evangelium eines armen Sün-
ders", dessen bloße Ankündigung schon ihm
Verhaftung, Verurteilung und Ausweisung
zuzog. In dem Kreise dieser Genfer Kommu-
nisten tat sich auch Herwegh um und bekannte,
von den liberalen Reaktionären Zürichs ob
dieses Verkehrs angegriffen, mit Freimut, er
habe es sich zur größten Ehre angerechnet,
gar seltsam zu vermischen suchte, und es lag
nicht so fern von dessen Weltanschauung, wenn
er „die laut ausgesprochene Reform unserer
sozialen Mißstände" für die moderne Religion
erklärte. Aber an Kommunismus erinnerte in
den „Gedichten eines Lebendigen" auch nicht
ein Sterbenswörtchen. Was dem zukunfts-
hungrigen, jungen Geschlecht des zum Selbst-
Georg herwegh. Nach einem Porträt aus dem Jahre 187Z.
bewußtsein erwachenden Bürgertums die Seele
zu tiefst bewegte, fand es hier in hinreißen-
den Weisen ausgesprochen; wie Sturmgeläut
von hohem Glockenstuhl klang der eherne
Schall dieser Verse ins Land, aber ein nüch-
ternes Ohr hörte heraus, daß sie allgemein
begeisterten, weil sie sich in Allgemeinheiten
verloren. Der Sehnsucht nach deutscher Ein-
heit, dem Drang nach Weltmeer und Welt-
markt, der Hoffnung auf den neuen Preußen-
könig galten, ganz im Sinne des Liberalismus,
einzelne dieser feurigen Hymnen, aber der
Grundton, der sie mächtig durchzitterte, hieß
Freiheit. Altar der Freiheit! Geist der Frei-
Herwegh und der Sozialismus.
Zu seinem hundertsten Geburtstage. Von Äermann Wendel.
An der Spitze des „Volksstaat", des Haupt-
blattes der Sozialdemokraten Eisenacher Rich-
tung, vom 11. April 1875 findet sich die Mit-
teilung: „In den letzten Tagen hat die deutsche
Sozialdemokratie zwei Veteranen verloren:
am 6. April starb in Paris Moritz Heß und
Tags darauf in Baden-Baden Georg Her-
me gh." Nun konnte Herwegh mit Fug insofern
ein Veteran der
Sozialdemokratie
genannt werden,
da er,neben seinen
poetischen Ver-
diensten um die
Sache der arbei-
tenden Massen,
mit dem Sozialis-
mus stets in enger
Fühlung gestan-
denhatte und eine
Zeitlang einge-
schriebenes Mit-
glied und Bevoll-
mächtigter
des „Allgemeinen
Deutschen Arbei-
tervereins" gewe-
sen war. Aber
heute läßt sich die
Frage, ob Her-
wegh jemals be-
wußter Sozialde-
mokrat war, nur
dahin beantwor-
ten: Demokrat?
Ja! Sozialist?
Nein!
Als sich der wer-
dende Dichter in
seiner Vaterstadt
Stuttgart, wo er
am 31. Mai 1817
geboren war, gei-
stig zu entfalten
begann, war von
den Vorläufern
desmodernenSo-
zialismus gerade
Saint-Simon in
den literarischen
Salons in Mode,
und manche Zeile
in den „Gedichten
einesLebendigen"
klingt an Saint-Simonistische Gedankengänge
an, wie die Verse:
Priester nur wird's fürder geben
Und kein Laie niehr auf Erde» sein.
Von selbst wurde er dann durch seine
Schwärmerei für Börne zu Lamennais
geführt, dessen „Worte des Glaubens" der
Verfasser der „Pariser Briefe" übersetzt hatte;
in den kritischen Aufsätzen, die Ende der
dreißiger Jahre in Wirths „Deutscher Volks-
Halle" erschienen, sprach sich Herwegh mehr-
fach mit warmer Anerkennung über den streit-
baren Abbö aus, der das Feuer des Sozia-
lismus mit dem Weihwasser des Christentums
heit! Der Freiheit Oriflamme! Der Freiheit
eine Gasse! Freiheit, o du Felsenwort! Das
freie Wort! Der freie Rhein! — so hallte es
ohne Unterlaß, aber diese Freiheit Herweghs
war ein so abstraktes, in reinen Gedanken-
höhen schwebendes Wesen, daß sich jeder halb-
wegs fortschrittliche Liberale dieser Göttin hul-
digend neigen konnte. Wenn Marx einmal
von Lamartine
sagte, der Dichter
habe in der pro-
visorischen Regie-
rung von 1848
„dieFebruarrevo-
lution selbst, die
gemeinsame Er-
hebung mit ihren
Illusionen, ihrer
Poesie, ihrem ein-
gebildeten Inhalt
und ihren Phra-
sen" verkörpert,
so hatte Herwegh
zweifellos etwas
von Lamartine an
sich, den er übri-
gens bewunderte
und übersetzt hat.
Auch wo er zu so-
zialer Lyrik einen
Anlaufnahm,kam
er überden gleich-
falls von ihm ge-
feierten,Apoll der
Hütte' Böranger
kaum hinaus.
Im Mai des
gleichen Jahres
1841, in dem die
„Gedichte eines
Lebendigen" auf-
flatterten, trug
Wilhelni Weit-
ling, von Paris
kommend, den
Flammenbrand
seines urwüchsi-
gen Handwerks-
burschenkommu-
nismus unter die
meist zugewan-
derten Arbeiter
der Schweiz; er
gründete nun eine
Zweigniederlassung des „Bundes der Ge-
rechten" und schuf im „Hilferuf der deutschen
Jugend" eine Monatsschrift zur Aussaat sei-
ner Gedanken; im Dezember 1842 erschienen
in Genf seine „Garantien der Harmonie und
Freiheit", im Frühjahr 1843 schrieb er in
Zürich sein „Evangelium eines armen Sün-
ders", dessen bloße Ankündigung schon ihm
Verhaftung, Verurteilung und Ausweisung
zuzog. In dem Kreise dieser Genfer Kommu-
nisten tat sich auch Herwegh um und bekannte,
von den liberalen Reaktionären Zürichs ob
dieses Verkehrs angegriffen, mit Freimut, er
habe es sich zur größten Ehre angerechnet,
gar seltsam zu vermischen suchte, und es lag
nicht so fern von dessen Weltanschauung, wenn
er „die laut ausgesprochene Reform unserer
sozialen Mißstände" für die moderne Religion
erklärte. Aber an Kommunismus erinnerte in
den „Gedichten eines Lebendigen" auch nicht
ein Sterbenswörtchen. Was dem zukunfts-
hungrigen, jungen Geschlecht des zum Selbst-
Georg herwegh. Nach einem Porträt aus dem Jahre 187Z.
bewußtsein erwachenden Bürgertums die Seele
zu tiefst bewegte, fand es hier in hinreißen-
den Weisen ausgesprochen; wie Sturmgeläut
von hohem Glockenstuhl klang der eherne
Schall dieser Verse ins Land, aber ein nüch-
ternes Ohr hörte heraus, daß sie allgemein
begeisterten, weil sie sich in Allgemeinheiten
verloren. Der Sehnsucht nach deutscher Ein-
heit, dem Drang nach Weltmeer und Welt-
markt, der Hoffnung auf den neuen Preußen-
könig galten, ganz im Sinne des Liberalismus,
einzelne dieser feurigen Hymnen, aber der
Grundton, der sie mächtig durchzitterte, hieß
Freiheit. Altar der Freiheit! Geist der Frei-