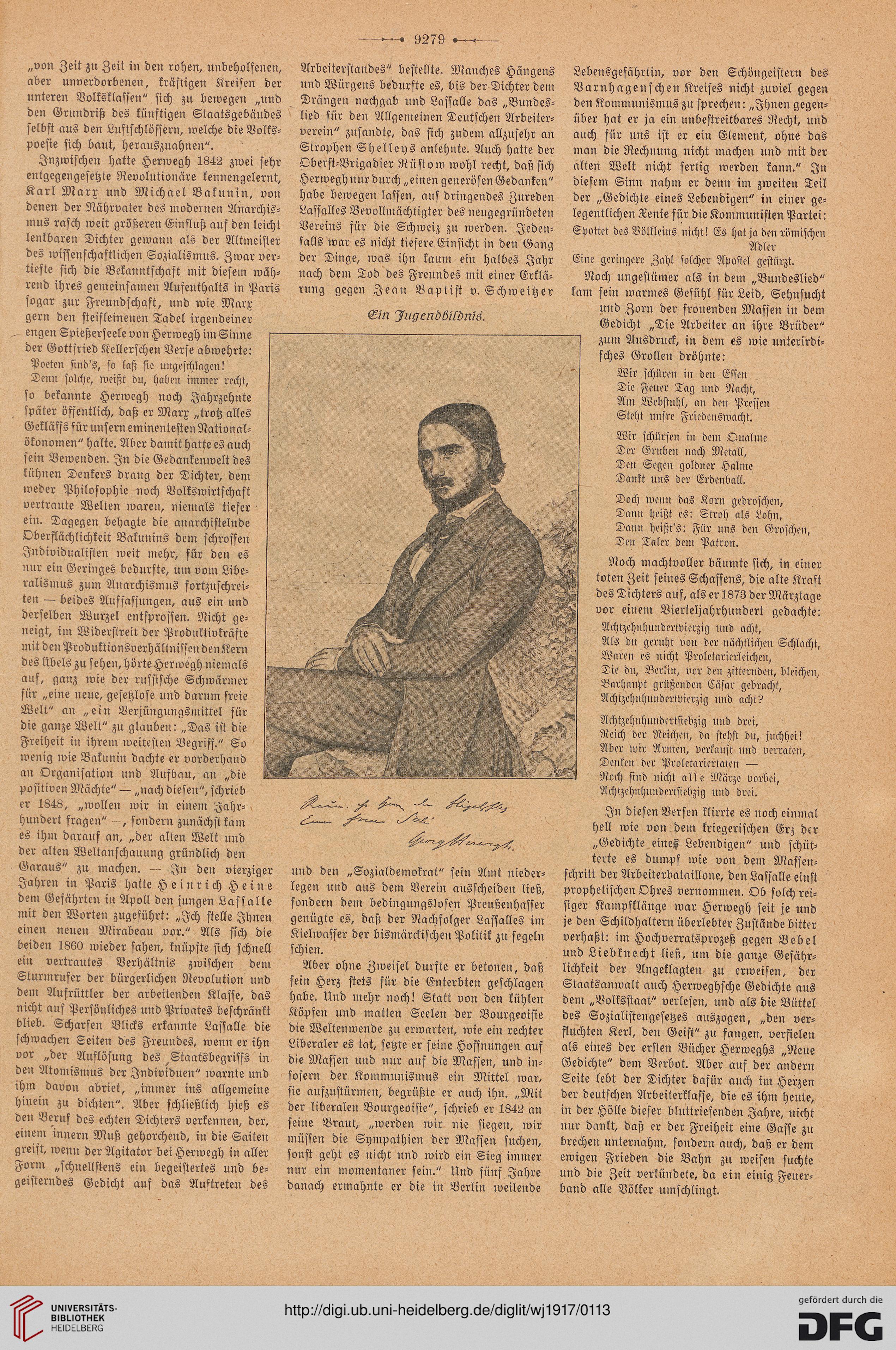— 9279
„von Zeit zn Zeit in den rohen, unbeholfenen,
aber unverdorbenen, kräftigen Kreisen der
unteren Volksklassen" sich zu bewegen „und
den Grundriß des künftigen Staatsgebäudes
selbst aus den Luftschlössern, welche die Volks-
poesie sich baut, herauszuahnen".
Inzwischen hatte Herwegh 1842 zwei sehr-
entgegengesetzte Revolutionäre kennengelernt,
Karl Marx und Michael Bakunin, von
denen der Nährvater des modernen Anarchis-
mus rasch weit größeren Einfluß auf den leicht
lenkbaren Dichter gewann als der Altmeister
des wissenschaftlichen Sozialismus. Zwar ver-
tiefte sich die Bekanntschaft mit diesem wäh-
rend ihres gemeinsamen Aufenthalts in Paris
sogar zur Freundschaft, und wie Marx
gern den steifleinenen Tadel irgendeiner-
engen Spießerseele von Herwegh im Sinne
der Gottfried Kellerschen Verse abwehrte:
Porten sind's, so laß sie ungeschlagen!
Denn solche, weißt du, haben immer recht,
so bekannte Herwegh noch Jahrzehnte
später öffentlich, daß er Marx „trotz alles
Gekläffs für unfern eminentesten National-
ökonomen" halte. Aber damit hatte es auch
sein Bewenden. In die Gedankenwelt des
kühnen Denkers drang der Dichter, dem
weder Philosophie noch Volkswirtschaft
vertraute Welten waren, niemals tiefer
ein. Dagegen behagte die anarchistelnde
Oberflächlichkeit Bakunins dem schroffen
Individualisten weit mehr, für den es
nur ein Geringes bedurfte, um vom Libe-
ralismus zum Anarchismus fortzuschrei-
ten — beides Auffassungen, aus ein und
derselben Wurzel entsprossen. Nicht ge-
neigt, i>n Widerstreit der Produktivkräfte
mit den Produktionsverhältnissen den Kern
des Übels zu sehen, hörte Herivegh niemals
auf, ganz wie der russische Schwärmer
für „eine neue, gesetzlose und darum freie
Welt" an „ein Verjüngungsnüttel für
die ganze Welt" zu glauben: „Das ist die
Freiheit in ihrem weitesten Begriff." So
wenig wie Bakunin dachte er vorderhand
an Organisation und Ausbau, an „die
positiven Mächte" — „nach diesen", schrieb
er 1848, „wollen wir in einem Jahr-
hundert fragen" , sondern zunächst kam
es ihm darauf an, „der alten Welt und
der alten Weltanschauung gründlich den
Garaus" zu machen. - In den vierziger
Jahren in Paris hatte Heinrich Heine
dem Gefährten in Apoll den jungen Lassalle
mit den Worten zugeführt: „Ich stelle Ihnen
einen neuen Mirabeau vor." Als sich die
beiden 1860 wieder sahen, knüpfte sich schnell
ein vertrautes Verhältnis zwischen dem
Sturmrufer der bürgerlichen Revolution und
dem Aufrüttler der arbeitenden Klasse, das
nicht auf Persönliches und Privates beschränkt
blieb. Scharfen Blicks erkannte Lassalle die
schwachen Seiten des Freundes, wenn er ihn
vor „der Auflösung des ,Staatsbegriffs in
den Atomismus der Individuen" warnte und
ihm davon abriet, „immer ins allgemeine
hinein zu dichten". Aber schließlich hieß es
den Beruf des echten Dichters verkennen, der,
einem inner» Muß gehorchend, in die Saiten
greift, wenn der Agitator bei Herwegh in aller
Form „schnellstens ein begeistertes und be-
geisterndes Gedicht auf das Auftreten des
Arbeiterstandes" bestellte. Manches Hängens
und Würgens bedurfte es, bis der Dichter dem
Drängen nachgab und Lassalle das „Bundes-
lied für den Allgenieinen Deutschen Arbeiter-
verein" zusandte, das sich zudem allzusehr an
Strophen Shelleys anlehnte. Auch hatte der
Oberst-Brigadier Rüstow wohl recht, daß sich
Herwegh nur durch „einen generöse» Gedanken"
habe bewegen lassen, auf dringendes Zureden
Lassalles Bevollmächtigter des neugegründete»
Vereins für die Schweiz zu werden. Jeden-
falls war es nicht tiefere Einsicht in den Gang
der Dinge, was ihn kaum ein halbes Jahr
nach dem Tod des Freundes mit einer Erklä-
rung gegen Jean Baptist v. Schweitzer
und den „Sozialdemokrat" sein Amt nieder-
legen und aus dem Verein ausscheiden ließ,
sondern dem bedingungslosen Preußenhasser
genügte es, daß der Nachfolger Lassalles im
Kielwasser der bismärckischen Politik zu segeln
schien.
Aber ohne Zweifel durfte er betonen, daß
sein Herz stets für die Enterbten geschlagen
habe. Und mehr noch! Statt von den kühlen
Köpfen und matten Seelen der Bourgeoisie
die Weltenwende zu erwarten, wie ein rechter
Liberaler es tat, setzte er seine Hoffnungen auf
die Massen und nur auf die Massen, und in-
sofern der Kommunismus ein Mittel war,
sie aufzustürmen, begrüßte er auch ihn. „Mit
der liberalen Bourgeoisie", schrieb er 1842 an
seine Braut, „werden wir nie siegen, wir
müssen die Sympathien der Massen suchen,
sonst geht es nicht und wird ein Sieg immer
nur ein momentaner sein." Und fünf Jahre
danach ermahnte er die in Berlin weilende
Lebensgefährtin, vor den Schöngeistern des
Varnhagenschen Kreises nicht zuviel gegen
den Kommunismus zu sprechen: „Ihnen gegen-
über hat er ja ein unbestreitbares Recht, und
auch für uns ist er ein Element, ohne das
man die Rechnung nicht machen und mit der
alten Welt nicht fertig werden kann." In
diesem Sinn nahm er denn im zweiten Teil
der „Gedichte eines Lebendigen" in einer ge-
legentlichen Xenie für die Kommunisten Partei:
Spottet desVölkleins nicht! Es hat ja den römischen
Adler
Eine geringere Zahl solcher Apostel gestürzt.
Noch ungestümer als in dem „Bundeslied"
kam sein warmes Gefühl für Leid, Sehnsucht
und Zorn der fronenden Massen in dem
Gedicht „Die Arbeiter an ihre Brüder"
zum Ausdruck, in dem es wie unterirdi-
sches Grollen dröhnte:
Wir schüren in den Essen
Die Feuer Tag und Stacht,
Am Webstuhl, an den Pressen
Steht unsre Friedcnswacht.
Wir schürfen in dem Qualme
Der Gruben nach Metall,
Den Segen goldner Halme
Dankt uns der Erdenball.
Doch wenn das Korn gedroschen,
Dann heißt cs: Stroh als Lohn,
Dann heißt's: Für uns den Groschen,
Den Taler dem Patron.
Noch machtvoller bäumte sich, in einer-
toten Zeit seines Schaffens, die alte Kraft
des Dichters auf, als er 1873 der Märztage
vor einem Vierteljahrhundert gedachte:
Achtzehnhnndcrtvierzig und acht,
Als du geruht von der nächtlichen Schlacht,
Waren cs nicht Proletarierleichen,
Die du, Berlin, vor den zitternden, bleichen,
Barhaupt grüßenden Cäsar gebracht,
Achtzchnhnndertvicrzig und acht?
Achtzehnhundertsiebzig und drei,
Reich der Reichen, da stehst du, juchhei!
Aber wir Armen, verkauft und verraten,
Denken der Proletariertaten —
Noch sind nicht all e Märze vorbei,
Achtzehnhundertsiebzig und drei.
In diesen Versen klirrte es noch einmal
hell wie von dem kriegerischen Erz der
„Gedichte eines Lebendigen" und schlit-
terte es dunipf wie von dem Massen-
schritt der Arbeiterbataillone, den Lassalle einst
prophetischen Ohres vernommen. Ob solch rei-
siger Kampfklänge war Herwegh seit je und
je den Schildhaltern überlebter Zustände bitter-
verhaßt: im Hochverratsprozeß gegen Bebel
und Liebknecht ließ, um die ganze Gefähr-
lichkeit der Angeklagten zu erweisen, der
Staatsanwalt auch Herweghsche Gedichte aus
dein „Volksstaat" verlesen, und als die Büttel
des Sozialistengesetzes auszogen, „den ver-
fluchten Kerl, den Geist" zu fangen, verfielen
als eines der ersten Bücher Herweghs „Neue
Gedichte" dem Verbot. Aber auf der andern
Seite lebt der Dichter dafür auch im Herzen
der deutschen Arbeiterklasse, die es ihm heute,
in der Hölle dieser bluttriefenden Jahre, nicht
nur dankt, daß er der Freiheit eine Gasse zil
brechen unternahm, sondern auch, daß er dem
ewigen Frieden die Bahn zu weisen suchte
und die Zeit verkündete, da ein einig Feuer-
band alle Völker umschlingt.
(Ein JugenöbUbniä.
„von Zeit zn Zeit in den rohen, unbeholfenen,
aber unverdorbenen, kräftigen Kreisen der
unteren Volksklassen" sich zu bewegen „und
den Grundriß des künftigen Staatsgebäudes
selbst aus den Luftschlössern, welche die Volks-
poesie sich baut, herauszuahnen".
Inzwischen hatte Herwegh 1842 zwei sehr-
entgegengesetzte Revolutionäre kennengelernt,
Karl Marx und Michael Bakunin, von
denen der Nährvater des modernen Anarchis-
mus rasch weit größeren Einfluß auf den leicht
lenkbaren Dichter gewann als der Altmeister
des wissenschaftlichen Sozialismus. Zwar ver-
tiefte sich die Bekanntschaft mit diesem wäh-
rend ihres gemeinsamen Aufenthalts in Paris
sogar zur Freundschaft, und wie Marx
gern den steifleinenen Tadel irgendeiner-
engen Spießerseele von Herwegh im Sinne
der Gottfried Kellerschen Verse abwehrte:
Porten sind's, so laß sie ungeschlagen!
Denn solche, weißt du, haben immer recht,
so bekannte Herwegh noch Jahrzehnte
später öffentlich, daß er Marx „trotz alles
Gekläffs für unfern eminentesten National-
ökonomen" halte. Aber damit hatte es auch
sein Bewenden. In die Gedankenwelt des
kühnen Denkers drang der Dichter, dem
weder Philosophie noch Volkswirtschaft
vertraute Welten waren, niemals tiefer
ein. Dagegen behagte die anarchistelnde
Oberflächlichkeit Bakunins dem schroffen
Individualisten weit mehr, für den es
nur ein Geringes bedurfte, um vom Libe-
ralismus zum Anarchismus fortzuschrei-
ten — beides Auffassungen, aus ein und
derselben Wurzel entsprossen. Nicht ge-
neigt, i>n Widerstreit der Produktivkräfte
mit den Produktionsverhältnissen den Kern
des Übels zu sehen, hörte Herivegh niemals
auf, ganz wie der russische Schwärmer
für „eine neue, gesetzlose und darum freie
Welt" an „ein Verjüngungsnüttel für
die ganze Welt" zu glauben: „Das ist die
Freiheit in ihrem weitesten Begriff." So
wenig wie Bakunin dachte er vorderhand
an Organisation und Ausbau, an „die
positiven Mächte" — „nach diesen", schrieb
er 1848, „wollen wir in einem Jahr-
hundert fragen" , sondern zunächst kam
es ihm darauf an, „der alten Welt und
der alten Weltanschauung gründlich den
Garaus" zu machen. - In den vierziger
Jahren in Paris hatte Heinrich Heine
dem Gefährten in Apoll den jungen Lassalle
mit den Worten zugeführt: „Ich stelle Ihnen
einen neuen Mirabeau vor." Als sich die
beiden 1860 wieder sahen, knüpfte sich schnell
ein vertrautes Verhältnis zwischen dem
Sturmrufer der bürgerlichen Revolution und
dem Aufrüttler der arbeitenden Klasse, das
nicht auf Persönliches und Privates beschränkt
blieb. Scharfen Blicks erkannte Lassalle die
schwachen Seiten des Freundes, wenn er ihn
vor „der Auflösung des ,Staatsbegriffs in
den Atomismus der Individuen" warnte und
ihm davon abriet, „immer ins allgemeine
hinein zu dichten". Aber schließlich hieß es
den Beruf des echten Dichters verkennen, der,
einem inner» Muß gehorchend, in die Saiten
greift, wenn der Agitator bei Herwegh in aller
Form „schnellstens ein begeistertes und be-
geisterndes Gedicht auf das Auftreten des
Arbeiterstandes" bestellte. Manches Hängens
und Würgens bedurfte es, bis der Dichter dem
Drängen nachgab und Lassalle das „Bundes-
lied für den Allgenieinen Deutschen Arbeiter-
verein" zusandte, das sich zudem allzusehr an
Strophen Shelleys anlehnte. Auch hatte der
Oberst-Brigadier Rüstow wohl recht, daß sich
Herwegh nur durch „einen generöse» Gedanken"
habe bewegen lassen, auf dringendes Zureden
Lassalles Bevollmächtigter des neugegründete»
Vereins für die Schweiz zu werden. Jeden-
falls war es nicht tiefere Einsicht in den Gang
der Dinge, was ihn kaum ein halbes Jahr
nach dem Tod des Freundes mit einer Erklä-
rung gegen Jean Baptist v. Schweitzer
und den „Sozialdemokrat" sein Amt nieder-
legen und aus dem Verein ausscheiden ließ,
sondern dem bedingungslosen Preußenhasser
genügte es, daß der Nachfolger Lassalles im
Kielwasser der bismärckischen Politik zu segeln
schien.
Aber ohne Zweifel durfte er betonen, daß
sein Herz stets für die Enterbten geschlagen
habe. Und mehr noch! Statt von den kühlen
Köpfen und matten Seelen der Bourgeoisie
die Weltenwende zu erwarten, wie ein rechter
Liberaler es tat, setzte er seine Hoffnungen auf
die Massen und nur auf die Massen, und in-
sofern der Kommunismus ein Mittel war,
sie aufzustürmen, begrüßte er auch ihn. „Mit
der liberalen Bourgeoisie", schrieb er 1842 an
seine Braut, „werden wir nie siegen, wir
müssen die Sympathien der Massen suchen,
sonst geht es nicht und wird ein Sieg immer
nur ein momentaner sein." Und fünf Jahre
danach ermahnte er die in Berlin weilende
Lebensgefährtin, vor den Schöngeistern des
Varnhagenschen Kreises nicht zuviel gegen
den Kommunismus zu sprechen: „Ihnen gegen-
über hat er ja ein unbestreitbares Recht, und
auch für uns ist er ein Element, ohne das
man die Rechnung nicht machen und mit der
alten Welt nicht fertig werden kann." In
diesem Sinn nahm er denn im zweiten Teil
der „Gedichte eines Lebendigen" in einer ge-
legentlichen Xenie für die Kommunisten Partei:
Spottet desVölkleins nicht! Es hat ja den römischen
Adler
Eine geringere Zahl solcher Apostel gestürzt.
Noch ungestümer als in dem „Bundeslied"
kam sein warmes Gefühl für Leid, Sehnsucht
und Zorn der fronenden Massen in dem
Gedicht „Die Arbeiter an ihre Brüder"
zum Ausdruck, in dem es wie unterirdi-
sches Grollen dröhnte:
Wir schüren in den Essen
Die Feuer Tag und Stacht,
Am Webstuhl, an den Pressen
Steht unsre Friedcnswacht.
Wir schürfen in dem Qualme
Der Gruben nach Metall,
Den Segen goldner Halme
Dankt uns der Erdenball.
Doch wenn das Korn gedroschen,
Dann heißt cs: Stroh als Lohn,
Dann heißt's: Für uns den Groschen,
Den Taler dem Patron.
Noch machtvoller bäumte sich, in einer-
toten Zeit seines Schaffens, die alte Kraft
des Dichters auf, als er 1873 der Märztage
vor einem Vierteljahrhundert gedachte:
Achtzehnhnndcrtvierzig und acht,
Als du geruht von der nächtlichen Schlacht,
Waren cs nicht Proletarierleichen,
Die du, Berlin, vor den zitternden, bleichen,
Barhaupt grüßenden Cäsar gebracht,
Achtzchnhnndertvicrzig und acht?
Achtzehnhundertsiebzig und drei,
Reich der Reichen, da stehst du, juchhei!
Aber wir Armen, verkauft und verraten,
Denken der Proletariertaten —
Noch sind nicht all e Märze vorbei,
Achtzehnhundertsiebzig und drei.
In diesen Versen klirrte es noch einmal
hell wie von dem kriegerischen Erz der
„Gedichte eines Lebendigen" und schlit-
terte es dunipf wie von dem Massen-
schritt der Arbeiterbataillone, den Lassalle einst
prophetischen Ohres vernommen. Ob solch rei-
siger Kampfklänge war Herwegh seit je und
je den Schildhaltern überlebter Zustände bitter-
verhaßt: im Hochverratsprozeß gegen Bebel
und Liebknecht ließ, um die ganze Gefähr-
lichkeit der Angeklagten zu erweisen, der
Staatsanwalt auch Herweghsche Gedichte aus
dein „Volksstaat" verlesen, und als die Büttel
des Sozialistengesetzes auszogen, „den ver-
fluchten Kerl, den Geist" zu fangen, verfielen
als eines der ersten Bücher Herweghs „Neue
Gedichte" dem Verbot. Aber auf der andern
Seite lebt der Dichter dafür auch im Herzen
der deutschen Arbeiterklasse, die es ihm heute,
in der Hölle dieser bluttriefenden Jahre, nicht
nur dankt, daß er der Freiheit eine Gasse zil
brechen unternahm, sondern auch, daß er dem
ewigen Frieden die Bahn zu weisen suchte
und die Zeit verkündete, da ein einig Feuer-
band alle Völker umschlingt.
(Ein JugenöbUbniä.