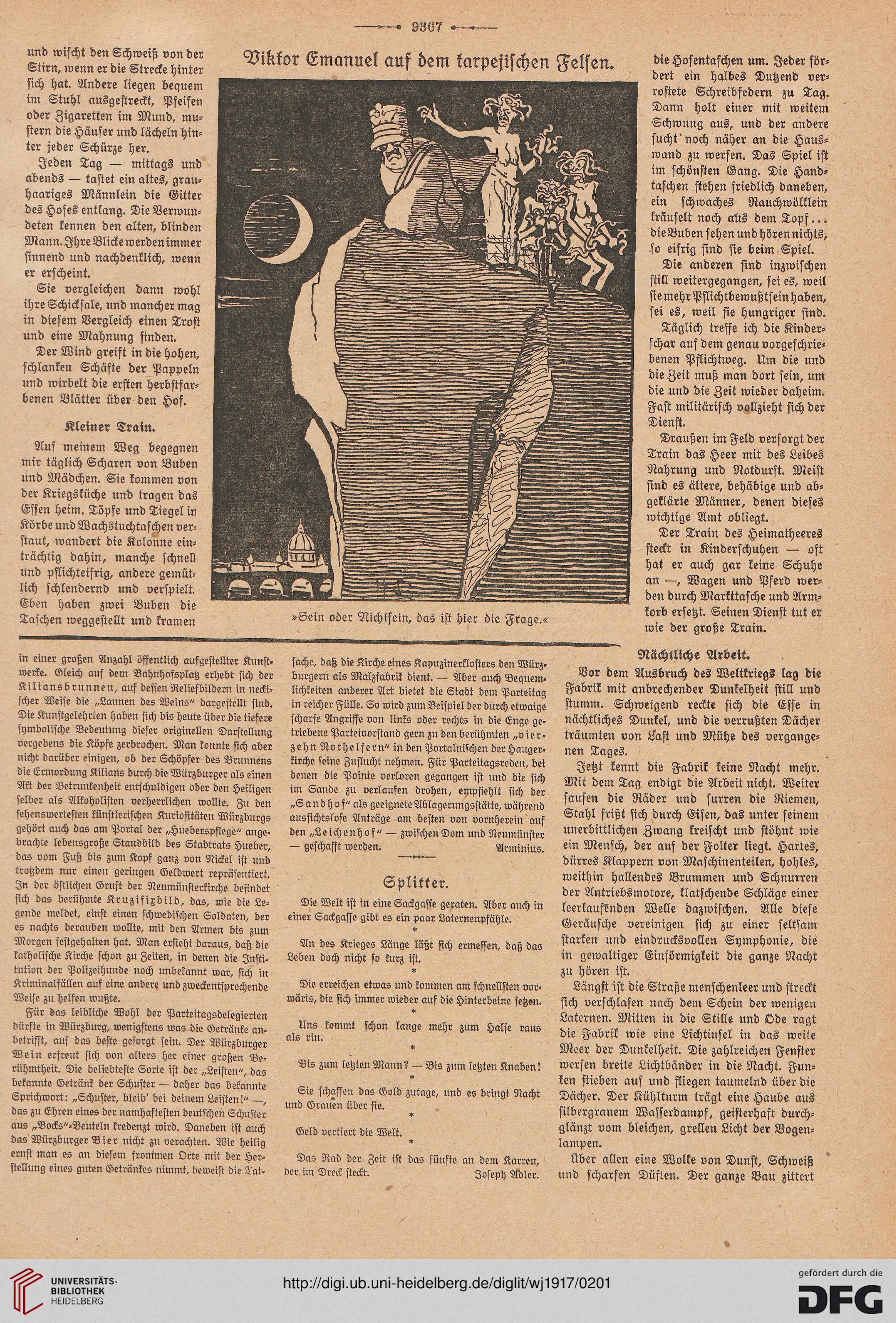9367
unb wischt den Schweiß von der Viktor Emanuel ottf dem tarpejischen Felsen.
Strrn, wenn er dre Strecke hinter 1
sich hat. Andere liegen bequem
im Stuhl ausgestreckt, Pfeifen
oder Zigaretten im Mund, mu-
stern die Häuser und lächeln hin-
ter jeder Schürze her.
Jeden Tag — mittags und
abends — tastet ein altes, grau-
haariges Männlein die Gitter
des Hofes entlang. Die Verwun-
deten kennen den alten, blinden
Mann. Ihre Blicke werden immer
sinnend und nachdenklich, wenn
er erscheint.
Sie vergleichen dann wohl
ihre Schicksale, und mancher mag
in diesem Vergleich einen Trost
und eine Mahnung finden.
Der Wind greift in die hohen,
schlanken Schäfte der Pappeln
und wirbelt die ersten herbstfar-
benen Blätter über den Hof.
Kleiner Train.
Auf meinem Weg begegnen
mir täglich Scharen von Buben
und Mädchen. Sie kommen von
der Kriegsküche und tragen das
Essen heim. Töpfe und Tiegelin
Körbe und Wachstuchtaschen ver-
staut, wandert die Kolonne ein-
trächtig dahin, manche schnell
und Pflichteifrig, andere gemüt-
lich schlendernd und verspielt.
Eben haben zwei Buben die
Taschen weggestellt und kramen »Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.«
in einer großen Anzahl öffentlich aufgestellter Kunst,
werke. Gleich auf dem Bahnhofsplatz erhebt sich der
Kiliansbrunnen, auf dessen Reliefbildern in necki-
scher Weise die „Launen des Weins" dargestellt sind.
Die Kunstgelehrten haben sich bis heute über die tiefere
symbolische Bedeutung dieser originellen Darstellung
vergebens die Köpfe zerbrochen. Man konnte sich aber
nicht darüber einigen, ob der Schöpfer des Brunnens
die Ermordung Kilians durch die Würzburger als einen
Ast der Betrunkenheit entschuldigen oder den Heiligen
selber als Alkoholisten verherrlichen wollte. Zu den
sehenswertesten künstlerischen Kuriositäten Würzburgs
gehört auch das am Portal der „Hueberspflege" äuge-
brachte lebensgroße Standbild des Stadtrats Hueber,
das vom Fuß bis zum Kopf ganz von Nickel ist und
trotzdem nur einen geringen Geldwert repräsentiert.
In der östlichen Gruft der Neumünsterkirche befindet
sich das berühmte Kruzifixbild, das, wie die Le-
gende meldet, einst einen schwedischen Soldaten, der
es nachts berauben wollte, mit den Armen bis zum
Morgen festgehalten hat. Man ersieht daraus, daß die
katholische Kirche schon zu Zeiten, in denen die Insti-
tution der Polizeihunde noch unbekannt war, sich in
Kriminalfällen auf eine andere und zweckentsprechende
Weise zu helfen wußte.
Für das leibliche Wohl der Parteitagsdelegierten
dürfte in Würzburg, wenigstens was die Getränke an-
betrifft, auf das beste gesorgt sein. Der Würzburger
Wein erfreut sich von alters her einer großen Be-
rühmtheit. Die beliebteste Sorte ist der „Leisten", das
bekannte Getränk der Schuster — daher das bekannte
Sprichwort: „Schuster, bleib' bei deinem Leisten I" —,
das zu Ehren eines der namhaftesten deutschen Schuster
aus „Bocks"-Beuteln kredenzt wird. Daneben ist auch
das Würzburger Bier nicht zu verachten. Wie heilig
ernst man es an diesem frouimen Orte mit der Her-
stellung eines guten Getränkes nimmt, beweist die Tat-
fache, daß die Kirche eines Kapuzinerklosters den Würz-
bürgern als Malzfabrik dient. — Aber auch Bequem-
lichkeiten anderer Art bietet die Stadt dem Parteitag
in reicher Fülle. So wird zum Beispiel der durch etwaige
scharfe Angriffe von links oder rechts in die Enge ge-
triebene Parteivorstand gern zu den berühmten „vier-
zehn Nothelfern" in den Portalnischen derHauger-
kirche seine Zuflucht nehmen. Für Parteitagsreden, bei
denen die Pointe verloren gegangen ist und die sich
im Sande zu verlaufen drohen, eyrpfiehlt sich der
„S a n d h o f" als geeignete Ablagerungsstätte, während
aussichtslose Anträge am besten von vornherein auf
den „Leichenhof" — zwischen Dom und Neumünster
— geschafft werden. Arminius.
Splitter.
Die Welt ist in eine Sackgasse geraten. Aber auch in
einer Sackgasse gibt es ein paar Laternenpfähle.
An des Krieges Länge läßt sich ermessen, daß das
Leben doch nicht so kurz ist.
Die erreichen etwas und kommen am schnellsten vor-
wärts, die sich immer wieder auf die Hinterbeine setzen.
Uns kommt schon lange mehr zum Halse raus
als rin.
Bis zum letzten Mann? — Bis zum letzten Knaben!
Sie schaffen das Gold zutage, und es bringt Nacht
und Grauen über sie.
Geld vertiert die Welt.
Das Rad der Zeit ist das fünfte an dem Karren,
der im Dreck steckt. Joseph Adler.
die Hosentaschen um. Jeder för-
dert ein halbes Dutzend ver-
rostete Schreibfedern zu Tag.
Dann holt einer mit weitem
Schwung aus, und der andere
sucht'noch näher an die Haus-
wand zu werfen. Das Spiel ist
im schönsten Gang. Die Hand-
taschen stehen friedlich daneben,
ein schwaches Rauchwölklein
kräuselt noch alrs dem Topf...
dieBuben sehen und hören nichts,
so eifrig sind sie beim Spiel.
Die anderen sind inzwischen
still weitergegangen, sei es, weil
siemehrPflichtbewußtseinhaben,
sei es, weil sie hungriger sind.
Täglich treffe ich die Kinder-
schar aus dem genau vorgeschrie-
benen Pflichtweg. Um die und
die Zeit muß man dort sein, um
die und die Zeit wieder daheim.
Fast militärisch vollzieht sich der
Dienst.
Draußen im Feld versorgt der
Train das Heer mit des Leibes
Nahrung und Notdurft. Meist
sind es ältere, behäbige und ab-
geklärte Männer, denen dieses
wichtige Amt obliegt.
Der Train des Heimatheeres
steckt in Kinderschuhen — oft
hat er auch gar keine Schuhe
an —, Wagen und Pferd wer-
den durch Markttasche und Arm-
korb ersetzt. Seinen Dienst tut er
wie der große Train.
Nächtliche Arbeit.
Vor dem Ausbruch des Weltkriegs lag die
Fabrik mit anbrechender Dunkelheit still und
stumm. Schweigend reckte sich die Esse in
nächtliches Dunkel, und die verrußten Dächer
träumten von Last und Mühe des vergange-
nen Tages.
Jetzt kennt die Fabrik keine Nacht mehr.
Mit dem Tag endigt die Arbeit nicht. Weiter
sausen die Räder und surren die Riemen,
Stahl frißt sich durch Eisen, das unter seinem
unerbittlichen Zwang kreischt und stöhnt wie
ein Mensch, der auf der Folter liegt. Hartes,
dürres Klappern von Maschinenteilen, hohles,
weithin hallendes Brummen und Schnurren
der Antriebsmotore, klatschende Schläge einer
leerlauftnden Welle dazwischen. Alle diese
Geräusche vereinigen sich zu einer seltsam
starken und eindrucksvollen Symphonie, die
in gewaltiger Einförmigkeit die ganze Nacht
zu hören ist.
Längst ist die Straße menschenleer und streckt
sich verschlafen nach dem Schein der wenigen
Laternen. Mitten in die Stille und Ode ragt
die Fabrik wie eine Lichtinsel in das weite
Meer der Dunkelheit. Die zahlreichen Fenster
werfen breite Lichtbänder in die Nacht. Fun-
ken stieben auf und fliegen taumelnd über die
Dächer. Der Kühlturm trägt eine Haube aus
silbergrauem Wasserdampf, geisterhaft durch-
glänzt vom bleichen, grellen Licht der Bogen-
lampen.
über allen eine Wolke von Dunst, Schweiß
und scharfen Düften. Der ganze Bau zittert
unb wischt den Schweiß von der Viktor Emanuel ottf dem tarpejischen Felsen.
Strrn, wenn er dre Strecke hinter 1
sich hat. Andere liegen bequem
im Stuhl ausgestreckt, Pfeifen
oder Zigaretten im Mund, mu-
stern die Häuser und lächeln hin-
ter jeder Schürze her.
Jeden Tag — mittags und
abends — tastet ein altes, grau-
haariges Männlein die Gitter
des Hofes entlang. Die Verwun-
deten kennen den alten, blinden
Mann. Ihre Blicke werden immer
sinnend und nachdenklich, wenn
er erscheint.
Sie vergleichen dann wohl
ihre Schicksale, und mancher mag
in diesem Vergleich einen Trost
und eine Mahnung finden.
Der Wind greift in die hohen,
schlanken Schäfte der Pappeln
und wirbelt die ersten herbstfar-
benen Blätter über den Hof.
Kleiner Train.
Auf meinem Weg begegnen
mir täglich Scharen von Buben
und Mädchen. Sie kommen von
der Kriegsküche und tragen das
Essen heim. Töpfe und Tiegelin
Körbe und Wachstuchtaschen ver-
staut, wandert die Kolonne ein-
trächtig dahin, manche schnell
und Pflichteifrig, andere gemüt-
lich schlendernd und verspielt.
Eben haben zwei Buben die
Taschen weggestellt und kramen »Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.«
in einer großen Anzahl öffentlich aufgestellter Kunst,
werke. Gleich auf dem Bahnhofsplatz erhebt sich der
Kiliansbrunnen, auf dessen Reliefbildern in necki-
scher Weise die „Launen des Weins" dargestellt sind.
Die Kunstgelehrten haben sich bis heute über die tiefere
symbolische Bedeutung dieser originellen Darstellung
vergebens die Köpfe zerbrochen. Man konnte sich aber
nicht darüber einigen, ob der Schöpfer des Brunnens
die Ermordung Kilians durch die Würzburger als einen
Ast der Betrunkenheit entschuldigen oder den Heiligen
selber als Alkoholisten verherrlichen wollte. Zu den
sehenswertesten künstlerischen Kuriositäten Würzburgs
gehört auch das am Portal der „Hueberspflege" äuge-
brachte lebensgroße Standbild des Stadtrats Hueber,
das vom Fuß bis zum Kopf ganz von Nickel ist und
trotzdem nur einen geringen Geldwert repräsentiert.
In der östlichen Gruft der Neumünsterkirche befindet
sich das berühmte Kruzifixbild, das, wie die Le-
gende meldet, einst einen schwedischen Soldaten, der
es nachts berauben wollte, mit den Armen bis zum
Morgen festgehalten hat. Man ersieht daraus, daß die
katholische Kirche schon zu Zeiten, in denen die Insti-
tution der Polizeihunde noch unbekannt war, sich in
Kriminalfällen auf eine andere und zweckentsprechende
Weise zu helfen wußte.
Für das leibliche Wohl der Parteitagsdelegierten
dürfte in Würzburg, wenigstens was die Getränke an-
betrifft, auf das beste gesorgt sein. Der Würzburger
Wein erfreut sich von alters her einer großen Be-
rühmtheit. Die beliebteste Sorte ist der „Leisten", das
bekannte Getränk der Schuster — daher das bekannte
Sprichwort: „Schuster, bleib' bei deinem Leisten I" —,
das zu Ehren eines der namhaftesten deutschen Schuster
aus „Bocks"-Beuteln kredenzt wird. Daneben ist auch
das Würzburger Bier nicht zu verachten. Wie heilig
ernst man es an diesem frouimen Orte mit der Her-
stellung eines guten Getränkes nimmt, beweist die Tat-
fache, daß die Kirche eines Kapuzinerklosters den Würz-
bürgern als Malzfabrik dient. — Aber auch Bequem-
lichkeiten anderer Art bietet die Stadt dem Parteitag
in reicher Fülle. So wird zum Beispiel der durch etwaige
scharfe Angriffe von links oder rechts in die Enge ge-
triebene Parteivorstand gern zu den berühmten „vier-
zehn Nothelfern" in den Portalnischen derHauger-
kirche seine Zuflucht nehmen. Für Parteitagsreden, bei
denen die Pointe verloren gegangen ist und die sich
im Sande zu verlaufen drohen, eyrpfiehlt sich der
„S a n d h o f" als geeignete Ablagerungsstätte, während
aussichtslose Anträge am besten von vornherein auf
den „Leichenhof" — zwischen Dom und Neumünster
— geschafft werden. Arminius.
Splitter.
Die Welt ist in eine Sackgasse geraten. Aber auch in
einer Sackgasse gibt es ein paar Laternenpfähle.
An des Krieges Länge läßt sich ermessen, daß das
Leben doch nicht so kurz ist.
Die erreichen etwas und kommen am schnellsten vor-
wärts, die sich immer wieder auf die Hinterbeine setzen.
Uns kommt schon lange mehr zum Halse raus
als rin.
Bis zum letzten Mann? — Bis zum letzten Knaben!
Sie schaffen das Gold zutage, und es bringt Nacht
und Grauen über sie.
Geld vertiert die Welt.
Das Rad der Zeit ist das fünfte an dem Karren,
der im Dreck steckt. Joseph Adler.
die Hosentaschen um. Jeder för-
dert ein halbes Dutzend ver-
rostete Schreibfedern zu Tag.
Dann holt einer mit weitem
Schwung aus, und der andere
sucht'noch näher an die Haus-
wand zu werfen. Das Spiel ist
im schönsten Gang. Die Hand-
taschen stehen friedlich daneben,
ein schwaches Rauchwölklein
kräuselt noch alrs dem Topf...
dieBuben sehen und hören nichts,
so eifrig sind sie beim Spiel.
Die anderen sind inzwischen
still weitergegangen, sei es, weil
siemehrPflichtbewußtseinhaben,
sei es, weil sie hungriger sind.
Täglich treffe ich die Kinder-
schar aus dem genau vorgeschrie-
benen Pflichtweg. Um die und
die Zeit muß man dort sein, um
die und die Zeit wieder daheim.
Fast militärisch vollzieht sich der
Dienst.
Draußen im Feld versorgt der
Train das Heer mit des Leibes
Nahrung und Notdurft. Meist
sind es ältere, behäbige und ab-
geklärte Männer, denen dieses
wichtige Amt obliegt.
Der Train des Heimatheeres
steckt in Kinderschuhen — oft
hat er auch gar keine Schuhe
an —, Wagen und Pferd wer-
den durch Markttasche und Arm-
korb ersetzt. Seinen Dienst tut er
wie der große Train.
Nächtliche Arbeit.
Vor dem Ausbruch des Weltkriegs lag die
Fabrik mit anbrechender Dunkelheit still und
stumm. Schweigend reckte sich die Esse in
nächtliches Dunkel, und die verrußten Dächer
träumten von Last und Mühe des vergange-
nen Tages.
Jetzt kennt die Fabrik keine Nacht mehr.
Mit dem Tag endigt die Arbeit nicht. Weiter
sausen die Räder und surren die Riemen,
Stahl frißt sich durch Eisen, das unter seinem
unerbittlichen Zwang kreischt und stöhnt wie
ein Mensch, der auf der Folter liegt. Hartes,
dürres Klappern von Maschinenteilen, hohles,
weithin hallendes Brummen und Schnurren
der Antriebsmotore, klatschende Schläge einer
leerlauftnden Welle dazwischen. Alle diese
Geräusche vereinigen sich zu einer seltsam
starken und eindrucksvollen Symphonie, die
in gewaltiger Einförmigkeit die ganze Nacht
zu hören ist.
Längst ist die Straße menschenleer und streckt
sich verschlafen nach dem Schein der wenigen
Laternen. Mitten in die Stille und Ode ragt
die Fabrik wie eine Lichtinsel in das weite
Meer der Dunkelheit. Die zahlreichen Fenster
werfen breite Lichtbänder in die Nacht. Fun-
ken stieben auf und fliegen taumelnd über die
Dächer. Der Kühlturm trägt eine Haube aus
silbergrauem Wasserdampf, geisterhaft durch-
glänzt vom bleichen, grellen Licht der Bogen-
lampen.
über allen eine Wolke von Dunst, Schweiß
und scharfen Düften. Der ganze Bau zittert