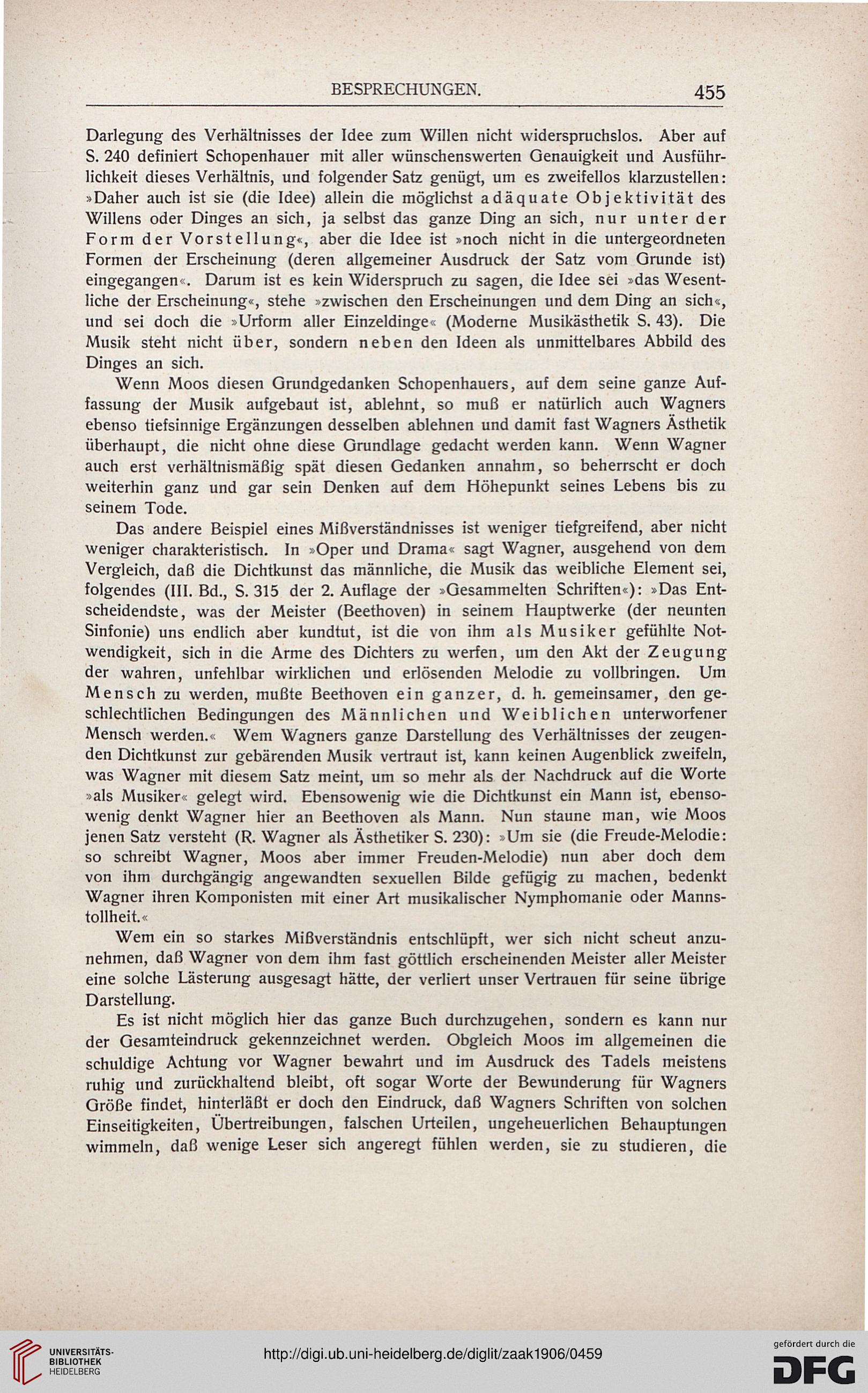BESPRECHUNGEN. 455
Darlegung des Verhältnisses der Idee zum Willen nicht widerspruchslos. Aber auf
S. 240 definiert Schopenhauer mit aller wünschenswerten Genauigkeit und Ausführ-
lichkeit dieses Verhältnis, und folgender Satz genügt, um es zweifellos klarzustellen:
»Daher auch ist sie (die Idee) allein die möglichst adäquate Objektivität des
Willens oder Dinges an sich, ja selbst das ganze Ding an sich, nur unter der
Form der Vorstellung«, aber die Idee ist »noch nicht in die untergeordneten
Formen der Erscheinung (deren allgemeiner Ausdruck der Satz vom Grunde ist)
eingegangen«. Darum ist es kein Widerspruch zu sagen, die Idee sei »das Wesent-
liche der Erscheinung«, stehe »zwischen den Erscheinungen und dem Ding an sich«,
und sei doch die »Urform aller Einzeldinge« (Moderne Musikästhetik S. 43). Die
Musik steht nicht über, sondern neben den Ideen als unmittelbares Abbild des
Dinges an sich.
Wenn Moos diesen Grundgedanken Schopenhauers, auf dem seine ganze Auf-
fassung der Musik aufgebaut ist, ablehnt, so muß er natürlich auch Wagners
ebenso tiefsinnige Ergänzungen desselben ablehnen und damit fast Wagners Ästhetik
überhaupt, die nicht ohne diese Grundlage gedacht werden kann. Wenn Wagner
auch erst verhältnismäßig spät diesen Gedanken annahm, so beherrscht er doch
weiterhin ganz und gar sein Denken auf dem Höhepunkt seines Lebens bis zu
seinem Tode.
Das andere Beispiel eines Mißverständnisses ist weniger tiefgreifend, aber nicht
weniger charakteristisch. In »Oper und Drama« sagt Wagner, ausgehend von dem
Vergleich, daß die Dichtkunst das männliche, die Musik das weibliche Element sei,
folgendes (III. Bd., S. 315 der 2. Auflage der »Gesammelten Schriften«): »Das Ent-
scheidendste, was der Meister (Beethoven) in seinem Hauptwerke (der neunten
Sinfonie) uns endlich aber kundtut, ist die von ihm als Musiker gefühlte Not-
wendigkeit, sich in die Arme des Dichters zu werfen, um den Akt der Zeugung
der wahren, unfehlbar wirklichen und erlösenden Melodie zu vollbringen. Um
Mensch zu werden, mußte Beethoven ein ganzer, d. h. gemeinsamer, den ge-
schlechtlichen Bedingungen des Männlichen und Weiblichen unterworfener
Mensch werden.« Wem Wagners ganze Darstellung des Verhältnisses der zeugen-
den Dichtkunst zur gebärenden Musik vertraut ist, kann keinen Augenblick zweifeln,
was Wagner mit diesem Satz meint, um so mehr als der Nachdruck auf die Worte
»als Musiker« gelegt wird. Ebensowenig wie die Dichtkunst ein Mann ist, ebenso-
wenig denkt Wagner hier an Beethoven als Mann. Nun staune man, wie Moos
jenen Satz versteht (R. Wagner als Ästhetiker S. 230): »Um sie (die Freude-Melodie:
so schreibt Wagner, Moos aber immer Freuden-Melodie) nun aber doch dem
von ihm durchgängig angewandten sexuellen Bilde gefügig zu machen, bedenkt
Wagner ihren Komponisten mit einer Art musikalischer Nymphomanie oder Manns-
tollheit.«
Wem ein so starkes Mißverständnis entschlüpft, wer sich nicht scheut anzu-
nehmen, daß Wagner von dem ihm fast göttlich erscheinenden Meister aller Meister
eine solche Lästerung ausgesagt hätte, der verliert unser Vertrauen für seine übrige
Darstellung.
Es ist nicht möglich hier das ganze Buch durchzugehen, sondern es kann nur
der Gesamteindruck gekennzeichnet werden. Obgleich Moos im allgemeinen die
schuldige Achtung vor Wagner bewahrt und im Ausdruck des Tadels meistens
ruhig und zurückhaltend bleibt, oft sogar Worte der Bewunderung für Wagners
Größe findet, hinterläßt er doch den Eindruck, daß Wagners Schriften von solchen
Einseitigkeiten, Übertreibungen, falschen Urteilen, ungeheuerlichen Behauptungen
wimmeln, daß wenige Leser sich angeregt fühlen werden, sie zu studieren, die
Darlegung des Verhältnisses der Idee zum Willen nicht widerspruchslos. Aber auf
S. 240 definiert Schopenhauer mit aller wünschenswerten Genauigkeit und Ausführ-
lichkeit dieses Verhältnis, und folgender Satz genügt, um es zweifellos klarzustellen:
»Daher auch ist sie (die Idee) allein die möglichst adäquate Objektivität des
Willens oder Dinges an sich, ja selbst das ganze Ding an sich, nur unter der
Form der Vorstellung«, aber die Idee ist »noch nicht in die untergeordneten
Formen der Erscheinung (deren allgemeiner Ausdruck der Satz vom Grunde ist)
eingegangen«. Darum ist es kein Widerspruch zu sagen, die Idee sei »das Wesent-
liche der Erscheinung«, stehe »zwischen den Erscheinungen und dem Ding an sich«,
und sei doch die »Urform aller Einzeldinge« (Moderne Musikästhetik S. 43). Die
Musik steht nicht über, sondern neben den Ideen als unmittelbares Abbild des
Dinges an sich.
Wenn Moos diesen Grundgedanken Schopenhauers, auf dem seine ganze Auf-
fassung der Musik aufgebaut ist, ablehnt, so muß er natürlich auch Wagners
ebenso tiefsinnige Ergänzungen desselben ablehnen und damit fast Wagners Ästhetik
überhaupt, die nicht ohne diese Grundlage gedacht werden kann. Wenn Wagner
auch erst verhältnismäßig spät diesen Gedanken annahm, so beherrscht er doch
weiterhin ganz und gar sein Denken auf dem Höhepunkt seines Lebens bis zu
seinem Tode.
Das andere Beispiel eines Mißverständnisses ist weniger tiefgreifend, aber nicht
weniger charakteristisch. In »Oper und Drama« sagt Wagner, ausgehend von dem
Vergleich, daß die Dichtkunst das männliche, die Musik das weibliche Element sei,
folgendes (III. Bd., S. 315 der 2. Auflage der »Gesammelten Schriften«): »Das Ent-
scheidendste, was der Meister (Beethoven) in seinem Hauptwerke (der neunten
Sinfonie) uns endlich aber kundtut, ist die von ihm als Musiker gefühlte Not-
wendigkeit, sich in die Arme des Dichters zu werfen, um den Akt der Zeugung
der wahren, unfehlbar wirklichen und erlösenden Melodie zu vollbringen. Um
Mensch zu werden, mußte Beethoven ein ganzer, d. h. gemeinsamer, den ge-
schlechtlichen Bedingungen des Männlichen und Weiblichen unterworfener
Mensch werden.« Wem Wagners ganze Darstellung des Verhältnisses der zeugen-
den Dichtkunst zur gebärenden Musik vertraut ist, kann keinen Augenblick zweifeln,
was Wagner mit diesem Satz meint, um so mehr als der Nachdruck auf die Worte
»als Musiker« gelegt wird. Ebensowenig wie die Dichtkunst ein Mann ist, ebenso-
wenig denkt Wagner hier an Beethoven als Mann. Nun staune man, wie Moos
jenen Satz versteht (R. Wagner als Ästhetiker S. 230): »Um sie (die Freude-Melodie:
so schreibt Wagner, Moos aber immer Freuden-Melodie) nun aber doch dem
von ihm durchgängig angewandten sexuellen Bilde gefügig zu machen, bedenkt
Wagner ihren Komponisten mit einer Art musikalischer Nymphomanie oder Manns-
tollheit.«
Wem ein so starkes Mißverständnis entschlüpft, wer sich nicht scheut anzu-
nehmen, daß Wagner von dem ihm fast göttlich erscheinenden Meister aller Meister
eine solche Lästerung ausgesagt hätte, der verliert unser Vertrauen für seine übrige
Darstellung.
Es ist nicht möglich hier das ganze Buch durchzugehen, sondern es kann nur
der Gesamteindruck gekennzeichnet werden. Obgleich Moos im allgemeinen die
schuldige Achtung vor Wagner bewahrt und im Ausdruck des Tadels meistens
ruhig und zurückhaltend bleibt, oft sogar Worte der Bewunderung für Wagners
Größe findet, hinterläßt er doch den Eindruck, daß Wagners Schriften von solchen
Einseitigkeiten, Übertreibungen, falschen Urteilen, ungeheuerlichen Behauptungen
wimmeln, daß wenige Leser sich angeregt fühlen werden, sie zu studieren, die