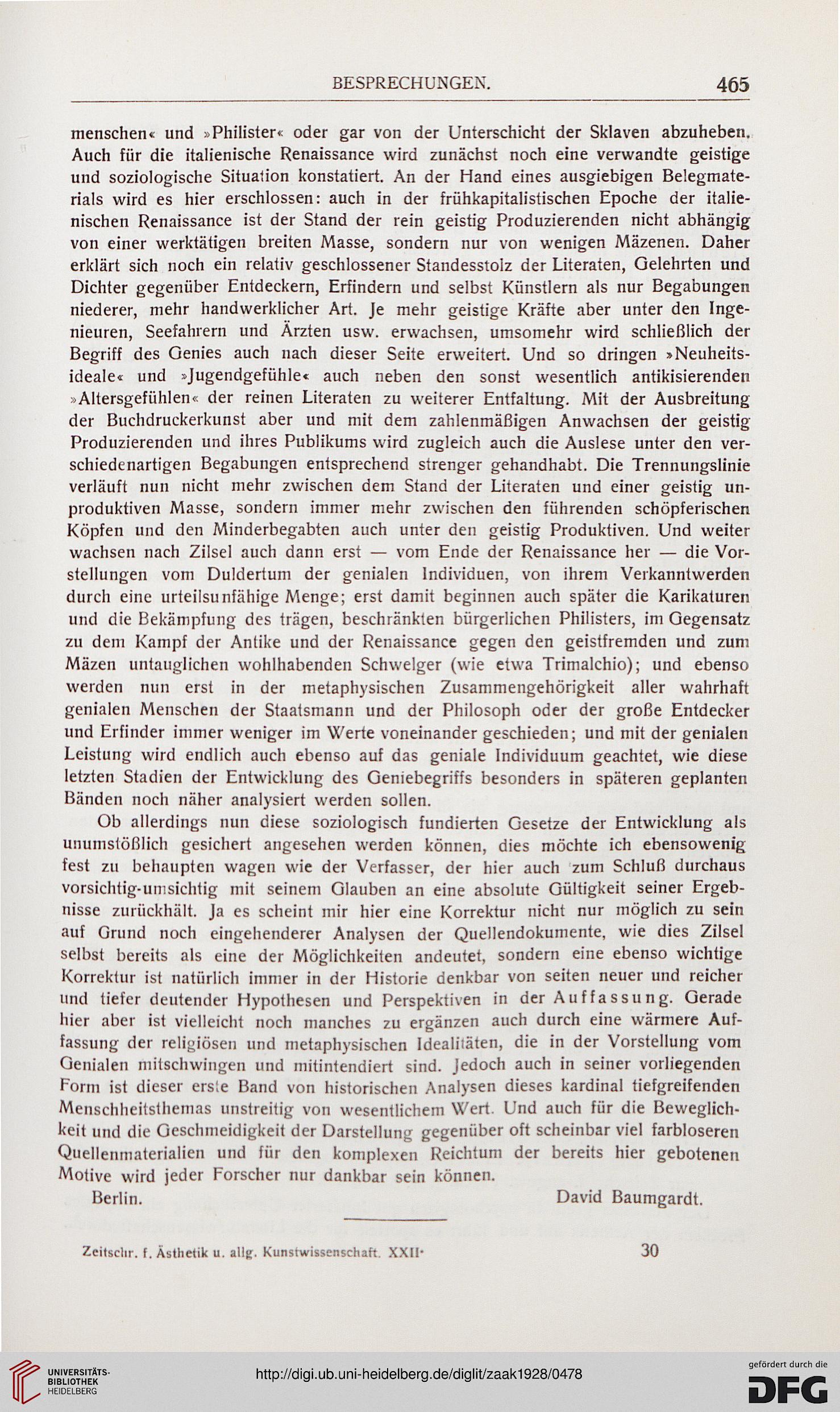BESPRECHUNGEN.
465
menschenc und »Philister* oder gar von der Unterschicht der Sklaven abzuheben.
Auch für die italienische Renaissance wird zunächst noch eine verwandte geistige
und soziologische Situation konstatiert. An der Hand eines ausgiebigen Belegmate-
rials wird es hier erschlossen: auch in der frühkapitalistischen Epoche der italie-
nischen Renaissance ist der Stand der rein geistig Produzierenden nicht abhängig
von einer werktätigen breiten Masse, sondern nur von wenigen Mäzenen. Daher
erklärt sich noch ein relativ geschlossener Standesstolz der Literaten, Gelehrten und
Dichter gegenüber Entdeckern, Erfindern und selbst Künstlern als nur Begabungen
niederer, mehr handwerklicher Art. Je mehr geistige Kräfte aber unter den Inge-
nieuren, Seefahrern und Ärzten usw. erwachsen, umsomehr wird schließlich der
Begriff des Genies auch nach dieser Seite erweitert. Und so dringen »Neuheits-
ideale« und »Jugendgefühle« auch neben den sonst wesentlich antikisierenden
»Altersgefühlen« der reinen Literaten zu weiterer Entfaltung. Mit der Ausbreitung
der Buchdruckerkunst aber und mit dem zahlenmäßigen Anwachsen der geistig
Produzierenden und ihres Publikums wird zugleich auch die Auslese unter den ver-
schiedenartigen Begabungen entsprechend strenger gehandhabt. Die Trennungslinie
verläuft nun nicht mehr zwischen dem Stand der Literaten und einer geistig un-
produktiven Masse, sondern immer mehr zwischen den führenden schöpferischen
Köpfen und den Minderbegabten auch unter den geistig Produktiven. Und weiter
wachsen nach Zilsel auch dann erst — vom Ende der Renaissance her — die Vor-
stellungen vom Duldertum der genialen Individuen, von ihrem Verkanntwerden
durch eine urteilsunfähige Menge; erst damit beginnen auch später die Karikaturen
und die Bekämpfung des trägen, beschränkten bürgerlichen Philisters, im Gegensatz
zu dem Kampf der Antike und der Renaissance gegen den geistfremden und zum
Mäzen untauglichen wohlhabenden Schwelger (wie etwa Trimalchio); und ebenso
werden nun erst in der metaphysischen Zusammengehörigkeit aller wahrhaft
genialen Menschen der Staatsmann und der Philosoph oder der große Entdecker
und Erfinder immer weniger im Werte voneinander geschieden; und mit der genialen
Leistung wird endlich auch ebenso auf das geniale Individuum geachtet, wie diese
letzten Stadien der Entwicklung des Geniebegriffs besonders in späteren geplanten
Bänden noch näher analysiert werden sollen.
Ob allerdings nun diese soziologisch fundierten Gesetze der Entwicklung als
unumstößlich gesichert angesehen werden können, dies möchte ich ebensowenig
fest zu behaupten wagen wie der Verfasser, der hier auch zum Schluß durchaus
vorsichtig-umsichtig mit seinem Glauben an eine absolute Gültigkeit seiner Ergeb-
nisse zurückhält. Ja es scheint mir hier eine Korrektur nicht nur möglich zu sein
auf Grund noch eingehenderer Analysen der Quellendokumente, wie dies Zilsel
selbst bereits als eine der Möglichkeiten andeutet, sondern eine ebenso wichtige
Korrektur ist natürlich immer in der Historie denkbar von Seiten neuer und reicher
und tiefer deutender Hypothesen und Perspektiven in der Auffassung. Gerade
hier aber ist vielleicht noch manches zu ergänzen auch durch eine wärmere Auf-
fassung der religiösen und metaphysischen Idealitäten, die in der Vorstellung vom
Genialen mitschwingen und mitintendiert sind. Jedoch auch in seiner vorliegenden
Form ist dieser ersie Band von historischen Analysen dieses kardinal tiefgreifenden
Menschheitsthenias unstreitig von wesentlichem Wert. Und auch für die Beweglich-
keit und die Geschmeidigkeit der Darstellung gegenüber oft scheinbar viel farbloseren
Quellenmaterialien und für den komplexen Reichtum der bereits hier gebotenen
Motive wird jeder Forscher nur dankbar sein können.
Berlin. David Baumgardt.
Zeitsclir. f. Ästhetik u. alle. Kunstwissenschaft XXII-
30
465
menschenc und »Philister* oder gar von der Unterschicht der Sklaven abzuheben.
Auch für die italienische Renaissance wird zunächst noch eine verwandte geistige
und soziologische Situation konstatiert. An der Hand eines ausgiebigen Belegmate-
rials wird es hier erschlossen: auch in der frühkapitalistischen Epoche der italie-
nischen Renaissance ist der Stand der rein geistig Produzierenden nicht abhängig
von einer werktätigen breiten Masse, sondern nur von wenigen Mäzenen. Daher
erklärt sich noch ein relativ geschlossener Standesstolz der Literaten, Gelehrten und
Dichter gegenüber Entdeckern, Erfindern und selbst Künstlern als nur Begabungen
niederer, mehr handwerklicher Art. Je mehr geistige Kräfte aber unter den Inge-
nieuren, Seefahrern und Ärzten usw. erwachsen, umsomehr wird schließlich der
Begriff des Genies auch nach dieser Seite erweitert. Und so dringen »Neuheits-
ideale« und »Jugendgefühle« auch neben den sonst wesentlich antikisierenden
»Altersgefühlen« der reinen Literaten zu weiterer Entfaltung. Mit der Ausbreitung
der Buchdruckerkunst aber und mit dem zahlenmäßigen Anwachsen der geistig
Produzierenden und ihres Publikums wird zugleich auch die Auslese unter den ver-
schiedenartigen Begabungen entsprechend strenger gehandhabt. Die Trennungslinie
verläuft nun nicht mehr zwischen dem Stand der Literaten und einer geistig un-
produktiven Masse, sondern immer mehr zwischen den führenden schöpferischen
Köpfen und den Minderbegabten auch unter den geistig Produktiven. Und weiter
wachsen nach Zilsel auch dann erst — vom Ende der Renaissance her — die Vor-
stellungen vom Duldertum der genialen Individuen, von ihrem Verkanntwerden
durch eine urteilsunfähige Menge; erst damit beginnen auch später die Karikaturen
und die Bekämpfung des trägen, beschränkten bürgerlichen Philisters, im Gegensatz
zu dem Kampf der Antike und der Renaissance gegen den geistfremden und zum
Mäzen untauglichen wohlhabenden Schwelger (wie etwa Trimalchio); und ebenso
werden nun erst in der metaphysischen Zusammengehörigkeit aller wahrhaft
genialen Menschen der Staatsmann und der Philosoph oder der große Entdecker
und Erfinder immer weniger im Werte voneinander geschieden; und mit der genialen
Leistung wird endlich auch ebenso auf das geniale Individuum geachtet, wie diese
letzten Stadien der Entwicklung des Geniebegriffs besonders in späteren geplanten
Bänden noch näher analysiert werden sollen.
Ob allerdings nun diese soziologisch fundierten Gesetze der Entwicklung als
unumstößlich gesichert angesehen werden können, dies möchte ich ebensowenig
fest zu behaupten wagen wie der Verfasser, der hier auch zum Schluß durchaus
vorsichtig-umsichtig mit seinem Glauben an eine absolute Gültigkeit seiner Ergeb-
nisse zurückhält. Ja es scheint mir hier eine Korrektur nicht nur möglich zu sein
auf Grund noch eingehenderer Analysen der Quellendokumente, wie dies Zilsel
selbst bereits als eine der Möglichkeiten andeutet, sondern eine ebenso wichtige
Korrektur ist natürlich immer in der Historie denkbar von Seiten neuer und reicher
und tiefer deutender Hypothesen und Perspektiven in der Auffassung. Gerade
hier aber ist vielleicht noch manches zu ergänzen auch durch eine wärmere Auf-
fassung der religiösen und metaphysischen Idealitäten, die in der Vorstellung vom
Genialen mitschwingen und mitintendiert sind. Jedoch auch in seiner vorliegenden
Form ist dieser ersie Band von historischen Analysen dieses kardinal tiefgreifenden
Menschheitsthenias unstreitig von wesentlichem Wert. Und auch für die Beweglich-
keit und die Geschmeidigkeit der Darstellung gegenüber oft scheinbar viel farbloseren
Quellenmaterialien und für den komplexen Reichtum der bereits hier gebotenen
Motive wird jeder Forscher nur dankbar sein können.
Berlin. David Baumgardt.
Zeitsclir. f. Ästhetik u. alle. Kunstwissenschaft XXII-
30