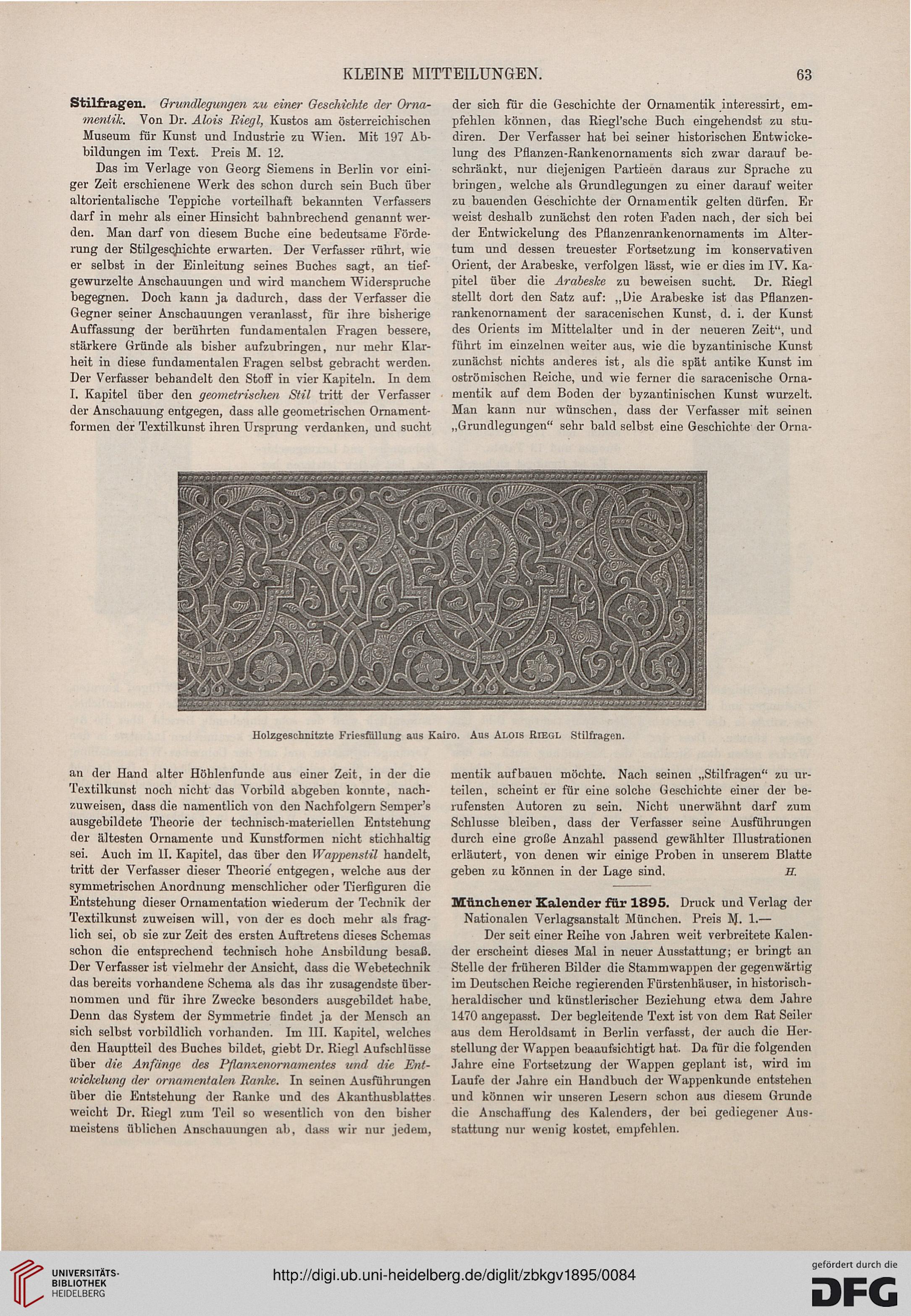KLEINE MITTEILUNGEN.
63
Stilfragen. Grundlegungen xu einer Geschichte der Orna-
mentik. Von Dr. Alois Riegl, Kustos am österreichischen
Museum für Kunst und Industrie zu Wien. Mit 197 Ab-
bildungen im Text. Preis M. 12.
Das im Verlage von Georg Siemens in Berlin vor eini-
ger Zeit erschienene Werk des schon durch sein Buch über
altorientalische Teppiche vorteilhaft bekannten Verfassers
darf in mehr als einer Hinsicht bahnbrechend genannt wer-
den. Man darf von diesem Buche eine bedeutsame Förde-
rung der Stilgeschichte erwarten. Der Verfasser rührt, wie
er selbst in der Einleitung seines Buches sagt, an tief-
gewurzelte Anschauungen und wird manchem Widerspruche
begegnen. Doch kann ja dadurch, dass der Verfasser die
Gegner seiner Anschauungen veranlasst, für ihre bisherige
Auffassung der berührten fundamentalen Fragen bessere,
stärkere Gründe als bisher aufzubringen, nur mehr Klar-
heit in diese fundamentalen Fragen selbst gebracht werden.
Der Verfasser behandelt den Stoff in vier Kapiteln. In dem
I. Kapitel über den geometrischen Stil tritt der Verfasser
der Anschauung entgegen, dass alle geometrischen Ornament-
formen der Textilkunst ihren Ursprung verdanken, und sucht
der sich für die Geschichte der Ornamentik interessirt, em-
pfehlen können, das Riegl'sche Buch eingehendst zu stu-
diren. Der Verfasser hat bei seiner historischen Entwicke-
lung des Pflanzen-Rankenornaments sich zwar darauf be-
schränkt, nur diejenigen Partieen daraus zur Sprache zu
bringen., welche als Grundlegungen zu einer darauf weiter
zu bauenden Geschichte der Ornamentik gelten dürfen. Er
weist deshalb zunächst den roten Faden nach, der sich bei
der Entwickelung des Pflanzenrankenornaments im Alter-
tum und dessen treuester Fortsetzung im konservativen
Orient, der Arabeske, verfolgen lässt, wie er dies im IV. Ka-
pitel über die Arabeske zu beweisen sucht. Dr. Riegl
stellt dort den Satz auf: „Die Arabeske ist das Pflanzen-
rankenornament der saracenischen Kunst, d. i. der Kunst
des Orients im Mittelalter und in der neueren Zeit", und
führt im einzelnen weiter aus, wie die byzantinische Kunst
zunächst nichts anderes ist, als die spät antike Kunst im
oströmischen Reiche, und wie ferner die saracenische Orna-
mentik auf dem Boden der byzantinischen Kunst wurzelt.
Man kann nur wünschen, dass der Verfasser mit seinen
„Grundlegungen" sehr bald selbst eine Geschichte der Orna-
Holzgeschnitzte Friesfiillung aus Kairo. Aus Alois Riegl Stilfragen.
an der Hand alter Höhlenfunde aus einer Zeit, in der die
Textilkunst noch nicht das Vorbild abgeben konnte, nach-
zuweisen, dass die namentlich von den Nachfolgern Semper's
ausgebildete Theorie der technisch-materiellen Entstehung
der ältesten Ornamente und Kunstformen nicht stichhaltig
sei. Auch im II. Kapitel, das über den Wappenstil handelt,
tritt der Verfasser dieser Theorie' entgegen, welche aus der
symmetrischen Anordnung menschlicher oder Tierfiguren die
Entstehung dieser Ornamentation wiederum der Technik der
Textilkunst zuweisen will, von der es doch mehr als frag-
lich sei, ob sie zur Zeit des ersten Auftretens dieses Schemas
schon die entsprechend technisch hohe Ausbildung besaß.
Der Verfasser ist vielmehr der Ansicht, dass die Webetechnik
das bereits vorhandene Schema als das ihr zusagendste über-
nommen und für ihre Zwecke besonders ausgebildet habe.
Denn das System der Symmetrie findet ja der Mensch an
sich selbst vorbildlich vorhanden. Im III. Kapitel, welches
den Hauptteil des Buches bildet, giebt Dr. Riegl Aufschlüsse
über die Anfänge des Pflanxenornamentes und die Ent-
wiclcelung der ornamentalen Bänke. In seinen Ausführungen
über die Entstehung der Ranke und des Akanthusblattes
weicht Dr. Riegl zum Teil so wesentlich von den bisher
meistens üblichen Anschauungen ab, dass wir nur jedem,
mentik aufbauen möchte. Nach seinen „Stilfragen" zu ur-
teilen, scheint er für eine solche Geschichte einer der be-
rufensten Autoren zu sein. Nicht unerwähnt darf zum
Schlüsse bleiben, dass der Verfasser seine Ausführungen
durch eine große Anzahl passend gewählter Illustrationen
erläutert, von denen wir einige Proben in unserem Blatte
geben zu können in der Lage sind. H.
Müucheiier Kalender für 1895. Druck und Verlag der
Nationalen Verlagsanstalt München. Preis M. 1>—
Der seit einer Reihe von Jahren weit verbreitete Kalen-
der erscheint dieses Mal in neuer Ausstattung; er bringt an
Stelle der früheren Bilder die Stammwappen der gegenwärtig
im Deutschen Reiche regierenden Fürstenhäuser, in historisch-
heraldischer und künstlerischer Beziehung etwa dem Jahre
1470 angepasst. Der begleitende Text ist von dem Rat Seiler
aus dem Heroldsamt in Berlin verfasst, der auch die Her-
stellung der Wappen beaaufaichtigt hat. Da für die folgenden
Jahre eine Fortsetzung der Wappen geplant ist, wird im
Laufe der Jahre ein Handbuch der Wappenkunde entstehen
und können wir unseren Lesern schon aus diesem Grunde
die Anschaffung des Kalenders, der bei gediegener Aus-
stattung nur wenig kostet, empfehlen.
63
Stilfragen. Grundlegungen xu einer Geschichte der Orna-
mentik. Von Dr. Alois Riegl, Kustos am österreichischen
Museum für Kunst und Industrie zu Wien. Mit 197 Ab-
bildungen im Text. Preis M. 12.
Das im Verlage von Georg Siemens in Berlin vor eini-
ger Zeit erschienene Werk des schon durch sein Buch über
altorientalische Teppiche vorteilhaft bekannten Verfassers
darf in mehr als einer Hinsicht bahnbrechend genannt wer-
den. Man darf von diesem Buche eine bedeutsame Förde-
rung der Stilgeschichte erwarten. Der Verfasser rührt, wie
er selbst in der Einleitung seines Buches sagt, an tief-
gewurzelte Anschauungen und wird manchem Widerspruche
begegnen. Doch kann ja dadurch, dass der Verfasser die
Gegner seiner Anschauungen veranlasst, für ihre bisherige
Auffassung der berührten fundamentalen Fragen bessere,
stärkere Gründe als bisher aufzubringen, nur mehr Klar-
heit in diese fundamentalen Fragen selbst gebracht werden.
Der Verfasser behandelt den Stoff in vier Kapiteln. In dem
I. Kapitel über den geometrischen Stil tritt der Verfasser
der Anschauung entgegen, dass alle geometrischen Ornament-
formen der Textilkunst ihren Ursprung verdanken, und sucht
der sich für die Geschichte der Ornamentik interessirt, em-
pfehlen können, das Riegl'sche Buch eingehendst zu stu-
diren. Der Verfasser hat bei seiner historischen Entwicke-
lung des Pflanzen-Rankenornaments sich zwar darauf be-
schränkt, nur diejenigen Partieen daraus zur Sprache zu
bringen., welche als Grundlegungen zu einer darauf weiter
zu bauenden Geschichte der Ornamentik gelten dürfen. Er
weist deshalb zunächst den roten Faden nach, der sich bei
der Entwickelung des Pflanzenrankenornaments im Alter-
tum und dessen treuester Fortsetzung im konservativen
Orient, der Arabeske, verfolgen lässt, wie er dies im IV. Ka-
pitel über die Arabeske zu beweisen sucht. Dr. Riegl
stellt dort den Satz auf: „Die Arabeske ist das Pflanzen-
rankenornament der saracenischen Kunst, d. i. der Kunst
des Orients im Mittelalter und in der neueren Zeit", und
führt im einzelnen weiter aus, wie die byzantinische Kunst
zunächst nichts anderes ist, als die spät antike Kunst im
oströmischen Reiche, und wie ferner die saracenische Orna-
mentik auf dem Boden der byzantinischen Kunst wurzelt.
Man kann nur wünschen, dass der Verfasser mit seinen
„Grundlegungen" sehr bald selbst eine Geschichte der Orna-
Holzgeschnitzte Friesfiillung aus Kairo. Aus Alois Riegl Stilfragen.
an der Hand alter Höhlenfunde aus einer Zeit, in der die
Textilkunst noch nicht das Vorbild abgeben konnte, nach-
zuweisen, dass die namentlich von den Nachfolgern Semper's
ausgebildete Theorie der technisch-materiellen Entstehung
der ältesten Ornamente und Kunstformen nicht stichhaltig
sei. Auch im II. Kapitel, das über den Wappenstil handelt,
tritt der Verfasser dieser Theorie' entgegen, welche aus der
symmetrischen Anordnung menschlicher oder Tierfiguren die
Entstehung dieser Ornamentation wiederum der Technik der
Textilkunst zuweisen will, von der es doch mehr als frag-
lich sei, ob sie zur Zeit des ersten Auftretens dieses Schemas
schon die entsprechend technisch hohe Ausbildung besaß.
Der Verfasser ist vielmehr der Ansicht, dass die Webetechnik
das bereits vorhandene Schema als das ihr zusagendste über-
nommen und für ihre Zwecke besonders ausgebildet habe.
Denn das System der Symmetrie findet ja der Mensch an
sich selbst vorbildlich vorhanden. Im III. Kapitel, welches
den Hauptteil des Buches bildet, giebt Dr. Riegl Aufschlüsse
über die Anfänge des Pflanxenornamentes und die Ent-
wiclcelung der ornamentalen Bänke. In seinen Ausführungen
über die Entstehung der Ranke und des Akanthusblattes
weicht Dr. Riegl zum Teil so wesentlich von den bisher
meistens üblichen Anschauungen ab, dass wir nur jedem,
mentik aufbauen möchte. Nach seinen „Stilfragen" zu ur-
teilen, scheint er für eine solche Geschichte einer der be-
rufensten Autoren zu sein. Nicht unerwähnt darf zum
Schlüsse bleiben, dass der Verfasser seine Ausführungen
durch eine große Anzahl passend gewählter Illustrationen
erläutert, von denen wir einige Proben in unserem Blatte
geben zu können in der Lage sind. H.
Müucheiier Kalender für 1895. Druck und Verlag der
Nationalen Verlagsanstalt München. Preis M. 1>—
Der seit einer Reihe von Jahren weit verbreitete Kalen-
der erscheint dieses Mal in neuer Ausstattung; er bringt an
Stelle der früheren Bilder die Stammwappen der gegenwärtig
im Deutschen Reiche regierenden Fürstenhäuser, in historisch-
heraldischer und künstlerischer Beziehung etwa dem Jahre
1470 angepasst. Der begleitende Text ist von dem Rat Seiler
aus dem Heroldsamt in Berlin verfasst, der auch die Her-
stellung der Wappen beaaufaichtigt hat. Da für die folgenden
Jahre eine Fortsetzung der Wappen geplant ist, wird im
Laufe der Jahre ein Handbuch der Wappenkunde entstehen
und können wir unseren Lesern schon aus diesem Grunde
die Anschaffung des Kalenders, der bei gediegener Aus-
stattung nur wenig kostet, empfehlen.