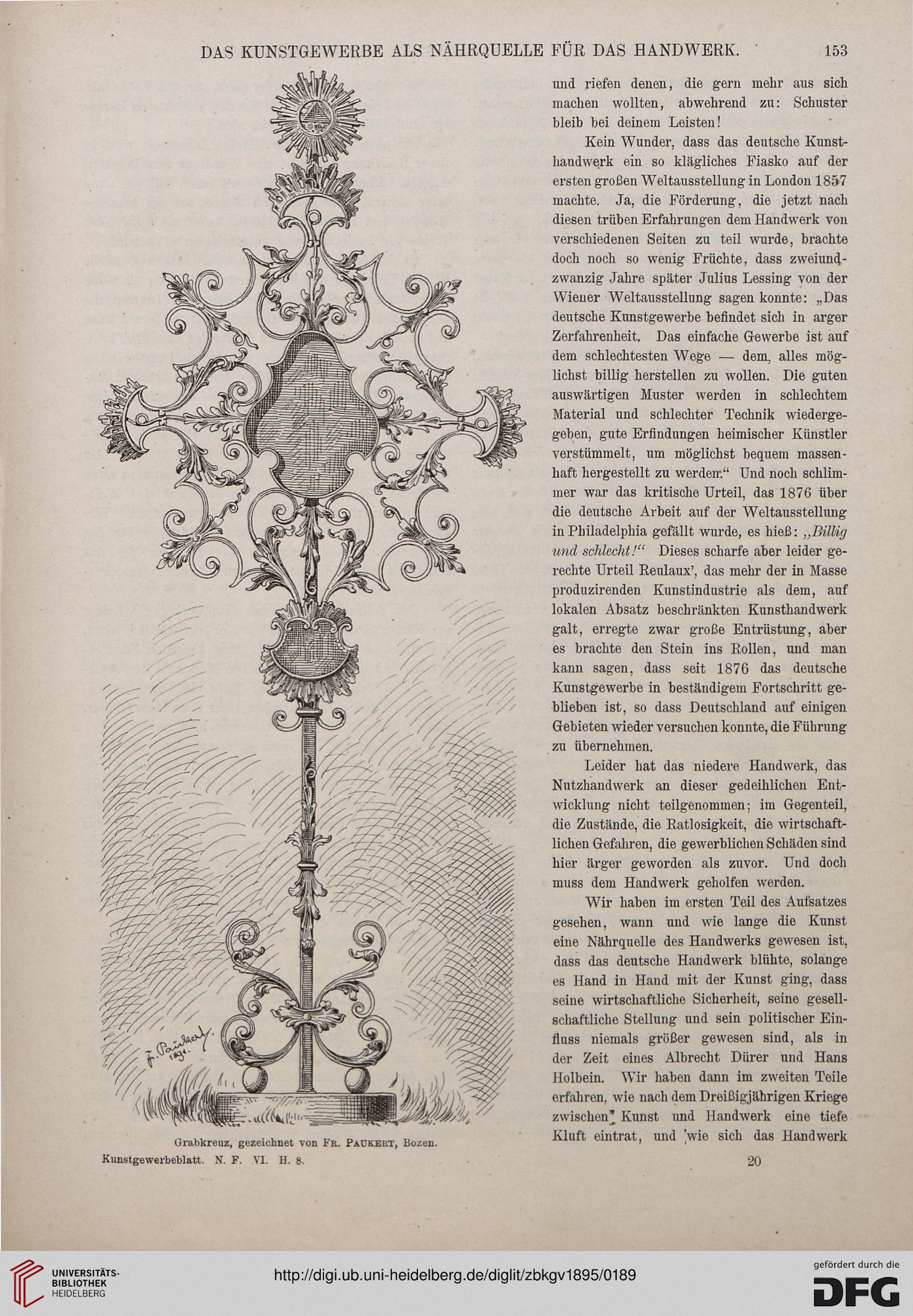DAS KUNSTGEWERBE ALS NÄHRQUELLE FÜR DAS HANDWERK.
153
Grabkreuz, gezeichnet von Fb. Paükert, Bozen.
Kunstgewerbeblatt. N. F. VI. H. 8.
und riefen denen, die gern mehr aus sich
machen wollten, abwehrend zu: Schuster
bleib bei deinem Leisten!
Kein Wunder, dass das deutsche Kunst-
liandwerk ein so klägliches Fiasko auf der
ersten großen Weltausstellung in London 1857
machte. Ja, die Förderung, die jetzt nach
diesen trüben Erfahrungen dem Handwerk von
verschiedenen Seiten zu teil wurde, brachte
doch noch so wenig Früchte, dass zweiund-
zwanzig Jahre später Julius Lessing von der
Wiener Weltausstellung sagen konnte: „Das
deutsche Kunstgewerbe befindet sich in arger
Zerfahrenheit. Das einfache Gewerbe ist auf
dem schlechtesten Wege — dem, alles mög-
lichst billig herstellen zu wollen. Die guten
auswärtigen Muster werden in schlechtem
Material und schlechter Technik wiederge-
geben, gute Erfindungen heimischer Künstler
verstümmelt, um möglichst bequem massen-
haft hergestellt zu werden-." Und noch schlim-
mer war das kritische Urteil, das 1876 über
die deutsche Arbeit auf der Weltausstellung
in Philadelphia gefällt wurde, es hieß: „Billig
und schlecht!" Dieses scharfe aber leider ge-
rechte Urteil Reulaux', das mehr der in Masse
produzirenden Kunstindustrie als dem, auf
lokalen Absatz beschränkten Kunsthandwerk
galt, erregte zwar große Entrüstung, aber
es brachte den Stein ins Bollen, und man
kann sagen, dass seit 1876 das deutsche
Kunstgewerbe in beständigem Fortschritt ge-
blieben ist, so dass Deutschland auf einigen
Gebieten wieder versuchen konnte, die Führung
zu übernehmen.
Leider hat das niedere Handwerk, das
Nutzhandwerk an dieser gedeihlichen Ent-
wicklung nicht teilgenommen; im Gegenteil,
die Zustände, die Ratlosigkeit, die wirtschaft-
lichen Gefahren, die gewerblichen Schäden sind
hier ärger geworden als zuvor. Und doch
muss dem Handwerk geholfen werden.
Wir haben im ersten Teil des Aufsatzes
gesehen, wann und wie lange die Kunst
eine Nährquelle des Handwerks gewesen ist,
dass das deutsche Handwerk blühte, solange
es Hand in Hand mit der Kunst ging, dass
seine wirtschaftliche Sicherheit, seine gesell-
schaftliche Stellung und sein politischer Ein-
fluss niemals größer gewesen sind, als in
der Zeit eines Albrecht Dürer und Hans
Holbein. Wir haben dann im zweiten Teile
erfahren, wie nach dem Dreißigjährigen Kriege
zwischen* Kunst und Handwerk eine tiefe
Kluft eintrat, und 'wie sich das Handwerk
20
153
Grabkreuz, gezeichnet von Fb. Paükert, Bozen.
Kunstgewerbeblatt. N. F. VI. H. 8.
und riefen denen, die gern mehr aus sich
machen wollten, abwehrend zu: Schuster
bleib bei deinem Leisten!
Kein Wunder, dass das deutsche Kunst-
liandwerk ein so klägliches Fiasko auf der
ersten großen Weltausstellung in London 1857
machte. Ja, die Förderung, die jetzt nach
diesen trüben Erfahrungen dem Handwerk von
verschiedenen Seiten zu teil wurde, brachte
doch noch so wenig Früchte, dass zweiund-
zwanzig Jahre später Julius Lessing von der
Wiener Weltausstellung sagen konnte: „Das
deutsche Kunstgewerbe befindet sich in arger
Zerfahrenheit. Das einfache Gewerbe ist auf
dem schlechtesten Wege — dem, alles mög-
lichst billig herstellen zu wollen. Die guten
auswärtigen Muster werden in schlechtem
Material und schlechter Technik wiederge-
geben, gute Erfindungen heimischer Künstler
verstümmelt, um möglichst bequem massen-
haft hergestellt zu werden-." Und noch schlim-
mer war das kritische Urteil, das 1876 über
die deutsche Arbeit auf der Weltausstellung
in Philadelphia gefällt wurde, es hieß: „Billig
und schlecht!" Dieses scharfe aber leider ge-
rechte Urteil Reulaux', das mehr der in Masse
produzirenden Kunstindustrie als dem, auf
lokalen Absatz beschränkten Kunsthandwerk
galt, erregte zwar große Entrüstung, aber
es brachte den Stein ins Bollen, und man
kann sagen, dass seit 1876 das deutsche
Kunstgewerbe in beständigem Fortschritt ge-
blieben ist, so dass Deutschland auf einigen
Gebieten wieder versuchen konnte, die Führung
zu übernehmen.
Leider hat das niedere Handwerk, das
Nutzhandwerk an dieser gedeihlichen Ent-
wicklung nicht teilgenommen; im Gegenteil,
die Zustände, die Ratlosigkeit, die wirtschaft-
lichen Gefahren, die gewerblichen Schäden sind
hier ärger geworden als zuvor. Und doch
muss dem Handwerk geholfen werden.
Wir haben im ersten Teil des Aufsatzes
gesehen, wann und wie lange die Kunst
eine Nährquelle des Handwerks gewesen ist,
dass das deutsche Handwerk blühte, solange
es Hand in Hand mit der Kunst ging, dass
seine wirtschaftliche Sicherheit, seine gesell-
schaftliche Stellung und sein politischer Ein-
fluss niemals größer gewesen sind, als in
der Zeit eines Albrecht Dürer und Hans
Holbein. Wir haben dann im zweiten Teile
erfahren, wie nach dem Dreißigjährigen Kriege
zwischen* Kunst und Handwerk eine tiefe
Kluft eintrat, und 'wie sich das Handwerk
20