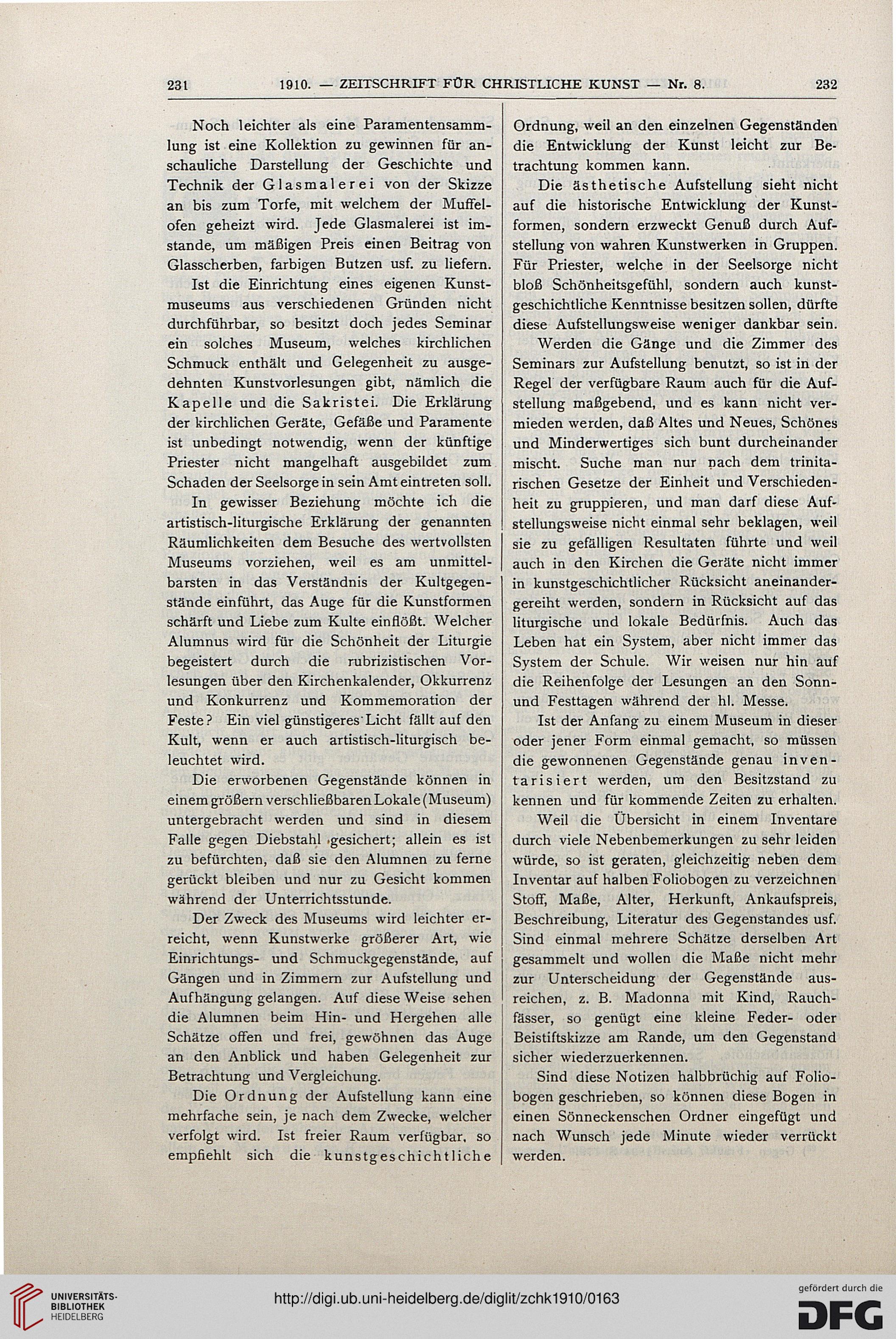Zeitschrift für christliche Kunst — 23.1910
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.4155#0163
DOI Artikel:
Schmid, Andreas: Pflege der kirchlichen Kunst in den Priesterseminarien, [2]
DOI Seite / Zitierlink: https://doi.org/10.11588/diglit.4155#0163
Titelblätter
Titel_III
FÜR
Inhaltsverzeichnis
Inhalt_VI
VI INHALTSVERZEICHNIS DER „ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST" 1910.
…
Kopt. Rauchfaß imGerman. Museum 105—106
…
Kopt. Rauchfaß im German. Museum 109—110
…
Elfenbein im Großherzogl. Museum Darm-
Inhalt_VII
INHALTSVERZEICHNIS DER „ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST" 1910.
…
Bronzelöwe im German. Museum . 167—168
…
Museum.........249—250
…
Berlin, Kaiser - Friedr. - Museum
…
INHALTSVERZEICHNIS DER „ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST" 1910.
…
Bronzelöwe im German. Museum . 167—168
…
Museum.........249—250
…
Berlin, Kaiser - Friedr. - Museum
Alphabetisches Register
Inhalt_VIII
VIII INHALTSVERZEICHNIS DER ..ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST-' 1910.
…
Darmstadt. Großherz. Museum,
…
Eckblat t in der roman, Kunst 271.
…
London, South - Kensington - Muse-
…
Kunst 261. A. 5.
…
Museum, London 133*.
…
Hamburg, Museum für Kunst und
…
Kairo, Museum, Räuchergefäße
…
Köln. Wallraf-Richartz- Museum.
…
Histor.Museum(Eigelstein) Skizzen-
…
Kopenhagen, Nation. - Museum.
Inhalt_IX
INHALTSVERZEICHNIS DER „ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST" 1910. IX
…
Lo n d o n, South-Kensington-Museum,
…
München, National-Museum, Ton--
…
Nürnberg, Germanisches Museum,
…
Pest, National-Museum, Rauchfaß
…
kirchl. Kunst in den 173, 227.
…
Museum des deutschen Campp
…
Spalato, Museum, Rauchfaß des
…
Museum, Rauchfaß 142*, 146.
Inhalt_X
X INHALTSVERZEICHNIS DER „ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST" 1910.
…
Kunst. Kataloge des German.
…
Malerei (die Kunst dem Volke
…
Klassiker der Kunst XVI. A.
…
der Kunst.
…
Kowalcsyk, Denkmäler der Kunst
…
Kunst, deutsche, und Dekoration
…
Die Kunst dem Volke. Nr. 3 s.
…
in der christlichen Kunst 190.
…
Hildebrand t,Regensburg s.Kunst-
…
christliche Grabmäler für Nieder-
…
Luckenbach, Kunst und Ge-
…
X INHALTSVERZEICHNIS DER „ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST" 1910.
…
Kunst. Kataloge des German.
…
Malerei (die Kunst dem Volke
…
Klassiker der Kunst XVI. A.
…
der Kunst.
…
Kowalcsyk, Denkmäler der Kunst
…
Kunst, deutsche, und Dekoration
…
Die Kunst dem Volke. Nr. 3 s.
…
in der christlichen Kunst 190.
…
Hildebrand t,Regensburg s.Kunst-
…
christliche Grabmäler für Nieder-
…
Luckenbach, Kunst und Ge-
Verzeichnis der besprochenen Bücher und Kunstblätter
Heft 1
Heft_01_Titel_01
FÜR
Heft 1 / Eine Darstellung aus der Apokalypse mit der thronenden Madonna: Altkölnisches Tafelgemälde nach 1450
1
Museum ein Werk
…
wertlos für die Bestimmung, wenn das Bild im
…
vorgelegt wurde. Für die kunsthistorische Aus-
…
ein ungleich lebendigeres Verständnis für die
Heft 1 / Eine Alternative in Sachen Fra Angelicos
11
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
…
maßen von derselben Hand sind, gerät für
…
Entweder man besiegt den Zweifel auch für
…
daß ich in ihnen keine Vorstufe für diese
…
die Situation für das Fiesolaner Bild geworden
…
werdenden, sondern fertigen Kunst. Dieser
…
der Meister bereits 31 Jahre zählte. Für den geschulten
Heft 1 / Holzgeschnitztes Ostensorium um 1400
Heft 1 / Unveröffentlichte mittelalterliche Paramente
17
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. '•
…
licher Kunst so verdienten Pfarrers Laib, seines
19
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
…
Stickerei, die gerade für jene Zeit durch manche
21
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. !'•
…
Anzahl noch erhaltener Damaste, die für die
…
Auffallend und für die freie Auffassung der
…
solcher für alle die genannten Stickereien der
Heft 1 / Bücherschau
29
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. !'■
…
Der Kruzifixus in der bildenden Kunst von
…
haben einige mein Buch für eine Art Religionsbuch
…
geben H R/ '" ^ bÜdeDden Kunst wiede—
…
e n,cnt möglich, ebenso wie man die Gründe für
…
Übrigens ist es für alle Gebildeten geschrieben, denen
…
gerade für diesen Anschauungsunte: rieht sehr geeignet. —
…
brauch als eine ungemeine Erleichterung für den Re-
…
schaft. Den Heiland für eine Nation zu beanspruchen,
31
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1;.
…
Antike Kunst (Architektur, Skulptur, Malerei); der
…
Vorbereitung und Begleitung für die italienischen Kunst-
…
auch der ganzen Richtung, für deren Rechtfertigung
…
Lehrmethode zu Grunde liegt, ,,für jede Kunstbranche
…
geeignet, den Weg für die Anlage ähnlicher Lehrsamm-
Umschlag
Heft 2
Heft_02_Titel_1
FÜR
Heft 2 / Sieben Papiermaché-Reliefs des späteren Mittelalters
Heft 2 / Kölner Architekturbilder in einem Skizzenbuch des XVII. Jahrhunderts, [1]
37
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
…
rsatz für das Verlorene geboten werden kann.
…
P'äne aber auch in ihrer Art und für ihre
…
nur für das vom Deutzer Ufer aus mit geringer
…
reisen nach Köln kamen und hier Motive für
39
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
…
rischen Museum (Eigelstein).
…
heydeschen Bilder im Kölner historischen Museum.
…
ansichten, das kürzlich für das Historische
…
Als Ausgangspunkt für die Datierung dient
41
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
…
• 1761) hält dies jedoch für eine Verwechselung mit
…
22. Sept. 1664 für Johann und Justus V. hervorgeht
…
aber — selbst für die damalige Zeit — so
…
Für das erwähnte Monogramm /F habe ich
…
für seine Zeit geübten Architekturzeichner; das
…
Wurzbach zitiert Obreen nur für Johann V. — Die
43
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
…
für die Bauwerke bekundet, finden wir in den
Heft 2 / Der ehemalige Ciborienaltar im Dom zu Limburg
Heft 2 / Silbervergoldete Turmmonstranz in der Pfarrkirche zu Dorsten i. Westf.
59
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
…
aus der Umrißlinie heraus als Stützen für den
…
Stütz und Ruhepunkt für das Auge, bevor der
…
erst der Kopf deutlich und klar für eine spätere
61
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
…
seh] ™weg mit diesem Ergänzungsheft für abge-
…
des nahenden Verfalles der Kunst ein gesunder Natura-
…
ihrer Bedeutung für Zeit und Schule nicht bewertet
…
Wilperts neue Entdeckungen sind zugleich für den
…
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
…
seh] ™weg mit diesem Ergänzungsheft für abge-
…
des nahenden Verfalles der Kunst ein gesunder Natura-
…
ihrer Bedeutung für Zeit und Schule nicht bewertet
…
Wilperts neue Entdeckungen sind zugleich für den
Heft 2 / Bücherschau
63
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
…
für die dekorative Ausmalung zumeist böhmischer Kir-
…
Für diese hat der Künstler die Stilformen frei gewählt,
…
wie .•••ie für Kirchenausmalung zu den Ausnahmen ge-
…
zusammengestellt von der Zentralstelle für Disser-
…
bedingung für die Gemeinsamkeit der Aktion. H.
Umschlag
Heft 3
Heft_03_Titel_1
FÜR
Heft 3 / Kölner Architekturbilder in einem Skizzenbuch des XVII. Jahrhunderts, [2]
75
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
…
schweiger Museum. Beim Umbau der Pantaleonskirche
…
laßerteilung für die Fördeier des Kirchenbaues, ebenso
Heft 3 / Ein Kupferstich vom Berge Athos
Heft 3 / Ein angebliches Königsszepter im Schatze des Aachener Münsters
Heft 3 / Bücherschau
91
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3-
…
nachschlägt, er hat vielleicht ebenso viel für sich. Höchst
…
hin, ihm ein für allemal eine stärkere Berücksichtigung
…
und aufzuklären über die Gesichtspunkte, die für dessen
93
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
…
koptischen Periode andererseits fällt für die christliche
…
im Urzustände erhalten hat. Für Stilentwicklung
…
wendiges, ein schützendes Bollwerk für die mit welt-
95
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
…
ist der Erläuterungsband wohl noch für dieses Jahr
…
füllend für die gründliche, auch die allerneuesten
…
Bedeutung für das Heidentum, deren das Christentum
…
Bedeutung bei als einem vorzüglichen Hilfsmittel für
…
für den Maimonat und für die Reise- und Wall-
Umschlag
Heft_03_Umschlag_hinten_1
mondt-Museum zu Aachen. Von Schnütgen.....94
…
preis beträgt für den ganzen Jahrgang M. 10.—, für den halben Jahrgang
Heft 4
Heft_04_Titel_1
FÜR
Heft 4 / Die Sammlung Schnütgen, [1]
Heft 4 / Thuribulum und Navicula in ihrer geschichtlichen Entwickelung, [1]
101
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
immerhin eine notwendige Vorbedingung für
…
talquellen, die für manche Periode so reichlich
103
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
nische Kunst in Ost-
…
Museum,
…
Fleury kritiklos für
…
gebraucht wurde. Für
105
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
einen Raum für den Gottes-
…
altchristlichen Kunst und Liturgie in Italien« (Frei-
…
kurzerhand für den Gottesdienst
…
zum größten Teile im Museum zu Kairo auf-
107
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
Abteilung kopt. Kunst, bearbeitet von Jos. Strzygowsky,
…
sein. Einerseits können wir für
109
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4,
…
Germanischen Museum zeigt den Typus, der am
…
reich und für uns von be-
…
pfanne im Museum zu Kairo. Neuerdings
…
wenn aber das Neapeler Mu-
…
derum das Germanische Mu-
…
7) F. H. Kraus, »Geschichte (Ter christl. Kunst«,
111
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
außer den im Museum zu Kairo aufbewahrten
…
und zugleich einen Typ für sich bildet ein
…
aus dem Germanischen Museum beigebrachten
…
ist der Umstand, daß für das Alter dieses
…
für die Datierung der vielen koptischen Thuri-
…
Museum zu Berlin, das neben anderen den
…
Friedrich-Museum. Dieses Stück hat voll-
Heft 4 / Oberbayerische Tonreliefs
113
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
Versuch gewagt, wenigstens für Oberbayern
…
gramme zunächst geeignetere Fixpunkte für
…
Auch für Epitaphien findet man gegen
119
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
einzelnen Rahmenteile sind für sich gearbeitet
…
Jahre 1554, welches das Germanische Museum
…
(Abb. 3.) Es besteht für mich kein Zweifel,
121
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
für das Relief von Innerthann fehlt mir die
…
für die Komposition der schöne große Holz-
…
Wasserwurg", der für Propst Lucas von Bey-
123
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
und auch für das XVI. Jahrh. scheint der Fall
…
Epitaph für einen Chorherren Johannes Gris-
…
ausstellungen stehen heute ein für allemal'ganz und gar
…
Kunst, speziell die christliche und die religiöse Kunst
…
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
…
und auch für das XVI. Jahrh. scheint der Fall
…
Epitaph für einen Chorherren Johannes Gris-
…
ausstellungen stehen heute ein für allemal'ganz und gar
…
Kunst, speziell die christliche und die religiöse Kunst
Heft 4 / Nachrichten / Bücherschau
Umschlag
Heft_04_Umschlag_hinten
preis beträgt für den ganzen Jahrgang M. 10.—, für den halben Jahrgang
Heft 5
Heft_05_Titel_1
FÜR
Heft 5 / Die Sammlung Schnütgen, [2]
Heft 5 / Eine Kölner Schnitzerschule des XI. und XII. Jahrhunderts
131
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
für den Ursprung der Werke des
…
sington-Museum zu
…
Museum zu Darmstadt
…
werk, wie es aus den Abb- '• Elfenbein im Grossherzogl. Museum zu Darmstadt. wandte Gruppe hin-
133
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
Johannes im Grossherzogl. Museum in Darmstadt.
135
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
muß, für eine Lokalisierung gewisse Schwierig-
…
können. Für letztere scheint das Heraus-
…
Museum eine Verkündigung an Maria und
…
Codex im dortigen Erzbischöflichen Museum
…
Museum zu Darmstadt, gleichfalls aus der
…
9) »Zeitsehr, für christl. Kunst«, 1908, Nr. 8,
…
Beinarbeiten des XI. und XII. Jahrh.'', »Zeitschr. für
Heft 5 / Thuribulum und Navicula in ihrer geschichtlichen Entwickelung, [2]
139
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
lingerzeit und die Miniaturen. Das Museum
…
für die Ketten aufweist. Zum Aufstellen sind
…
würdig und scheint mir ebenfalls für die These
…
koptischen Kunst- und Bildersprache, die
…
•4) Elfenbeintafeln im Kunstgewerbe-Museum zu
141
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
Weihrauches für
…
Kaiser-Friedrich-Museum; Führer durch die königlichen
…
!8) Zwei Elfenbeintafeln im Museum zu Berlin.
143
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
sind, weist das Museum für
…
im Germanischen Museum
…
burger Museum" I. 140 ff.
…
Kunst recht wohl gekannt
…
Räuchergefäß im Kaiser-Friedrich-Museum zu
145
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
das Fleury veröffentlichte, könnte für jene
…
Museum und im Kaiser-Friedrich-Museum zu
…
blicke, wo die kirchliche Kunst retrospektiv
…
zweiten Rangesihre Vorliebe für architektonische
…
und Verständnis für richtige Materialbewertung.
…
Symbolik in der nordischen Kunst ihre ersten
…
bischöfliche Museum daselbst überführen ließ22).
147
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
führlicher Inschrift die Erklärung für den
…
später aufgenietete Ösen für die Ketten verdeckt
…
Kunst jener Zeiten überhaupt entlehnt24).
…
für die Kunstgeschichte leider unbekannte
…
Zugring und Hemmung zugleich für die Deckel-
Heft 5 / Wandgemälde katholischer Kirchen
153
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
Papier sind Ersatzmittel für Malereien, die
…
Nischen haben, wird es für den Maler be-
…
die Ausgabe für Gerüste erspart und mit ein
…
für weite Kreise wichtig, für Malereien Platz
155
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
herausgegeben von OttoFischer. — Für das im
…
gleich es sich seiner Flauheit wegen für die farbliche
…
für die Gottesmutter und von seiner Begeisterung für
…
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
…
herausgegeben von OttoFischer. — Für das im
…
gleich es sich seiner Flauheit wegen für die farbliche
…
für die Gottesmutter und von seiner Begeisterung für
Heft 5 / Bücherschau
Umschlag
Heft 6
Heft_06_Titel_1
FÜR
Heft 6 / Die Sammlung Schnütgen, [3]
Heft 6 / Thuribulum und Navicula in ihrer geschichtlichen Entwickelung, [3]
163
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
Schlußplatte mit dem Ring ist für sich schon
…
stecher mit ihrer vervielfältigenden Kunst auch
…
die Entwürfe für allerlei kunstgewerbliche
…
Jahrh. erlangt hatten, die Motive für die reichen
…
für Goldschmiedearbeiten begegnen, die eine
165
1910. - ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
Vorliebe angewandte Technik, die der getrie-
…
ist es meistens allein, an dem die Kunst und
…
Thuribulum im Muse-
…
Ein für sich allein dastehendes Exemplar
167
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
Die Renaissance bot im Grunde keinen für
…
nisse islamitischer Kunst, Teil I (Metall)" (Berlin 1906)
…
handhabt. Gerade für diese beiden Epochen
169
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
fellos für Rauchfaß
…
der koptischen Altertümer im Museum zu
171
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
Zeit hatte über den Gegenstand, für uns von
…
spricht auch die für das sich erhitzende Gefäß
…
erwähnte Muldenform der acerra war für
…
Stück aus Bronze im Germanischen Museum
…
halten geblieben, so im Germanischen Museum,
173
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
Museum zu Prag (2).
…
Pflege der kirchlichen Kunst in den Priesterseminarien.
…
profaner, christlicher und kirchlicher Kunst
…
licher Kunst, ja sogar zwischen christlicher
…
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
Museum zu Prag (2).
…
Pflege der kirchlichen Kunst in den Priesterseminarien.
…
profaner, christlicher und kirchlicher Kunst
…
licher Kunst, ja sogar zwischen christlicher
Heft 6 / Pflege der kirchlichen Kunst in den Priesterseminarien, [1]
175
lgiO. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
2. Gründe für die Pflege der kirch-
…
kirchlichen Kunst trennen; denn ohne Kunst
…
die sich für gläubig und fromm hielten, zur
…
die kirchliche Kunst vor allem die Verherr-
…
Das Studium der kirchlichen Kunst wird
…
zum Kulte legen und dadurch den Sinn für
…
Liturgiker erhält von der bildenden Kunst
177
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6-
…
boten. Weniger ist dieses erforderlich für den
…
profane Kunst oft so wenig die Ideale des
…
von der hohen Aufgabe der Kunst kein Ver-
…
auf die Künstler und die Kunst selbst, weil
…
kann die kirchliche Kunst durch Belehrung
…
man also eine Reform der kirchlichen Kunst, so
…
werden, kirchliche Kunst zu studieren.
…
sorgten für die kirchliche Kunst. Ist mit
…
andere, nur nicht kirchliche Kunst, und trotz-
…
lichen Kunst in Priesterseminarien, wenn im
…
kirchlichen Kunst Kenntnisse besitzen, so ge-
179
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
jenigen, welche in der kirchlichen Kunst die
…
pieller Vernachlässigung kirchlicher Kunst noch
…
der kirchlichen Kunst sich zu erwerben. Haben
…
der kirchlichen Kunst für die amtliche
…
und die Begeisterung für die katholische Kirche
…
Kunst? warum werden auch in den Museen
…
der altchristlichen Kunst zu erschließen. Selbst
…
Die kirchliche Kunst, sowohl die musika-
…
die eigene Charakterfestigkeit ein und ist für
…
Pflege der profanen Kunst, sei es Musik oder
…
Sinn für Edleres erwacht ist als für Gemeines
181
lgl0. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
Kenntnisse der kirchlichen Kunst verlangen
…
Kunst nicht ausgeschlossen. Deutlicher sprechen
…
„Wer anders aber sind für die christliche
…
das Studium der kirchlichen Kunst in den
…
christlichen Kunst in ihren verschiedenen Ver-
…
richtigen Würdigung der Kunst heran-
183
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST _ Nr. 6.
…
lichen Kunst.
…
und für das seelsorgerliche Wirken wäre wenig
…
aus beurteilen könnte. Viel wichtiger ist für
…
Karsamstags für sich allein!
…
Die kirchliche Kunst ist nach früher Ge-
…
und damit zur Erfassung der kirchlichen Kunst-
185
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
in der kirchlichen Kunst nicht zunächst
…
Grundvoraussetzung für das Verständnis dieses
…
für den betreffenden Lehrer notwendig.
…
negativen Kritik gegenüber nicht für Heran-
…
weltlicherseits für Förderung der kunsl-
…
kirchlichen Kunst besitzen müssen, wenn sie
…
dienlichkeitsgründe für die Eiteilung des be-
…
Förderung der kirchlichen Kunst ein Mittel
Heft 6 / Bücherschau
187
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
(für die Auswahl und den Text) mit einer durchaus
…
abwechseln, für deren höchste Qualität der Verlag von
…
Denkmäler der Kunst in Dalmatien, heraus-
…
auf den Arbeitstisch gelegt! „Denkmäler der Kunst
…
Anschauung von Kunst und Religion möglichst zur
…
ist mit diesem Namen für immer verbunden.
…
den Eindruck der Präzision und Zuverlässigkeit für
189
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
Kunst. Kataloge des German. Nationalmuseums.
…
entgegen, die unschätzbares Hilfsmaterial für Einzel-
…
für die lokalen Kunstströmungen der Lagunenstadt,
…
auf die Erhaltung des Sinnes für Monumentalität, der
…
Kunst seit neunzehn Jahrhunderten. Eine kunst-
…
für meine Person glaube z. B., daß fast ausschließlich
…
der Bamberger Paradiesesgruppe set7t die Kunst ein,
191
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
…
„christlicher Kunst" spricht, dann gehörten auch die —
…
zeichen. — Das handliche Büchlein ist mithin für den
…
Für die Weltausstellung bedürfte Brüssel mit all'
…
dem Museum für moderne Kunst, dem Kupferstich-
…
Arbeit erreicht, für die er vollen Dank verdient. —
Umschlag
Heft_06_Umschlag_hinten_1
Pflege der kirchlichen Kunst in den Priesterseminarien. Von
…
K-owalczyk, Denkmäler der Kunst in Dalmatien. Von Fritz
…
Kunst seit neunzehn Jahrhunderten. Von Fritz WITTE . 190
…
preis beträgt für den ganzen Jahrgang M. 10.—, für den halben Jahrgang
Heft_06_Umschlag_hinten_2
des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege
Heft 7
Heft_07_Titel_1
FÜR
Heft 7 / Die Sammlung Schnütgen, [4]
Heft 7 / Eine viel genannte falsch gelesene Inschrift
Heft 7 / Die romanischen Glasmalereien in der Pfarrkirche St. Kunibert zu Köln
199
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
…
selbst Maler gewesen und deshalb das für
…
namigen des Jahres 1257 für gleich erachten zu können,
…
4) Vgl. »Zeitschrift für christliche Kunst«. X.Jahr-
203
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
…
in natürlichem Maßstab im Germanischen Museum zu
…
geschichte". »Organ für christliche Kunst«. XIV. Jahr-
…
der Auferstehung sind für den flüchtigen
Heft 7 / Über sogenannte "englische Stickereien" des XV. und XVI. Jahrhunderts
215
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
…
für Grund und Stab. Das geht nicht wohl
…
durchschlagender Gründe, für England plädiert
…
des XIII. Jahrh., der von Daroca im Museum
Heft 7 / Bücherschau
221
1910. - ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
…
motive, auch in mannigfachem Wechsel. Für die
…
eine alphabetische Aufzählung der Diözesen, für
…
stand und künstlerisch. Am wertvollsten für die
…
für eine Neuerfindung christlicher Bildhauer halten,
…
anlage für den christlichen Kultus nicht geeignet ge-
223
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
…
dogmengeschichtlicher Momente, in welche die für
…
Begriffe von wahrer Kunst, wie sie Brentano und
…
Brentanos von wahrer Kunst. Die Sammelarbeit der
…
für das Buch. Fritz Witte.
…
Daß dieses für die kunstgeschichtlichen Studien
…
Hilfsmittel für die bezüglichen Studien bilden. Nimmt
…
Mit 66 Abbildungen. Verlag der Gesellschaft für
…
digung für das Warten mag der Umstand gelten, daß er
…
sie begleitenden Text, der für den Lebenslauf und
Umschlag
Heft_07_Umschlag_hinten_1
preis beträgt für den ganzen Jahrgang M. 10.—, für den - halben Jahrgang
Heft_07_Umschlag_hinten_2
Die Kunst-
Heft 8
Heft_08_Titel_1
FÜR
Heft 8 / Die Sammlung Schnütgen, [5]
Heft 8 / Pflege der kirchlichen Kunst in den Priesterseminarien, [2]
227
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
lichen Kunst vermittelt wird; aber
…
liche Resultate erzielt, wird es in der Kunst
…
Prinzipien der kirchlichen Kunst sind daher
…
lichen Kunst auch durch gute Abbildungen
…
allein ein Museum der Kunst.
…
bindung mit dem Seminar, so möge es für
…
einem solchen Museum einmal der Anfang
…
historisches Institut, das auch für hochgestellte
…
Strebe also ein Seminar darnach, für Lehr-
229
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
Winkelmann durch seine Geschichte der Kunst
…
Gegenstände in einem Museum auch der
…
Für Lehrzwecke ist nicht notwendig, Kunst-
…
Sinn und erhalten Muster für ähnliche Samm-
…
Die Ordnung für Darstellung der Baukunst,
…
unterliegt nur jene für Paramentik. Es
…
Für den Abgang der altchristlichen, roma-
…
Um Muster für die Stoffkunde und
231
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
lung ist eine Kollektion zu gewinnen für an-
…
ein solches Museum, welches kirchlichen
…
stände einführt, das Auge für die Kunstformen
…
einem größern verschließbaren Lokale (Museum)
…
die Entwicklung der Kunst leicht zur Be-
…
Für Priester, welche in der Seelsorge nicht
…
Regel der verfügbare Raum auch für die Auf-
…
Ist der Anfang zu einem Museum in dieser
…
kennen und für kommende Zeiten zu erhalten.
233
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
Urteil reift und das Gefühl für stilistische
…
Museum nur da und dort von einem Geist-
…
gewissen Stunden das Museum aufschließt,
…
für Frankreich an 300 jener Reliefs . nach-
…
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
Urteil reift und das Gefühl für stilistische
…
Museum nur da und dort von einem Geist-
…
gewissen Stunden das Museum aufschließt,
…
für Frankreich an 300 jener Reliefs . nach-
Heft 8 / Die englischen Alabasteraltäre
235
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
mäßig für den Vertrieb durch den Handel ge-
243
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
liche und nicht für die Reliefs gemacht; dazu
Heft 8 / Ein Portatile im Nationalmuseum zu Kopenhagen
253
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
man das Email der Oberseite als Ersatz für
…
für die also dieses kein unmittelbares Vor-
…
Limburg als Kunst Stätte. Mitteilungen der
…
Poet geschaffen für Werke, die nicht nur die rein
…
bücher so kannte wie er, der auch von Haus aus für
…
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
…
man das Email der Oberseite als Ersatz für
…
für die also dieses kein unmittelbares Vor-
…
Limburg als Kunst Stätte. Mitteilungen der
…
Poet geschaffen für Werke, die nicht nur die rein
…
bücher so kannte wie er, der auch von Haus aus für
Heft 8 / Bücherschau
Umschlag
Heft 9
Heft_09_Titel_1
FÜR
Heft 9 / Die Sammlung Schnütgen, [6]
Heft 9 / Die "Göttliche Liturgie" in den Wandmalereien der Bukowiner Klosterkirchen
259
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
…
ie byzantinische Kunst der Neu-
…
Fall, und will man die Kunst der Byzantiner
…
Kunst auf dem Athos« (Petersburg 1902, russisch)
…
niger ausführlich bei Brock haus, »Die Kunst in
261
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
…
der Kunst, ohne jedoch näher diesen Gegenstand zu
…
Kunst historisch geschildert, es finden sich aber
…
sondern eine andere, für den bischöflichen
Heft 9 / Karolingisch-ottonische Einflüsse in der Architektur der Krypta zu Vreden i.W.
Heft 9 / Zwei Werke spätbyzantinischer Goldschmiedekunst im Sinaikloster
Heft 9 / Neu aufgefundenes Heft über die Glasmalerei-Technik um 1550
Heft 9 / Die spätrömischen Stoffe aus dem Sarkophag des hl. Paulinus zu Trier
281
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST _ Nr. 9.
…
in jüngerer Zeit gemachter, für die Bestimmung
283
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
…
Zeit angehören, eine Tatsache, die für die
…
sichere Unterlage für Beurteilung und Da-
…
beziehen können. Für die Geschichte der Über-
…
Verherrlichung in der bildenden Kunst aller Jahr-
…
Grundlage für die Beschreibung, die warm gehalten,
…
1910. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
…
Zeit angehören, eine Tatsache, die für die
…
sichere Unterlage für Beurteilung und Da-
…
beziehen können. Für die Geschichte der Über-
…
Verherrlichung in der bildenden Kunst aller Jahr-
…
Grundlage für die Beschreibung, die warm gehalten,
Heft 9 / Bücherschau
285
1910- — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9;
…
Wo für Anbringung symbolischer Zeichen, namentlich
…
Ziel erreicht für sich und für uns!
…
zu einem rechten persönlichen Verhältnis zur Kunst der
…
dafür, daß die richtige Beurteilung alter Kunst nicht
287
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
…
für den scharfen Denker und stets aktuellen Erzähler
…
Beschäftigung mit der kirchlichen Kunst im Kolleg,
…
dessen für die Kunstgeschichte Neapels und Italiens
…
Österreichische Kunst schätze, herausgegeben
…
schöpfender Literaturangabe abgefaßt. Für vergleichende
Umschlag
Heft 10
Heft_10_Titel_1
FÜR
Heft 10 / Die Sammlung Schnütgen, [7]
Heft 10 / Ein Pluviale mit Kapuze
Heft 10 / Eine alte Kopie des Wallfahrtsbildes zu Maria-Zell
297
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
Tages für eine Arbeit die Mitteilungen der
…
Man hat in jüngster Zeit den für die Ge-
…
Wort für eine Sache, die seit fünf
…
sein, für das Studium der Kunst eine einzelne
…
für die Ausschmückung und Erhaltung seiner
…
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
Tages für eine Arbeit die Mitteilungen der
…
Man hat in jüngster Zeit den für die Ge-
…
Wort für eine Sache, die seit fünf
…
sein, für das Studium der Kunst eine einzelne
…
für die Ausschmückung und Erhaltung seiner
Heft 10 / Neue Hoffnungen?
299
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
der für die Ästhetik allgemein gültigen Ge-
…
für kirchliche „Kunstzwecke" verausgabt, und
…
Bedeutung für Wohl und Wehe kirchlicher
…
manch frohe Hoffnung für die Zukunft der
…
ihm Dank wissen für seinebedeutungsvolle Gabe.
…
Der Zeitpunkt der Eröffnung für das genannte
…
vielerorts. Über die weiten Gefilde der Kunst
301
1910. - ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
Museum: unfl aus allen Bevölkerungsklassen
…
das ganze Museum legt, die Weihe der Religion-
…
klassischen Kunst der Griechen und Römer
…
nugtuung für den Stifter der Sammlung, daß
…
lung sollte eine Schule werden für das
…
Geist alter Kunst zu erfassen, an ihm erneut
…
die Erforschung mittelalterlicher Kunst zum
…
reinen Liebhabern alter Kunst unsere Gäste
303
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
auf dem Gebiete der Kunst geleistet, was sie
…
der alten, Anregung zu neuer Kunst. Ob in
…
liche für einige Tage nach Köln zu ziehen zu
…
Originelle in der Kunst klammert, sie scheint
…
kirchlichen Kunst, strenger sind dieser die
…
Kunst für Christen! Tüchtige, ernste Künstler
…
uns nicht, welche der christlichen Kunst ihr
…
stens verfrüht. Über all das soll „für" und
…
klären, damit jedem, der gezwungen ist, für
305
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
lung, die für sie in erster Linie geschaffen,
…
derjenigen Herren, die für die Kirchenkunst
…
für christliche Kunst". Auch da wünschen
…
wecken für ein hohes und heiliges Gut, für
…
auch auf dem Gebiete der Kunst rückständig
…
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
lung, die für sie in erster Linie geschaffen,
…
derjenigen Herren, die für die Kirchenkunst
…
für christliche Kunst". Auch da wünschen
…
wecken für ein hohes und heiliges Gut, für
…
auch auf dem Gebiete der Kunst rückständig
Heft 10 / Die Perugia-Tücher
307
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 10.
…
kritiklos für die deutsche Weberei des XVI.
…
derschaft oder Vereinigung für
…
mit zwei Streifen für einen Altar,
…
Da die Tücher für kirchlichen oder profanen
Heft 10 / Ein Ikon im Sinaikloster
Heft 10 / Bücherschau
315
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 10.
…
der schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung histo-
…
Die Monographie über das für die Kunstgeschichte
…
fügt zu werden. Für die hufeisenförmige Einziehung
…
sind mustergültig. Dank den Verfassern für diese Be-
…
sofort die „Kunst des Orients" anschließt: Der
…
Die Kunst dem Volke. Nr. 3.
…
Verständnis und Genuß der hl. Kunst und ihrer Meister-
317
1910. — ZEITSCHRIFT KÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
unterliegt keinem Zweifel, daß diese Kunst im vor-
…
sinniges Geschenk für Männer. B.
…
Aus seinem größeren Werke „Kunst und Geschichte"
…
Deutsche Kunst und Dekoration. Wohnungs-
…
Innendekoration, Zeitschrift für Wohnungskunst
…
Volk erwärmen für das, was sein ist, für seine Zeitkunst.
319
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
…
Wer die „Innendekoration" und „Deutsche Kunst und
…
werden kann für das so wichtige Andachtsgebiet der
…
fane Glückwunschkarten, besonders für Weih-
…
| Die fünf Waldstädte. Ein Buch für Menschen,
…
unbefangenen Menschenkindern, die Sinn haben für die
…
Einfache christliche Grabmäler für Nieder-
…
Für die Denkmäler niederdeutscher Landfriedhöfe
Umschlag
Heft_10_Umschlag_hinten_1
Damrich, Weihnachten in der Malerei. (Die Kunst dem
…
Luckenbach, Kunst und Geschichte. (Kleine Ausgabe.) Von
…
Keller, Die fünf Waldstädte. Ein Buch für Menschen, die
…
Högg u. Holtz, Einfache christliche Grabmal er für Nieder-
…
preis beträgt für den ganzen Jahrgang M. 10.-—, für den halben Jahrgang
Heft_10_Umschlag_hinten_2
Herausgegeben vom Rhein.Verein für Denkmalpflege und Heimatschutj
Heft 11
Heft_11_Titel_1
FÜR
Heft 11 / Die Sammlung Schnütgen, [8]
Heft 11 / Der Meister von St. Laurenz
323
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
…
schönsten Beweis liefert für die Dankbarkeit,
…
Verhältnissen. Es war die Innenseite, für
…
Tafel hängt im Germanischen Museum zu
…
Friedrich-Museum zu Berlin beweist, daß Boisseree
325
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. U.
…
vielleicht einst für den Katharinenaltars) be-
…
Jetzt Nürnberg Germ. Museum Nr. 63 H. 1,05 m,
…
dies Werk ohne Bedenken für italienisch;
…
allem, was wir bisher für die älteste kölnische
…
Opferwilligkeit für den Umbau von Grund
327
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 11.
…
sodann Aufträge für die Innenausstattung
…
Von besonderem Wert für die Geschichte
…
Vermächtnissen für den Bau und die Aus-
…
Dies Votivbild für Gerhard v. d. Wasserfass und
…
Museum Nr. 124 mit vielfigüriger Darstellung aus
…
entstand für niederländischen Import. Vergl. meinen
Heft 11 / Frühgotische kölnische Madonna der "Sammlung Schnütgen"
333
19\0. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
…
Für die ungemein reichhaltige Kollektion von
…
die der romanischen Kunst geläufigen Eck-
335
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
…
Type, sein Gefühl für den
…
für flandrisch-französisch anspricht. Lübbecke1)
Heft 11 / Der Wandtabernakel und die eucharistische Pyxis in San Damiano bei Assisi
341
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. y\.
…
worden. Die spätere Kunst hat der hl. Clara
…
der Einführung des Fronleichnamsfestes für
…
lunula für die expositio Sanctissimi
345
1910. -± ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
…
Kloster, war das Repositorium für das hl. Sakra-
…
Als im XVII. Jahrh. von Rom aus für die
…
Wandtabernakel für die alte Zeit bezeugte. —
347
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 11.
…
dem Boden aber die lunula für Einsetzung
…
miano ist also ein Beispiel für den vorwiegend
…
Für welche von beiden an sich möglichen
…
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 11.
…
dem Boden aber die lunula für Einsetzung
…
miano ist also ein Beispiel für den vorwiegend
…
Für welche von beiden an sich möglichen
Heft 11 / Nochmals das Gewebe aus dem Sarkophag des hl. Paulinus
349
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
…
zu deuten. Immerhin legt der Zweck, für
…
Geschichte der Kunst in Nord-Italien von
…
der Kunst in Großbritannien und Irland" läßt der rührige
…
byzantinische Kunst, während Venedig 6 Kapitel um-
…
— Die piemontesische und liturgische Kunst füllen
…
seits aufs wärmste empfohlenen Tafelwerks für den
…
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
…
zu deuten. Immerhin legt der Zweck, für
…
Geschichte der Kunst in Nord-Italien von
…
der Kunst in Großbritannien und Irland" läßt der rührige
…
byzantinische Kunst, während Venedig 6 Kapitel um-
…
— Die piemontesische und liturgische Kunst füllen
…
seits aufs wärmste empfohlenen Tafelwerks für den
Heft 11 / Bücherschau
351
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11,
…
ihrer Umgestaltung und Färbung für den gegebenen
…
dazu sehr wohlfeilen Hilfsmittel für den biblischen
…
Maschinen und Mechanismen. — Auch die Kunst
…
grabungen (Afrikanische Altertümer, Aegyptische Kunst,
…
turen entnommen sind, als Grundlagen für den Ver-
…
für Kunst, Kulturgeschichte und Völkerkunde der
…
kaum geschlossene Ausstellung für mohammedanische
…
asiatische Kunst. Das „Archiv" dient einer großen
…
lage bietet für weitere Forschungen.
…
ist in erster Linie die Kunst- und Kulturgeschichte,
Umschlag
Heft 12
Heft_12_Titel_1
FÜR
Heft 12 / Die Sammlung Schnütgen, [9]
Heft 12 / Der Nebenraum der St. Wolfgangskrypta zu St. Emmeram in Regensburg
359
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
…
gumenen. Hier „hielt man für diese Unglück-
…
secretus", der sich für die geschilderte Behand-
…
scheint für die Zwecke des mittelalterlichen
…
kirche zu Köln, für welche er gestiftet worden
…
existiren", für 8 Louisd'or erwarb — „freilich
…
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
…
gumenen. Hier „hielt man für diese Unglück-
…
secretus", der sich für die geschilderte Behand-
…
scheint für die Zwecke des mittelalterlichen
…
kirche zu Köln, für welche er gestiftet worden
…
existiren", für 8 Louisd'or erwarb — „freilich
Heft 12 / Die Stifter des Bartholomäusaltars
Heft 12 / Acht Scheiben Kölner Kleinmalerei des XVI. Jahrhunderts
363
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
…
für die Fenster weltlicher Bauten
…
bot gegen übertriebene Ausgaben für gemalte
…
weise für den Kundigen weiter nicht auffallend
…
gebracht wurde, wo der Handel für den
…
2) »Zeitschrift für christliche Kunst«, XX. Jahrg.
367
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
…
3) »Zeitschrift für christliche Kunst«, III. Jahrg.
Heft 12 / Kunstschätze im Sinaikloster
377
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
…
lassen. Für älter als etwa 700 möchte ich
…
Hauptmeistern ergab. — Bald lösten sich für v. Falke,
…
für christl. Kunst Bd. XVIII, 161—182 unter dem
…
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
…
lassen. Für älter als etwa 700 möchte ich
…
Hauptmeistern ergab. — Bald lösten sich für v. Falke,
…
für christl. Kunst Bd. XVIII, 161—182 unter dem
Heft 12 / Bücherschau
379
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
…
Wiedergaben führten, so war endlich die Zeit für die
…
Großtaten der Plastik für alle Zeiten. — Dem Ver-
…
wagen, Gout ist Kunst- und Kulturforscher und wird
…
was bestimmend gewesen sein könnte für Entstehung
381
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
…
Michaelsabtei mit dem grandiosen, für uns Deutsche
…
Dank wissen für eine sichere Festlegung der Archi-
…
anderen Kirche Roms. Berthier fehlt der Sinn für
…
manche wissenswerte Einzelheit, für die Kunstforschung
…
für Architektur und Kunstgewerbe, Friedr. Wolfrum
…
Empfehlung für weiteste Kreise sorgfältig zusammen-
…
Interessant sind besonders einige Entwürfe für
…
Äußerungen des Lobes haben für die Auswahl der
…
sierung wird hier manche Belehrung für Kinder, mehr
Umschlag
231
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
232
Noch leichter als eine Paramentensamm-
lung ist eine Kollektion zu gewinnen für an-
schauliche Darstellung der Geschichte und
Technik der Glasmalerei von der Skizze
an bis zum Torfe, mit welchem der Muffel-
ofen geheizt wird. Jede Glasmalerei ist im-
stande, um mäßigen Preis einen Beitrag von
Glasscherben, farbigen Butzen usf. zu liefern.
Ist die Einrichtung eines eigenen Kunst-
museums aus verschiedenen Gründen nicht
durchführbar, so besitzt doch jedes Seminar
ein solches Museum, welches kirchlichen
Schmuck enthält und Gelegenheit zu ausge-
dehnten Kunstvorlesungen gibt, nämlich die
Kapelle und die Sakristei. Die Erklärung
der kirchlichen Geräte, Gefäße und Paramente
ist unbedingt notwendig, wenn der künftige
Priester nicht mangelhaft ausgebildet zum
Schaden der Seelsorge in sein Amt eintreten soll.
In gewisser Beziehung möchte ich die
artistisch-liturgische Erklärung der genannten
Räumlichkeiten dem Besuche des wertvollsten
Museums vorziehen, weil es am unmittel-
barsten in das Verständnis der Kultgegen-
stände einführt, das Auge für die Kunstformen
schärft und Liebe zum Kulte einflößt. Welcher
Alumnus wird für die Schönheit der Liturgie
begeistert durch die rubrizistischen Vor-
lesungen über den Kirchenkalender, Okkurrenz
und Konkurrenz und Kommemoration der
Feste? Ein viel günstigeres'Licht fällt auf den
Kult, wenn er auch artistisch-liturgisch be-
leuchtet wird.
Die erworbenen Gegenstände können in
einem größern verschließbaren Lokale (Museum)
untergebracht werden und sind in diesem
Falle gegen Diebstahl .gesichert; allein es ist
zu befürchten, daß sie den Alumnen zu ferne
gerückt bleiben und nur zu Gesicht kommen
während der Unterrichtsstunde.
Der Zweck des Museums wird leichter er-
reicht, wenn Kunstwerke größerer Art, wie
Einrichtungs- und Schmuckgegenstände, auf i
Gängen und in Zimmern zur Aufstellung und
Aufhängung gelangen. Auf diese Weise sehen
die Alumnen beim Hin- und Hergehen alle
Schätze offen und frei, gewöhnen das Auge
an den Anblick und haben Gelegenheit zur
Betrachtung und Vergleichung.
Die Ordnung der Aufstellung kann eine
mehrfache sein, je nach dem Zwecke, welcher
verfolgt wird. Ist freier Raum verfügbar, so
empfiehlt sich die kunstgeschichtliche
Ordnung, weil an den einzelnen Gegenständen
die Entwicklung der Kunst leicht zur Be-
trachtung kommen kann.
Die ästhetische Aufstellung sieht nicht
auf die historische Entwicklung der Kunst-
formen, sondern erzweckt Genuß durch Auf-
stellung von wahren Kunstwerken in Gruppen.
Für Priester, welche in der Seelsorge nicht
bloß Schönheitsgefühl, sondern auch kunst-
geschichtliche Kenntnisse besitzen sollen, dürfte
diese Aufstellungsweise weniger dankbar sein.
Werden die Gänge und die Zimmer des
Seminars zur Aufstellung benutzt, so ist in der
Regel der verfügbare Raum auch für die Auf-
stellung maßgebend, und es kann nicht ver-
mieden werden, daß Altes und Neues, Schönes
und Minderwertiges sich bunt durcheinander
mischt. Suche man nur nach dem trinita-
rischen Gesetze der Einheit und Verschieden-
heit zu gruppieren, und man darf diese Auf-
stellungsweise nicht einmal sehr beklagen, weil
sie zu gefälligen Resultaten führte und weil
auch in den Kirchen die Geräte nicht immer
in kunstgeschichtlicher Rücksicht aneinander-
gereiht werden, sondern in Rücksicht auf das
liturgische und lokale Bedürfnis. Auch das
Leben hat ein System, aber nicht immer das
System der Schule. Wir weisen nur hin auf
die Reihenfolge der Lesungen an den Sonn-
und Festtagen während der hl. Messe.
Ist der Anfang zu einem Museum in dieser
oder jener Form einmal gemacht, so müssen
die gewonnenen Gegenstände genau inven-
tarisiert werden, um den Besitzstand zu
kennen und für kommende Zeiten zu erhalten.
Weil die Übersicht in einem Inventare
durch viele Nebenbemerkungen zu sehr leiden
würde, so ist geraten, gleichzeitig neben dem
Inventar auf halben Foliobogen zu verzeichnen
Stoff, Maße, Alter, Herkunft, Ankaufspreis,
Beschreibung, Literatur des Gegenstandes usf.
Sind einmal mehrere Schätze derselben Art
gesammelt und wollen die Maße nicht mehr
zur Unterscheidung der Gegenstände aus-
reichen, z. B. Madonna mit Kind, Rauch-
fässer, so genügt eine kleine Feder- oder
Beistiftskizze am Rande, um den Gegenstand
sicher wiederzuerkennen.
Sind diese Notizen halbbrüchig auf Folio-
bogen geschrieben, so können diese Bogen in
einen Sönneckenschen Ordner eingefügt und
nach Wunsch jede Minute wieder verrückt
werden.
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
232
Noch leichter als eine Paramentensamm-
lung ist eine Kollektion zu gewinnen für an-
schauliche Darstellung der Geschichte und
Technik der Glasmalerei von der Skizze
an bis zum Torfe, mit welchem der Muffel-
ofen geheizt wird. Jede Glasmalerei ist im-
stande, um mäßigen Preis einen Beitrag von
Glasscherben, farbigen Butzen usf. zu liefern.
Ist die Einrichtung eines eigenen Kunst-
museums aus verschiedenen Gründen nicht
durchführbar, so besitzt doch jedes Seminar
ein solches Museum, welches kirchlichen
Schmuck enthält und Gelegenheit zu ausge-
dehnten Kunstvorlesungen gibt, nämlich die
Kapelle und die Sakristei. Die Erklärung
der kirchlichen Geräte, Gefäße und Paramente
ist unbedingt notwendig, wenn der künftige
Priester nicht mangelhaft ausgebildet zum
Schaden der Seelsorge in sein Amt eintreten soll.
In gewisser Beziehung möchte ich die
artistisch-liturgische Erklärung der genannten
Räumlichkeiten dem Besuche des wertvollsten
Museums vorziehen, weil es am unmittel-
barsten in das Verständnis der Kultgegen-
stände einführt, das Auge für die Kunstformen
schärft und Liebe zum Kulte einflößt. Welcher
Alumnus wird für die Schönheit der Liturgie
begeistert durch die rubrizistischen Vor-
lesungen über den Kirchenkalender, Okkurrenz
und Konkurrenz und Kommemoration der
Feste? Ein viel günstigeres'Licht fällt auf den
Kult, wenn er auch artistisch-liturgisch be-
leuchtet wird.
Die erworbenen Gegenstände können in
einem größern verschließbaren Lokale (Museum)
untergebracht werden und sind in diesem
Falle gegen Diebstahl .gesichert; allein es ist
zu befürchten, daß sie den Alumnen zu ferne
gerückt bleiben und nur zu Gesicht kommen
während der Unterrichtsstunde.
Der Zweck des Museums wird leichter er-
reicht, wenn Kunstwerke größerer Art, wie
Einrichtungs- und Schmuckgegenstände, auf i
Gängen und in Zimmern zur Aufstellung und
Aufhängung gelangen. Auf diese Weise sehen
die Alumnen beim Hin- und Hergehen alle
Schätze offen und frei, gewöhnen das Auge
an den Anblick und haben Gelegenheit zur
Betrachtung und Vergleichung.
Die Ordnung der Aufstellung kann eine
mehrfache sein, je nach dem Zwecke, welcher
verfolgt wird. Ist freier Raum verfügbar, so
empfiehlt sich die kunstgeschichtliche
Ordnung, weil an den einzelnen Gegenständen
die Entwicklung der Kunst leicht zur Be-
trachtung kommen kann.
Die ästhetische Aufstellung sieht nicht
auf die historische Entwicklung der Kunst-
formen, sondern erzweckt Genuß durch Auf-
stellung von wahren Kunstwerken in Gruppen.
Für Priester, welche in der Seelsorge nicht
bloß Schönheitsgefühl, sondern auch kunst-
geschichtliche Kenntnisse besitzen sollen, dürfte
diese Aufstellungsweise weniger dankbar sein.
Werden die Gänge und die Zimmer des
Seminars zur Aufstellung benutzt, so ist in der
Regel der verfügbare Raum auch für die Auf-
stellung maßgebend, und es kann nicht ver-
mieden werden, daß Altes und Neues, Schönes
und Minderwertiges sich bunt durcheinander
mischt. Suche man nur nach dem trinita-
rischen Gesetze der Einheit und Verschieden-
heit zu gruppieren, und man darf diese Auf-
stellungsweise nicht einmal sehr beklagen, weil
sie zu gefälligen Resultaten führte und weil
auch in den Kirchen die Geräte nicht immer
in kunstgeschichtlicher Rücksicht aneinander-
gereiht werden, sondern in Rücksicht auf das
liturgische und lokale Bedürfnis. Auch das
Leben hat ein System, aber nicht immer das
System der Schule. Wir weisen nur hin auf
die Reihenfolge der Lesungen an den Sonn-
und Festtagen während der hl. Messe.
Ist der Anfang zu einem Museum in dieser
oder jener Form einmal gemacht, so müssen
die gewonnenen Gegenstände genau inven-
tarisiert werden, um den Besitzstand zu
kennen und für kommende Zeiten zu erhalten.
Weil die Übersicht in einem Inventare
durch viele Nebenbemerkungen zu sehr leiden
würde, so ist geraten, gleichzeitig neben dem
Inventar auf halben Foliobogen zu verzeichnen
Stoff, Maße, Alter, Herkunft, Ankaufspreis,
Beschreibung, Literatur des Gegenstandes usf.
Sind einmal mehrere Schätze derselben Art
gesammelt und wollen die Maße nicht mehr
zur Unterscheidung der Gegenstände aus-
reichen, z. B. Madonna mit Kind, Rauch-
fässer, so genügt eine kleine Feder- oder
Beistiftskizze am Rande, um den Gegenstand
sicher wiederzuerkennen.
Sind diese Notizen halbbrüchig auf Folio-
bogen geschrieben, so können diese Bogen in
einen Sönneckenschen Ordner eingefügt und
nach Wunsch jede Minute wieder verrückt
werden.