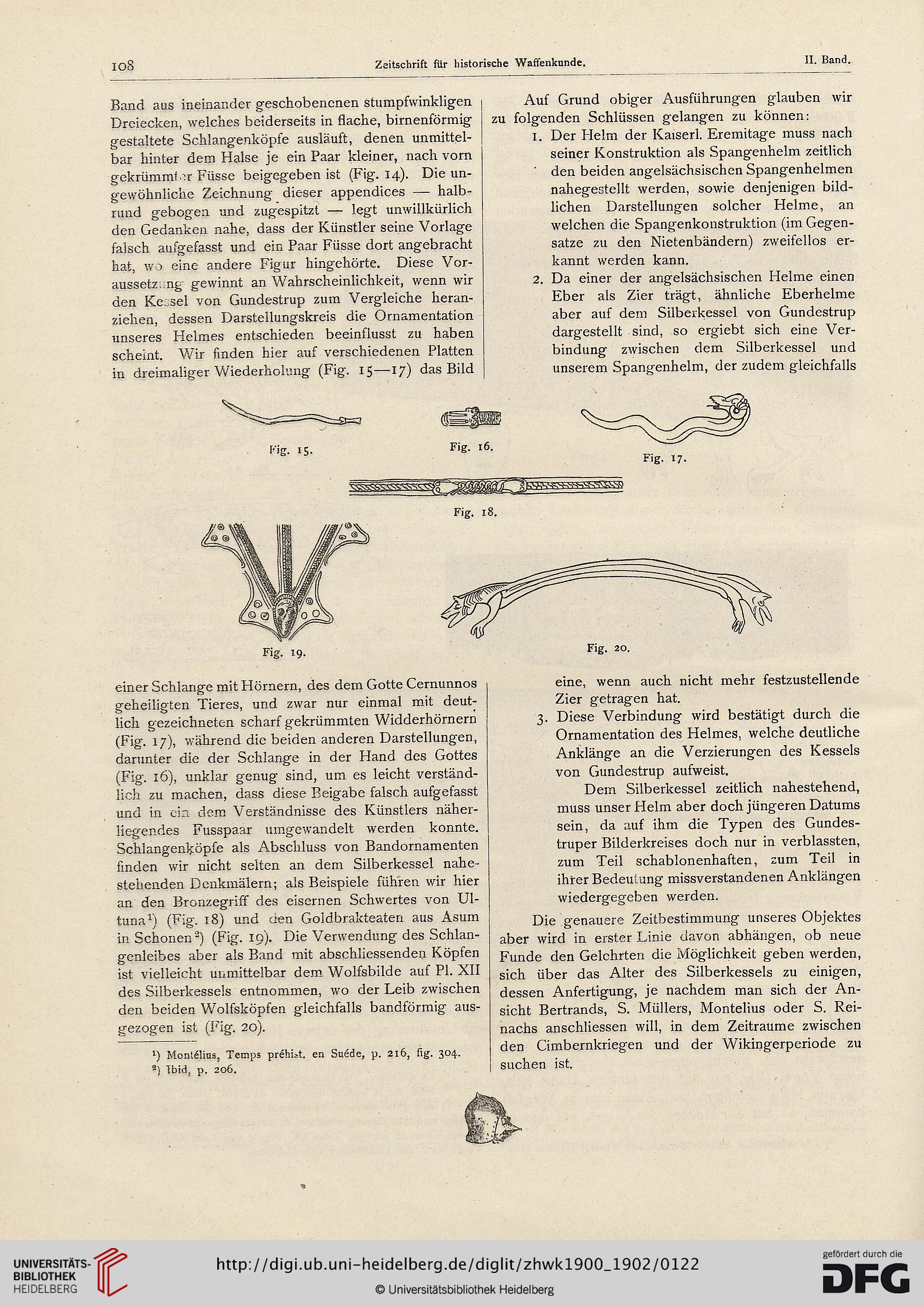Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Band.
108
Band aus ineinander geschobenenen stumpfwinkligen
Dreiecken, welches beiderseits in flache, birnenförmig
gestaltete Schlangenköpfe ausläuft, denen unmittel-
bar hinter dem Halse je ein Paar kleiner, nach vorn
gekrümmter Füsse beigegeben ist (Fig. 14). Die un-
gewöhnliche Zeichnung dieser appendices — halb-
rund gebogen und zugespitzt — legt unwillkürlich
den Gedanken nahe, dass der Künstler seine Vorlage
falsch aufgefasst und ein Paar Füsse dort angebracht
hat, wo eine andere Figur hingehörte. Diese Vor-
aussetz. ng gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir
den Ke sei von Gundestrup zum Vergleiche heran-
ziehen, dessen Darstellungskreis die Ornamentation
unseres Helmes entschieden beeinflusst zu haben
scheint. Wir finden hier auf verschiedenen Platten
in dreimaliger Wiederholung (Fig. 15—17) das Bild
Fig. 15. Fig. 16.
Auf Grund obiger Ausführungen glauben wir
zu folgenden Schlüssen gelangen zu können:
1. Der Plelrn der Kaiserl. Eremitage muss nach
seiner Konstruktion als Spangenhelm zeitlich
den beiden angelsächsischen Spangenhelmen
nahegestellt werden, sowie denjenigen bild-
lichen Darstellungen solcher Helme, an
welchen die Spangenkonstruktion (im Gegen-
sätze zu den Nietenbändern) zweifellos er-
kannt werden kann.
2. Da einer der angelsächsischen Helme einen
Eber als Zier trägt, ähnliche Eberhelme
aber auf dem Silberkessel von Gundestrup
dargestellt sind, so ergiebt sich eine Ver-
bindung zwischen dem Silberkessel und
unserem Spangenhelm, der zudem gleichfalls
Fig. 17.
Fig. 18.
einer Schlange mit Hörnern, des dem Gotte Cernunnos
geheiligten Tieres, und zwar nur einmal mit deut-
lich gezeichneten scharf gekrümmten Widderhörnern
(Fig. 17), während die beiden anderen Darstellungen,
darunter die der Schlange in der Hand des Gottes
(Fig. 16), unklar genug sind, um es leicht verständ-
lich zu machen, dass diese Beigabe falsch aufgefasst
und in ein dem Verständnisse des Künstlers näher-
liegendes Fusspaar umgewandelt werden konnte.
Schlangenköpfe als Abschluss von Bandornamenten
finden wir nicht selten an dem Silberkessel nahe-
stehenden Denkmälern; als Beispiele führen wir hier
an den Bronzegriff des eisernen Schwertes von Ul-
tuna1) (Fig. 18) und den Goldbrakteaten aus Asum
in Schonen'2) (Fig. 19). Die Verwendung des Schlan-
genleibes aber als Band mit abschliessenden Köpfen
ist vielleicht unmittelbar dem Wolfsbilde auf PI. XII
des Silberkessels entnommen, wo der Leib zwischen
den beiden Wolfsköpfen gleichfalls bandförmig aus-
gezogen ist (Fig. 20).
l) Mont^lius, Temps prehnt. en Suede, p. 216, fig. 304.
2! Ibid, p, 206.
eine, wenn auch nicht mehr festzustellende
Zier getragen hat.
3. Diese Verbindung wird bestätigt durch die
Ornamentation des Helmes, welche deutliche
Anklänge an die Verzierungen des Kessels
von Gundestrup aufweist.
Dem Silberkessel zeitlich nahestehend,
muss unser Helm aber doch jüngeren Datums
sein, da auf ihm die Typen des Gundes-
truper Bilderkreises doch nur in verblassten,
zum Teil schablonenhaften, zum Teil in
ihrer Bedeutung missverstandenen Anklängen
wiedergegeben werden.
Die genauere Zeitbestimmung unseres Objektes
aber wird in erster Linie davon abhängen, ob neue
Funde den Gelehrten die Möglichkeit geben werden,
sich über das Alter des Silberkessels zu einigen,
dessen Anfertigung, je nachdem man sich der An-
sicht Bertrands, S. Müllers, Montelius oder S. Rei-
nachs anschliessen will, in dem Zeiträume zwischen
den Cimbernkriegen und der Wikingerperiode zu
suchen ist.
II. Band.
108
Band aus ineinander geschobenenen stumpfwinkligen
Dreiecken, welches beiderseits in flache, birnenförmig
gestaltete Schlangenköpfe ausläuft, denen unmittel-
bar hinter dem Halse je ein Paar kleiner, nach vorn
gekrümmter Füsse beigegeben ist (Fig. 14). Die un-
gewöhnliche Zeichnung dieser appendices — halb-
rund gebogen und zugespitzt — legt unwillkürlich
den Gedanken nahe, dass der Künstler seine Vorlage
falsch aufgefasst und ein Paar Füsse dort angebracht
hat, wo eine andere Figur hingehörte. Diese Vor-
aussetz. ng gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir
den Ke sei von Gundestrup zum Vergleiche heran-
ziehen, dessen Darstellungskreis die Ornamentation
unseres Helmes entschieden beeinflusst zu haben
scheint. Wir finden hier auf verschiedenen Platten
in dreimaliger Wiederholung (Fig. 15—17) das Bild
Fig. 15. Fig. 16.
Auf Grund obiger Ausführungen glauben wir
zu folgenden Schlüssen gelangen zu können:
1. Der Plelrn der Kaiserl. Eremitage muss nach
seiner Konstruktion als Spangenhelm zeitlich
den beiden angelsächsischen Spangenhelmen
nahegestellt werden, sowie denjenigen bild-
lichen Darstellungen solcher Helme, an
welchen die Spangenkonstruktion (im Gegen-
sätze zu den Nietenbändern) zweifellos er-
kannt werden kann.
2. Da einer der angelsächsischen Helme einen
Eber als Zier trägt, ähnliche Eberhelme
aber auf dem Silberkessel von Gundestrup
dargestellt sind, so ergiebt sich eine Ver-
bindung zwischen dem Silberkessel und
unserem Spangenhelm, der zudem gleichfalls
Fig. 17.
Fig. 18.
einer Schlange mit Hörnern, des dem Gotte Cernunnos
geheiligten Tieres, und zwar nur einmal mit deut-
lich gezeichneten scharf gekrümmten Widderhörnern
(Fig. 17), während die beiden anderen Darstellungen,
darunter die der Schlange in der Hand des Gottes
(Fig. 16), unklar genug sind, um es leicht verständ-
lich zu machen, dass diese Beigabe falsch aufgefasst
und in ein dem Verständnisse des Künstlers näher-
liegendes Fusspaar umgewandelt werden konnte.
Schlangenköpfe als Abschluss von Bandornamenten
finden wir nicht selten an dem Silberkessel nahe-
stehenden Denkmälern; als Beispiele führen wir hier
an den Bronzegriff des eisernen Schwertes von Ul-
tuna1) (Fig. 18) und den Goldbrakteaten aus Asum
in Schonen'2) (Fig. 19). Die Verwendung des Schlan-
genleibes aber als Band mit abschliessenden Köpfen
ist vielleicht unmittelbar dem Wolfsbilde auf PI. XII
des Silberkessels entnommen, wo der Leib zwischen
den beiden Wolfsköpfen gleichfalls bandförmig aus-
gezogen ist (Fig. 20).
l) Mont^lius, Temps prehnt. en Suede, p. 216, fig. 304.
2! Ibid, p, 206.
eine, wenn auch nicht mehr festzustellende
Zier getragen hat.
3. Diese Verbindung wird bestätigt durch die
Ornamentation des Helmes, welche deutliche
Anklänge an die Verzierungen des Kessels
von Gundestrup aufweist.
Dem Silberkessel zeitlich nahestehend,
muss unser Helm aber doch jüngeren Datums
sein, da auf ihm die Typen des Gundes-
truper Bilderkreises doch nur in verblassten,
zum Teil schablonenhaften, zum Teil in
ihrer Bedeutung missverstandenen Anklängen
wiedergegeben werden.
Die genauere Zeitbestimmung unseres Objektes
aber wird in erster Linie davon abhängen, ob neue
Funde den Gelehrten die Möglichkeit geben werden,
sich über das Alter des Silberkessels zu einigen,
dessen Anfertigung, je nachdem man sich der An-
sicht Bertrands, S. Müllers, Montelius oder S. Rei-
nachs anschliessen will, in dem Zeiträume zwischen
den Cimbernkriegen und der Wikingerperiode zu
suchen ist.