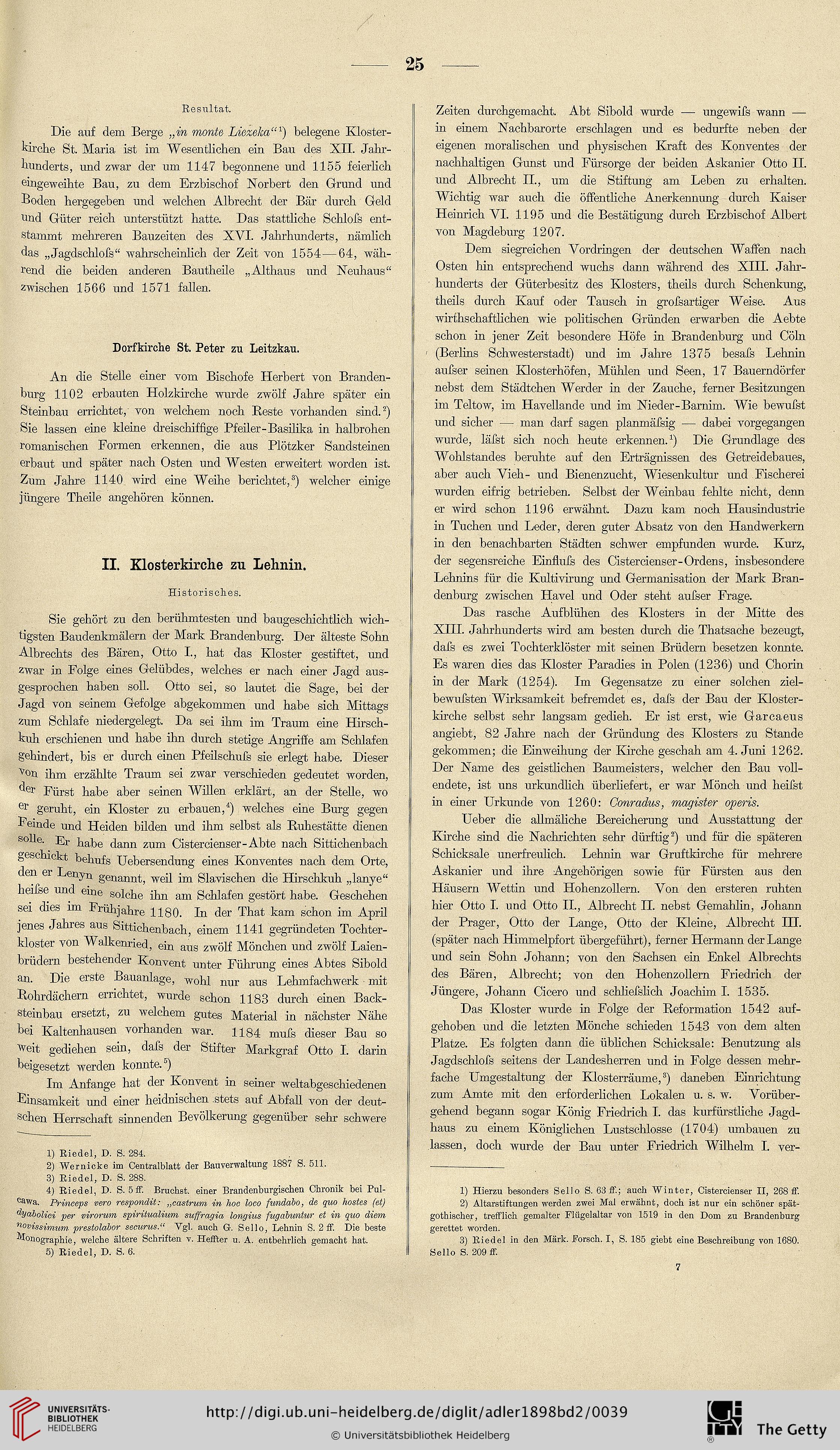25
Resultat.
Die auf dem Berge „ in monte Lieze/ca“ 1) belegene Kloster-
kirche St. Maria ist im Wesentlichen ein Bau des XII. Jalir-
liunderts, und zwar der um 1147 begonnene und 1155 feierhch
eingeweilite Bau, zu dem Erzbischof Norbert den Gfrund und
Boden hergegeben und welchen Albrecht der Bär durcli Geld
nnd Güter reich unterstützt hatte. Das stattliche Sclilofs ent-
stammt mehreren Bauzeiten des XVI. Jahrhunderts, nämlich
das „Jagdschlofs“ wahrscheinlich der Zeit, von 1554—G4, wäh-
rend die beiden anderen Bautheile „Althaus und Xeuhaus“
zwischen 1506 und 1571 fallen.
Dorfkirche St. Peter zu Leitzkan.
An die Stelle einer vom Bischofe Herbert von Branden-
burg 1102 erbauten Holzkirche wurde zwölf Jahre später ein
Steinbau erriclitet, von welchem noch Reste vorhanden sind. 2)
Sie lassen eine kleine dreischiffige Pfeiler-Basilika in halbrohen
l’omanisclien Formen erkennen, die aus Plötzker Sandsteinen
erbaut und später nach Osten und Westen erweitert worden ist,
Zum Jahre 1140 wird eine Weihe bericlitet, 3) welclier einige
jüngere Theile angehören können.
II. Klosterkirche zn Lehnin.
Historisches.
Sie gehört zu den berühmtesten und baugeschichtlich wicli-
tigsten Baudenkmälern der Mark Brandenburg. Der älteste Sohn
Albrechts des Bäi’en, Otto I., ha.t das Kloster gestiftet, und
zwar in Folge eines Gelübdes, welches er nacli einer Jagd aus-
gesprochen haben soll. Otto sei, so lautet die Sage, bei der
Jagd von seinern Gefolge abgekommen und habe sich Mittags
zum Schlafe niedergelegt. Da sei ilnn im Traum eine Hirsch-
kuh erschienen und habe lhn durch stetige Angrifie am Schlafen
gehindert, bis er durch einen Pfeilscliufs sie erlegt habe. Dieser
v°i i ilnn erzählte Traum sei zwar verscliieden gedeutet worden,
(fer Fürst habe aber seinen Willen erklärt, an der Stelle, wo
er geruht, ein Ivloster zu erbauen, 4) welches eine Burg gegen
Peinde und Heiden bilden und ihm selbst als Buhestätte dienen
solle. Er habe dann zum Cistercienser-Abte nach Sittichenbach
geschickt behufs Uebersenclung eines Konventes nach dem Orte,
( en er enyn genannt, weil im Slavischen die Hirschkuh „lanye“
licilse und eine solche ihn am Schlafen gestört habe. Geschehen
sei clies im Frühjahre 1180. In cler That kam schon irn April
jenes Jahres aus Sittichenbach, einem 1141 gegründeten Tochter-
kloster von Walkenried, ein aus zwölf Mönchen und zwölf Laien-
brüdern bestehender Konvent unter Führung eines Abtes Sibold
an. Die erste Bauanlage, wohl nur aus Lehmfachwerk mit
Rohrdächern erriclitet, wurde schon 1183 clurch einen Back-
steinbau ersetzt, zu welchem gutes Material in nächster Nähe
kei Kaltenhausen vorhanden war. 1184 mufs clieser Bau so
weit gediehen sein, dafs der Stifter Markgraf Otto I. darin
beigesetzt werden koimte. 5)
Im Anfange hat cler Konvent in seiner weltabgeschiedenen
Finsamkeit und einer heidnischen stets auf Abfall von der deut-
schen Herrscliaft sinnenden Bevölkerung gegenüber sehr schwere
1) Eiedel, D. S. 284.
2) Wernicke im Centralblatt der Bauverwaltung 1887 S. 511.
3) Riedel, D. S. 288.
4) Eiedei, D. S. 5 flf. Bruchst. einer Brandenburgischen Chronik bei Pul-
Cawa. Princeps vcro respondit: „castrwn in hoe loco fundabo, de quo hostes (et)
dyabolici per virorum spiritualium suffragia longius fugabuntur et in quo diem
n°vissimum prestolabor securus.“ Ygl. auch G. Sello, Lehnin S. 2 ff. Die beste
^tonographie, welche iiltere Schriften v. Heffter u. A. entbehrlich gemacht hat.
5) Eiedel, D. S. 6.
Zeiten durchgemacht. Abt Sibolcl wurde — ungewifs wann —
in einem Nachbarorte erschlagen und es bedurfte neben der
eigenen moralischen und physischen Kraft cles Konventes der
nachhaltigen Gunst und Fürsorge cler beiden Askanier Otto II.
und Albrecht II., um die Stiftung am Leben zu erhalten.
Wichtig war aucli die öffentliche Anerkennung durch Kaiser
Heinrich VI. 1195 und die Bestätigung durch Erzbischof Albert
vou Magdeburg 1207.
Dem siegreichen Vordringen der deutschen Waffen nacli
Osten liin entsprechend wuchs dann während des XIII. Jahr-
iiunderts der Güterbesitz des Ivlosters, theils durch Schenkung,
tlieils durch Kauf oder Tauscli in grofsartiger Weise. Aus
wirthschaftlichen wie politischen Gründen erwarben die Aebte
schon in jener Zeit besondere Höfe in Brandenburg und Cöln
(Berlins Schwesterstadt) und im Jahre 1375 besafs Lehnin
aufser seinen Klosterhöfen, Mühlen und Seen, 17 Bauerndörfer
nebst dem Städtchen Werder in der Zauche, ferner Besitzungen
im Teltow, irn Havellande und im Nieder-Barnim. MJe bewufst
und sicher — man darf sagen planmäfsig — dabei vorgegangen
wurde, läfst sich noch heute erkcimen. 1) Die Grundlage des
Wohlstandes beruhte auf deu Erträgnissen des Getreidebaues,
aber auch Vieiv- und Bienenzucht, Wiesenkultur und Fischerei
wurden eifrig betrieben. Selbst der Weinbau felilte nicht, denn
er wird schon 1196 erwähnt. Dazu kam noch Hausindustrie
in Tuchen und Leder, deren guter Absatz von den Handwerkern
in den benachbarten Städten schwer empfunden wurde. Kurz,
der segensreiche Einflufs des Cistercienser-Ordens, insbesondere
Lehnins für die Kultivirung und Germanisation der Mark Bran-
denhurg zwischen Havel und Oder steht aufser Frage.
Das rasche Aufblühen des Klosters in der Mitte des
XIII. Jahrhunderts wird am besten durch die Thatsache bezeugt,
dafs es zwei Tochterklöster mit seinen Brüdern hesetzen konnte.
Es waren dies das Ivloster Paradies in Polen (1236) und Chorin
in der Mark (1254). Im Gegensatze zu einer solchen ziel-
bewufsten Wirksamkeit befremdet es, dafs der Bau der Kloster-
ldrche selbst sehr langsam gedieh. Er ist erst, wie Garcaeus
angiebt, 82 Jahre nacli der Griindung des Klosters zu Stande
gekonnnen; die Einweihung der Kirche geschah am 4. Juni 1262.
Der Name des geisthchen Baumeisters, welcher den Bau voll-
endete, ist uns urkundlicli überhefert, er war Mönch und lieifst
in einer Urkunde von 1260: Conradus, magister operis.
Ueher die allmähche Bereicherung und Ausstattung der
Kirche sind die Nachrichten sehr dürftig 2) und für die späteren
Scliicksale unerfreulich. Lelmin war Gruftkirche fiir mehrere
Askanier und iln’e Angehörigen sowie für Fürsten aus den
Häusern Wettin und Hohenzollern. Von den ersteren ruhten
hier Otto I. und Otto II., Albrecht II. nebst Gemahlin, Johann
der Prager, Otto der Lange, Otto der Kleine, Albrecht III.
(später nach Himmelpfort übergeführt), ferner Hermann derLange
und sein Sohn Johann; von den Sachsen ein Enkel Albrechts
des Bären, Albrecht; von den Hohenzollern Friedrich der
Jüngere, Joliann Cicero und schliefslich Joachim I. 1535.
Das Kloster wurde in Folge der Reformation 1542 auf-
gehoben und die letzten Mönche schieden 1543 von dem alten
Platze. Es folgten dann die üblichen Schicksale: Benutzung als
Jagdschlofs seitens der Landesherren und in Folge dessen mehr-
fache Umgestaltung der Klosterräume, 3) daneben Einrichtung
zum Arnte mit den erforderlichen Lokalen u. s. w. Voriiber-
gehend begann sogar König Friedrich I. das kurfürstliche Jagd-
haus zu einem Könighchen Lustschlosse (1704) umbauen zu
lassen, doch wurde der Bau unter Friedrich Wilhelm I. ver-
1) Hierzu besonders Sello S. 63 ff.; auch Winter, Cistercienser II, 268 ff.
2) Altarstiftungen werden zwei Mal erwähnt, doch ist nur ein schöner spiit-
gothischer, trefflich gemalter Fliigelaltar von 1519 in den Dom zu Brandenburg
gerettet worden.
3) Eiedel in den Märk. Forsch. I, S. 185 giebt eine Beschreibung von 1680.
Sello S. 209 ff.
7
Resultat.
Die auf dem Berge „ in monte Lieze/ca“ 1) belegene Kloster-
kirche St. Maria ist im Wesentlichen ein Bau des XII. Jalir-
liunderts, und zwar der um 1147 begonnene und 1155 feierhch
eingeweilite Bau, zu dem Erzbischof Norbert den Gfrund und
Boden hergegeben und welchen Albrecht der Bär durcli Geld
nnd Güter reich unterstützt hatte. Das stattliche Sclilofs ent-
stammt mehreren Bauzeiten des XVI. Jahrhunderts, nämlich
das „Jagdschlofs“ wahrscheinlich der Zeit, von 1554—G4, wäh-
rend die beiden anderen Bautheile „Althaus und Xeuhaus“
zwischen 1506 und 1571 fallen.
Dorfkirche St. Peter zu Leitzkan.
An die Stelle einer vom Bischofe Herbert von Branden-
burg 1102 erbauten Holzkirche wurde zwölf Jahre später ein
Steinbau erriclitet, von welchem noch Reste vorhanden sind. 2)
Sie lassen eine kleine dreischiffige Pfeiler-Basilika in halbrohen
l’omanisclien Formen erkennen, die aus Plötzker Sandsteinen
erbaut und später nach Osten und Westen erweitert worden ist,
Zum Jahre 1140 wird eine Weihe bericlitet, 3) welclier einige
jüngere Theile angehören können.
II. Klosterkirche zn Lehnin.
Historisches.
Sie gehört zu den berühmtesten und baugeschichtlich wicli-
tigsten Baudenkmälern der Mark Brandenburg. Der älteste Sohn
Albrechts des Bäi’en, Otto I., ha.t das Kloster gestiftet, und
zwar in Folge eines Gelübdes, welches er nacli einer Jagd aus-
gesprochen haben soll. Otto sei, so lautet die Sage, bei der
Jagd von seinern Gefolge abgekommen und habe sich Mittags
zum Schlafe niedergelegt. Da sei ilnn im Traum eine Hirsch-
kuh erschienen und habe lhn durch stetige Angrifie am Schlafen
gehindert, bis er durch einen Pfeilscliufs sie erlegt habe. Dieser
v°i i ilnn erzählte Traum sei zwar verscliieden gedeutet worden,
(fer Fürst habe aber seinen Willen erklärt, an der Stelle, wo
er geruht, ein Ivloster zu erbauen, 4) welches eine Burg gegen
Peinde und Heiden bilden und ihm selbst als Buhestätte dienen
solle. Er habe dann zum Cistercienser-Abte nach Sittichenbach
geschickt behufs Uebersenclung eines Konventes nach dem Orte,
( en er enyn genannt, weil im Slavischen die Hirschkuh „lanye“
licilse und eine solche ihn am Schlafen gestört habe. Geschehen
sei clies im Frühjahre 1180. In cler That kam schon irn April
jenes Jahres aus Sittichenbach, einem 1141 gegründeten Tochter-
kloster von Walkenried, ein aus zwölf Mönchen und zwölf Laien-
brüdern bestehender Konvent unter Führung eines Abtes Sibold
an. Die erste Bauanlage, wohl nur aus Lehmfachwerk mit
Rohrdächern erriclitet, wurde schon 1183 clurch einen Back-
steinbau ersetzt, zu welchem gutes Material in nächster Nähe
kei Kaltenhausen vorhanden war. 1184 mufs clieser Bau so
weit gediehen sein, dafs der Stifter Markgraf Otto I. darin
beigesetzt werden koimte. 5)
Im Anfange hat cler Konvent in seiner weltabgeschiedenen
Finsamkeit und einer heidnischen stets auf Abfall von der deut-
schen Herrscliaft sinnenden Bevölkerung gegenüber sehr schwere
1) Eiedel, D. S. 284.
2) Wernicke im Centralblatt der Bauverwaltung 1887 S. 511.
3) Riedel, D. S. 288.
4) Eiedei, D. S. 5 flf. Bruchst. einer Brandenburgischen Chronik bei Pul-
Cawa. Princeps vcro respondit: „castrwn in hoe loco fundabo, de quo hostes (et)
dyabolici per virorum spiritualium suffragia longius fugabuntur et in quo diem
n°vissimum prestolabor securus.“ Ygl. auch G. Sello, Lehnin S. 2 ff. Die beste
^tonographie, welche iiltere Schriften v. Heffter u. A. entbehrlich gemacht hat.
5) Eiedel, D. S. 6.
Zeiten durchgemacht. Abt Sibolcl wurde — ungewifs wann —
in einem Nachbarorte erschlagen und es bedurfte neben der
eigenen moralischen und physischen Kraft cles Konventes der
nachhaltigen Gunst und Fürsorge cler beiden Askanier Otto II.
und Albrecht II., um die Stiftung am Leben zu erhalten.
Wichtig war aucli die öffentliche Anerkennung durch Kaiser
Heinrich VI. 1195 und die Bestätigung durch Erzbischof Albert
vou Magdeburg 1207.
Dem siegreichen Vordringen der deutschen Waffen nacli
Osten liin entsprechend wuchs dann während des XIII. Jahr-
iiunderts der Güterbesitz des Ivlosters, theils durch Schenkung,
tlieils durch Kauf oder Tauscli in grofsartiger Weise. Aus
wirthschaftlichen wie politischen Gründen erwarben die Aebte
schon in jener Zeit besondere Höfe in Brandenburg und Cöln
(Berlins Schwesterstadt) und im Jahre 1375 besafs Lehnin
aufser seinen Klosterhöfen, Mühlen und Seen, 17 Bauerndörfer
nebst dem Städtchen Werder in der Zauche, ferner Besitzungen
im Teltow, irn Havellande und im Nieder-Barnim. MJe bewufst
und sicher — man darf sagen planmäfsig — dabei vorgegangen
wurde, läfst sich noch heute erkcimen. 1) Die Grundlage des
Wohlstandes beruhte auf deu Erträgnissen des Getreidebaues,
aber auch Vieiv- und Bienenzucht, Wiesenkultur und Fischerei
wurden eifrig betrieben. Selbst der Weinbau felilte nicht, denn
er wird schon 1196 erwähnt. Dazu kam noch Hausindustrie
in Tuchen und Leder, deren guter Absatz von den Handwerkern
in den benachbarten Städten schwer empfunden wurde. Kurz,
der segensreiche Einflufs des Cistercienser-Ordens, insbesondere
Lehnins für die Kultivirung und Germanisation der Mark Bran-
denhurg zwischen Havel und Oder steht aufser Frage.
Das rasche Aufblühen des Klosters in der Mitte des
XIII. Jahrhunderts wird am besten durch die Thatsache bezeugt,
dafs es zwei Tochterklöster mit seinen Brüdern hesetzen konnte.
Es waren dies das Ivloster Paradies in Polen (1236) und Chorin
in der Mark (1254). Im Gegensatze zu einer solchen ziel-
bewufsten Wirksamkeit befremdet es, dafs der Bau der Kloster-
ldrche selbst sehr langsam gedieh. Er ist erst, wie Garcaeus
angiebt, 82 Jahre nacli der Griindung des Klosters zu Stande
gekonnnen; die Einweihung der Kirche geschah am 4. Juni 1262.
Der Name des geisthchen Baumeisters, welcher den Bau voll-
endete, ist uns urkundlicli überhefert, er war Mönch und lieifst
in einer Urkunde von 1260: Conradus, magister operis.
Ueher die allmähche Bereicherung und Ausstattung der
Kirche sind die Nachrichten sehr dürftig 2) und für die späteren
Scliicksale unerfreulich. Lelmin war Gruftkirche fiir mehrere
Askanier und iln’e Angehörigen sowie für Fürsten aus den
Häusern Wettin und Hohenzollern. Von den ersteren ruhten
hier Otto I. und Otto II., Albrecht II. nebst Gemahlin, Johann
der Prager, Otto der Lange, Otto der Kleine, Albrecht III.
(später nach Himmelpfort übergeführt), ferner Hermann derLange
und sein Sohn Johann; von den Sachsen ein Enkel Albrechts
des Bären, Albrecht; von den Hohenzollern Friedrich der
Jüngere, Joliann Cicero und schliefslich Joachim I. 1535.
Das Kloster wurde in Folge der Reformation 1542 auf-
gehoben und die letzten Mönche schieden 1543 von dem alten
Platze. Es folgten dann die üblichen Schicksale: Benutzung als
Jagdschlofs seitens der Landesherren und in Folge dessen mehr-
fache Umgestaltung der Klosterräume, 3) daneben Einrichtung
zum Arnte mit den erforderlichen Lokalen u. s. w. Voriiber-
gehend begann sogar König Friedrich I. das kurfürstliche Jagd-
haus zu einem Könighchen Lustschlosse (1704) umbauen zu
lassen, doch wurde der Bau unter Friedrich Wilhelm I. ver-
1) Hierzu besonders Sello S. 63 ff.; auch Winter, Cistercienser II, 268 ff.
2) Altarstiftungen werden zwei Mal erwähnt, doch ist nur ein schöner spiit-
gothischer, trefflich gemalter Fliigelaltar von 1519 in den Dom zu Brandenburg
gerettet worden.
3) Eiedel in den Märk. Forsch. I, S. 185 giebt eine Beschreibung von 1680.
Sello S. 209 ff.
7