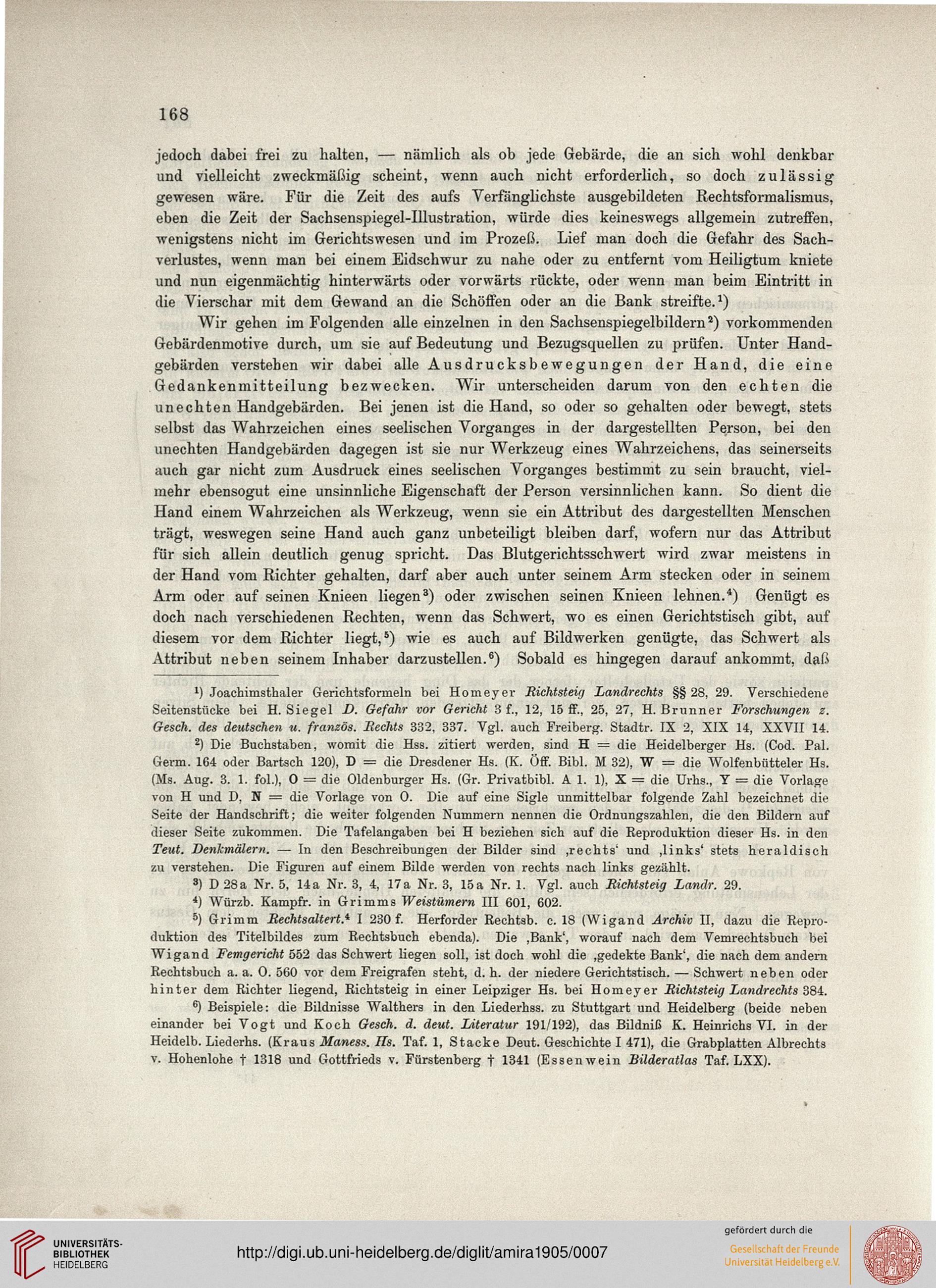168
jedoch dabei frei zu halten, — nämlich als ob jede Gebärde, die an sich wohl denkbar
und vielleicht zweckmäßig seheint, wenn auch nicht erforderlich, so doch zulässig
gewesen wäre. Für die Zeit des aufs Verfänglichste ausgebildeten Rechtsformalismus,
eben die Zeit der Sachsenspiegel-Illustration, würde dies keineswegs allgemein zutreffen,
wenigstens nicht im Gerichtswesen und im Prozeß. Lief man doch die Gefahr des Sach-
verlustes, wenn man bei einem Eidsehwur zu nahe oder zu entfernt vom Heiligtum kniete
und nun eigenmächtig hinterwärts oder vorwärts rückte, oder wenn man beim Eintritt in
die Vierschar mit dem Gewand an die Schöffen oder an die Bank streifte.1)
Wir gehen im Folgenden alle einzelnen in den Sachsenspiegelbilderns) vorkommenden
Gebärdenmotive durch, um sie auf Bedeutung und Bezugsquellen zu prüfen. Unter Hand-
gebärden verstehen wir dabei alle Ausdrucksbewegungen der Hand, die eine
Gedankenmitteilung bezwecken. Wir unterscheiden darum von den echten die
unechten Handgebärden. Bei jenen ist die Hand, so oder so gehalten oder bewegt, stets
selbst das Wahrzeichen eines seelischen Vorganges in der dargestellten Person, bei den
unechten Handgebärden dagegen ist sie nur Werkzeug eines Wahrzeichens, das seinerseits
auch gar nicht zum Ausdruck eines seelischen Vorganges bestimmt zu sein braucht, viel-
mehr ebensogut eine unsinnliche Eigenschaft der Person versinnlichen kann. So dient die
Hand einem Wahrzeichen als Werkzeug, wenn sie ein Attribut des dargestellten Menschen
trägt, weswegen seine Hand auch ganz unbeteiligt bleiben darf, wofern nur das Attribut
für sich allein deutlich genug spricht. Das Blutgerichtsschwert wird zwar meistens in
der Hand vom Richter gehalten, darf aber auch unter seinem Arm stecken oder in seinem
Arm oder auf seinen Knieen liegen3) oder zwischen seinen Knieen lehnen.4) Genügt es
doch nach verschiedenen Rechten, wenn das Schwert, wo es einen Gerichtstisch gibt, auf
diesem vor dem Richter liegt,5) wie es auch auf Bildwerken genügte, das Schwert als
Attribut neben seinem Inhaber darzustellen.8) Sobald es hingegen darauf ankommt, daß
1) Joachimsthaler Gerichtsformeln bei Homeyer Richtsteig Landrechts §§ 28, 29. Verschiedene
Seitenstücke bei H. Siegel D. Gefahr vor Gericht 3 f., 12, 15 ff., 25, 27, H. Brunner Forschungen z.
Gesch. des deutschen u. französ. Rechts 332, 337. Vgl. auch Freiberg. Stadtr. IX 2, XIX 14, XXVII 14.
2) Die Buchstaben, womit die Hss. zitiert werden, sind H = die Heidelberger Hs. (Cod. Pal.
Germ. 164 oder Bartseh 120), D = die Dresdener Hs. (K. Off. Bibl. M 32), W — die Wolfenbütteler Ha.
(Ms. Äug. 3. 1. fol.), O = die Oldenburger Hs. {Gr. Privatbibl. A 1. 1), X = die Urhs., T = die Vorlage
von H und D, N = die Vorlage von 0. Die auf eine Sigle unmittelbar folgende Zahl bezeichnet die
Seite der Handschrift; die weiter folgenden Nummern nennen die Ordnungszahlen, die den Bildern auf
dieser Seite zukommen. Die Tafelangaben bei H beziehen sich auf die Reproduktion dieser Hs. in den
Teut. Denkmälern. — In den Beschreibungen der Bilder sind .rechts' und ,links' stets heraldisch
zu verstehen. Die Figuren auf einem Bilde werden von rechts nach links gezählt.
3) D 28a Nr. 5, 14a Nr. 3, 4, 17a Nr. 3, 15a Nr. 1. Vgl. auch Richtsteig Lanür. 29.
*) Würzb. Kampfr. in Grimms Weistümern III 601, 602.
5) Grimm Rechtsaltert.* I 230 f. Herforder Rechtsb. c. IS (Wigand Archiv II, dazu die Repro-
duktion des Titelbildes zum Rechtsbueh ebenda). Die ,Bank', worauf nach dem Vemrechtsbueh bei
Wigand Femgericht 552 das Schwert liegen soll, ist doch wohl die ,gedekte Bank', die nach dem andern
Rechtsbuch a. a. 0. 560 vor dem Freigrafen steht, d. h. der niedere Gerichtstisch. — Sehwert neben oder
hinter dem Richter liegend, Richtsteig in einer Leipziger Hs. bei Homeyer Richtsteig Landrechts 384.
^ Beispiele: die Bildnisse Walthers in den Liederhss. zu Stuttgart und Heidelberg {beide neben
einander bei Vogt und Koch Gesch. d. deut. Literatur 191/192), das Bildniß K. Heinrichs VI. in der
Heidelb. Liederhs. (Kraus Maness. ITs. Taf. 1, Stacke Deut. Geschichte I 471), die Grabplatten Albrechts
v. Hohenlohe t 1318 und Gottfrieds v. Fürstenberg t 1341 (Essenwein Bilderatlas Taf. LXX).
jedoch dabei frei zu halten, — nämlich als ob jede Gebärde, die an sich wohl denkbar
und vielleicht zweckmäßig seheint, wenn auch nicht erforderlich, so doch zulässig
gewesen wäre. Für die Zeit des aufs Verfänglichste ausgebildeten Rechtsformalismus,
eben die Zeit der Sachsenspiegel-Illustration, würde dies keineswegs allgemein zutreffen,
wenigstens nicht im Gerichtswesen und im Prozeß. Lief man doch die Gefahr des Sach-
verlustes, wenn man bei einem Eidsehwur zu nahe oder zu entfernt vom Heiligtum kniete
und nun eigenmächtig hinterwärts oder vorwärts rückte, oder wenn man beim Eintritt in
die Vierschar mit dem Gewand an die Schöffen oder an die Bank streifte.1)
Wir gehen im Folgenden alle einzelnen in den Sachsenspiegelbilderns) vorkommenden
Gebärdenmotive durch, um sie auf Bedeutung und Bezugsquellen zu prüfen. Unter Hand-
gebärden verstehen wir dabei alle Ausdrucksbewegungen der Hand, die eine
Gedankenmitteilung bezwecken. Wir unterscheiden darum von den echten die
unechten Handgebärden. Bei jenen ist die Hand, so oder so gehalten oder bewegt, stets
selbst das Wahrzeichen eines seelischen Vorganges in der dargestellten Person, bei den
unechten Handgebärden dagegen ist sie nur Werkzeug eines Wahrzeichens, das seinerseits
auch gar nicht zum Ausdruck eines seelischen Vorganges bestimmt zu sein braucht, viel-
mehr ebensogut eine unsinnliche Eigenschaft der Person versinnlichen kann. So dient die
Hand einem Wahrzeichen als Werkzeug, wenn sie ein Attribut des dargestellten Menschen
trägt, weswegen seine Hand auch ganz unbeteiligt bleiben darf, wofern nur das Attribut
für sich allein deutlich genug spricht. Das Blutgerichtsschwert wird zwar meistens in
der Hand vom Richter gehalten, darf aber auch unter seinem Arm stecken oder in seinem
Arm oder auf seinen Knieen liegen3) oder zwischen seinen Knieen lehnen.4) Genügt es
doch nach verschiedenen Rechten, wenn das Schwert, wo es einen Gerichtstisch gibt, auf
diesem vor dem Richter liegt,5) wie es auch auf Bildwerken genügte, das Schwert als
Attribut neben seinem Inhaber darzustellen.8) Sobald es hingegen darauf ankommt, daß
1) Joachimsthaler Gerichtsformeln bei Homeyer Richtsteig Landrechts §§ 28, 29. Verschiedene
Seitenstücke bei H. Siegel D. Gefahr vor Gericht 3 f., 12, 15 ff., 25, 27, H. Brunner Forschungen z.
Gesch. des deutschen u. französ. Rechts 332, 337. Vgl. auch Freiberg. Stadtr. IX 2, XIX 14, XXVII 14.
2) Die Buchstaben, womit die Hss. zitiert werden, sind H = die Heidelberger Hs. (Cod. Pal.
Germ. 164 oder Bartseh 120), D = die Dresdener Hs. (K. Off. Bibl. M 32), W — die Wolfenbütteler Ha.
(Ms. Äug. 3. 1. fol.), O = die Oldenburger Hs. {Gr. Privatbibl. A 1. 1), X = die Urhs., T = die Vorlage
von H und D, N = die Vorlage von 0. Die auf eine Sigle unmittelbar folgende Zahl bezeichnet die
Seite der Handschrift; die weiter folgenden Nummern nennen die Ordnungszahlen, die den Bildern auf
dieser Seite zukommen. Die Tafelangaben bei H beziehen sich auf die Reproduktion dieser Hs. in den
Teut. Denkmälern. — In den Beschreibungen der Bilder sind .rechts' und ,links' stets heraldisch
zu verstehen. Die Figuren auf einem Bilde werden von rechts nach links gezählt.
3) D 28a Nr. 5, 14a Nr. 3, 4, 17a Nr. 3, 15a Nr. 1. Vgl. auch Richtsteig Lanür. 29.
*) Würzb. Kampfr. in Grimms Weistümern III 601, 602.
5) Grimm Rechtsaltert.* I 230 f. Herforder Rechtsb. c. IS (Wigand Archiv II, dazu die Repro-
duktion des Titelbildes zum Rechtsbueh ebenda). Die ,Bank', worauf nach dem Vemrechtsbueh bei
Wigand Femgericht 552 das Schwert liegen soll, ist doch wohl die ,gedekte Bank', die nach dem andern
Rechtsbuch a. a. 0. 560 vor dem Freigrafen steht, d. h. der niedere Gerichtstisch. — Sehwert neben oder
hinter dem Richter liegend, Richtsteig in einer Leipziger Hs. bei Homeyer Richtsteig Landrechts 384.
^ Beispiele: die Bildnisse Walthers in den Liederhss. zu Stuttgart und Heidelberg {beide neben
einander bei Vogt und Koch Gesch. d. deut. Literatur 191/192), das Bildniß K. Heinrichs VI. in der
Heidelb. Liederhs. (Kraus Maness. ITs. Taf. 1, Stacke Deut. Geschichte I 471), die Grabplatten Albrechts
v. Hohenlohe t 1318 und Gottfrieds v. Fürstenberg t 1341 (Essenwein Bilderatlas Taf. LXX).