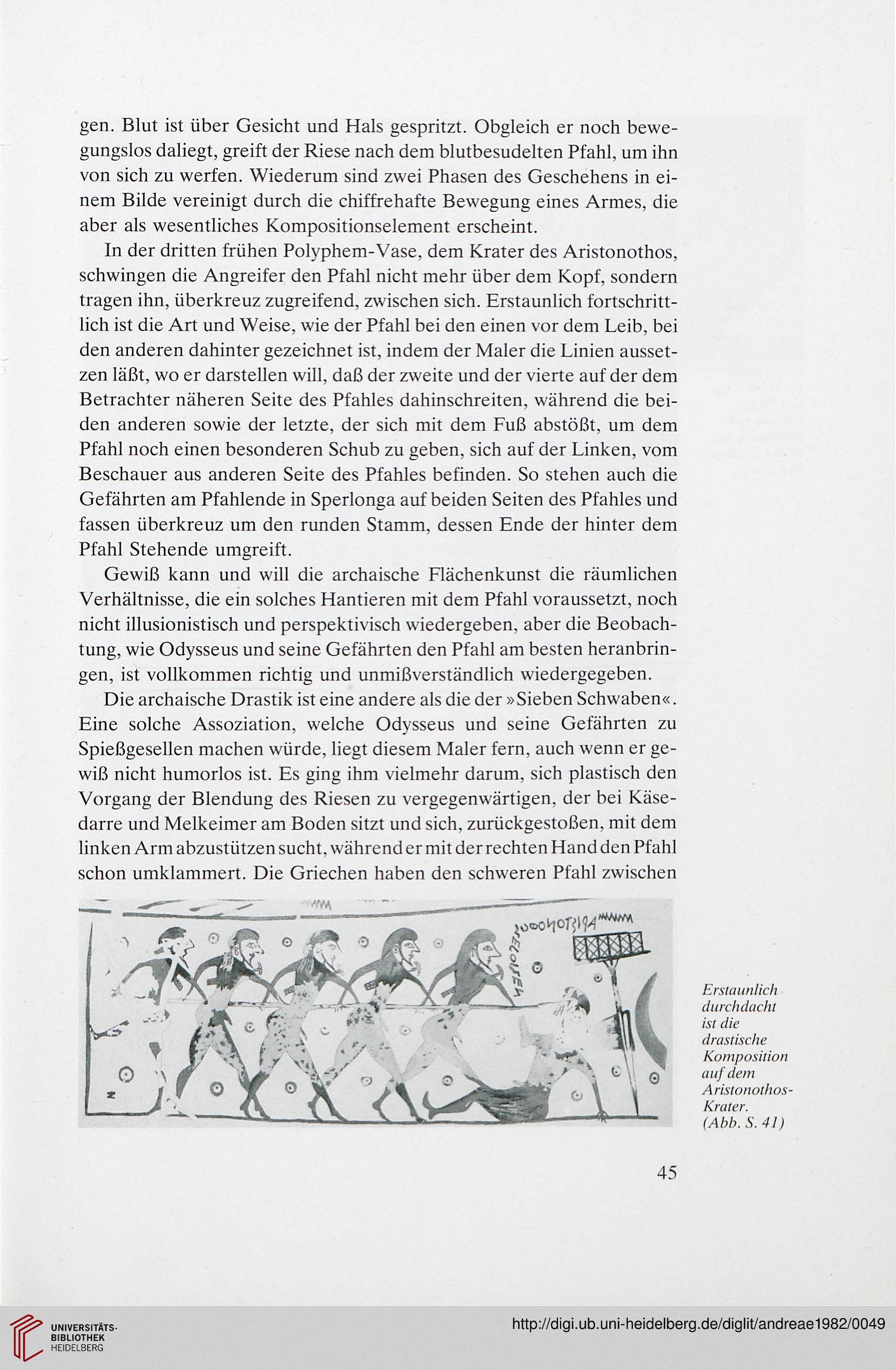gen. Blut ist über Gesicht und Hals gespritzt. Obgleich er noch bewe-
gungslos daliegt, greift der Riese nach dem blutbesudelten Pfahl, um ihn
von sich zu werfen. Wiederum sind zwei Phasen des Geschehens in ei-
nem Bilde vereinigt durch die chiffrehafte Bewegung eines Armes, die
aber als wesentliches Kompositionselement erscheint.
In der dritten frühen Polyphem-Vase, dem Krater des Aristonothos,
schwingen die Angreifer den Pfahl nicht mehr über dem Kopf, sondern
tragen ihn, überkreuz zugreifend, zwischen sich. Erstaunlich fortschritt-
lich ist die Art und Weise, wie der Pfahl bei den einen vor dem Leib, bei
den anderen dahinter gezeichnet ist, indem der Maler die Linien ausset-
zen läßt, wo er darstellen will, daß der zweite und der vierte auf der dem
Betrachter näheren Seite des Pfahles dahinschreiten, während die bei-
den anderen sowie der letzte, der sich mit dem Fuß abstößt, um dem
Pfahl noch einen besonderen Schub zu geben, sich auf der Linken, vom
Beschauer aus anderen Seite des Pfahles befinden. So stehen auch die
Gefährten am Pfahlende in Sperlonga auf beiden Seiten des Pfahles und
fassen überkreuz um den runden Stamm, dessen Ende der hinter dem
Pfahl Stehende umgreift.
Gewiß kann und will die archaische Flächenkunst die räumlichen
Verhältnisse, die ein solches Hantieren mit dem Pfahl voraussetzt, noch
nicht illusionistisch und perspektivisch wiedergeben, aber die Beobach-
tung, wie Odysseus und seine Gefährten den Pfahl am besten heranbrin-
gen, ist vollkommen richtig und unmißverständlich wiedergegeben.
Die archaische Drastik ist eine andere als die der »Sieben Schwaben«.
Eine solche Assoziation, welche Odysseus und seine Gefährten zu
Spießgesellen machen würde, liegt diesem Maler fern, auch wenn er ge-
wiß nicht humorlos ist. Es ging ihm vielmehr darum, sich plastisch den
Vorgang der Blendung des Riesen zu vergegenwärtigen, der bei Käse-
darre und Melkeimer am Boden sitzt und sich, zurückgestoßen, mit dem
linken Arm abzustützen sucht, während er mit der rechten Hand den Pfahl
schon umklammert. Die Griechen haben den schweren Pfahl zwischen
Erstaunlich
durchdacht
ist die
drastische
Komposition
auf dem
Aristonothos-
Krater.
(Abb. S.41)
45
gungslos daliegt, greift der Riese nach dem blutbesudelten Pfahl, um ihn
von sich zu werfen. Wiederum sind zwei Phasen des Geschehens in ei-
nem Bilde vereinigt durch die chiffrehafte Bewegung eines Armes, die
aber als wesentliches Kompositionselement erscheint.
In der dritten frühen Polyphem-Vase, dem Krater des Aristonothos,
schwingen die Angreifer den Pfahl nicht mehr über dem Kopf, sondern
tragen ihn, überkreuz zugreifend, zwischen sich. Erstaunlich fortschritt-
lich ist die Art und Weise, wie der Pfahl bei den einen vor dem Leib, bei
den anderen dahinter gezeichnet ist, indem der Maler die Linien ausset-
zen läßt, wo er darstellen will, daß der zweite und der vierte auf der dem
Betrachter näheren Seite des Pfahles dahinschreiten, während die bei-
den anderen sowie der letzte, der sich mit dem Fuß abstößt, um dem
Pfahl noch einen besonderen Schub zu geben, sich auf der Linken, vom
Beschauer aus anderen Seite des Pfahles befinden. So stehen auch die
Gefährten am Pfahlende in Sperlonga auf beiden Seiten des Pfahles und
fassen überkreuz um den runden Stamm, dessen Ende der hinter dem
Pfahl Stehende umgreift.
Gewiß kann und will die archaische Flächenkunst die räumlichen
Verhältnisse, die ein solches Hantieren mit dem Pfahl voraussetzt, noch
nicht illusionistisch und perspektivisch wiedergeben, aber die Beobach-
tung, wie Odysseus und seine Gefährten den Pfahl am besten heranbrin-
gen, ist vollkommen richtig und unmißverständlich wiedergegeben.
Die archaische Drastik ist eine andere als die der »Sieben Schwaben«.
Eine solche Assoziation, welche Odysseus und seine Gefährten zu
Spießgesellen machen würde, liegt diesem Maler fern, auch wenn er ge-
wiß nicht humorlos ist. Es ging ihm vielmehr darum, sich plastisch den
Vorgang der Blendung des Riesen zu vergegenwärtigen, der bei Käse-
darre und Melkeimer am Boden sitzt und sich, zurückgestoßen, mit dem
linken Arm abzustützen sucht, während er mit der rechten Hand den Pfahl
schon umklammert. Die Griechen haben den schweren Pfahl zwischen
Erstaunlich
durchdacht
ist die
drastische
Komposition
auf dem
Aristonothos-
Krater.
(Abb. S.41)
45