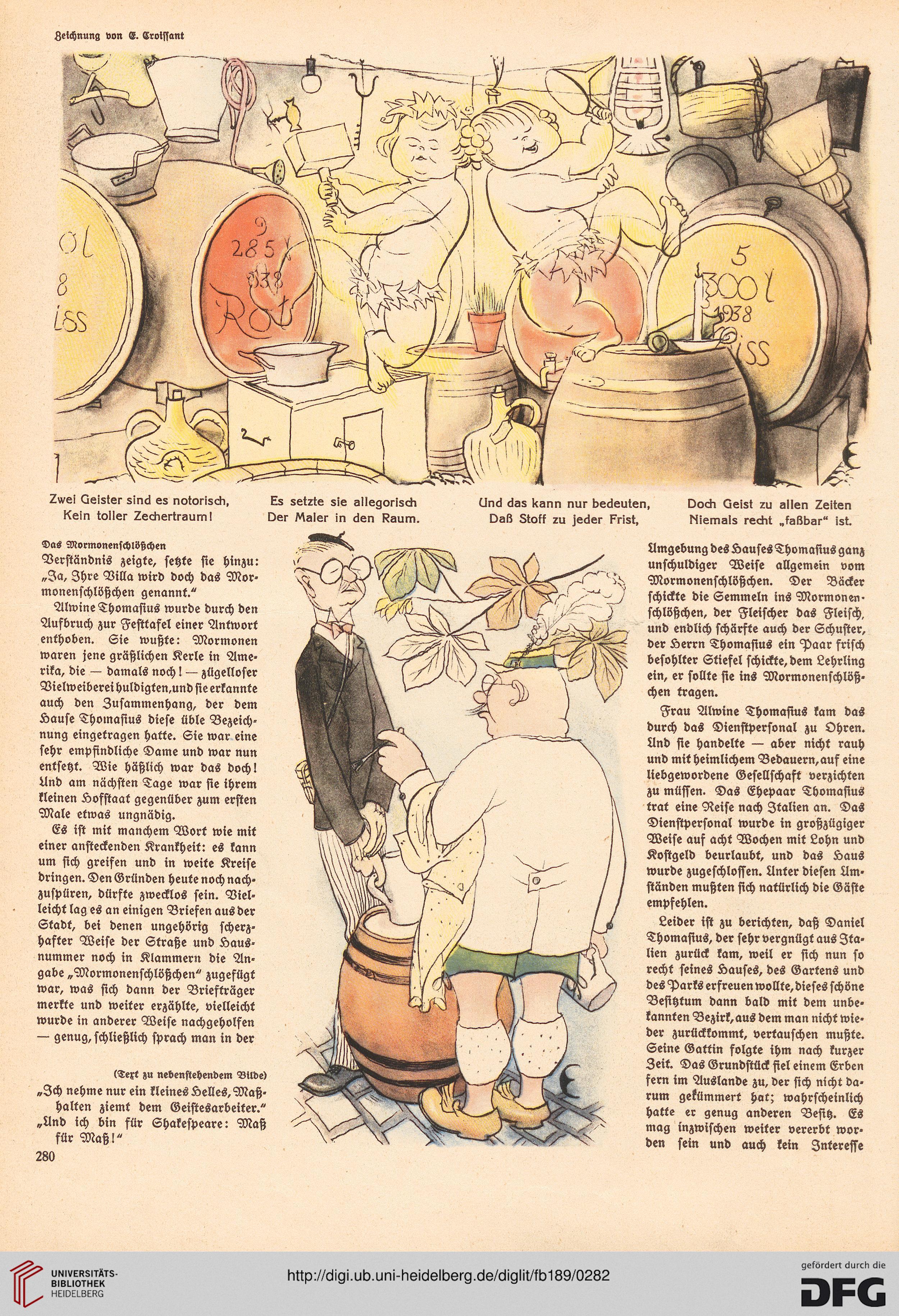Zeichnung von Q. Croissant
Zwei Geister sind es notorisch,
Kein toller Zechertraum!
Es setzte sie allegorisch
Der Maler in den Raum.
Und das kann nur bedeuten,
Daß Stoff zu jeder Frist,
Doch Geist zu allen Zeiten
Niemals recht „faßbar“ ist.
Das Mormonenschlößchen
Verständnis zeigte, setzte sie hinzu:
„Ja, Ihre Villa wird doch das Mor-
monenschlößchen genannt.“
Alwine Thomasius wurde durch den
Aufbruch zur Festtafel einer Antwort
enthoben. Sie wußte: Mormonen
waren jene gräßlichen Kerle in Ame-
rika, die — damals noch! — zügelloser
Vielweiberei huldigten.und sie erkannte
auch den Zusammenhang, der dem
Lause Thomasius diese üble Bezeich-
nung eingetragen hatte. Sie war eine
sehr empfindliche Dame und war nun
entsetzt. Wie häßlich war das doch!
Und am nächsten Tage war sie ihrem
kleinen Lofstaat gegenüber zum ersten
Male etwas ungnädig.
Es ist mit manchem Wort wie mit
einer ansteckenden Krankheit: es kann
um sich greisen und in weite Kreise
dringen. Den Gründen heute noch nach-
zuspüren, dürste zwecklos sein. Viel-
leicht lag es an einigen Briefen aus der
Stadt, bei denen ungehörig scherz-
hafter Weise der Straße und Laus-
nummer noch in Klammern die An-
gabe „Mormonenschlößchen“ zugefügt
war, was sich dann der Briefträger
merkte und weiter erzählte, vielleicht
wurde in anderer Weise nachgeholfen
— genug, schließlich sprach man in der
(Text zu nebenstehendem Bilde)
„Ich nehme nur ein kleines Lelles,Maß-
Halten ziemt dem Geistesarbeiter."
„And ich bin für Shakespeare: Maß
für Maß!“
Umgebung des Laufes Thomasius ganz
unschuldiger Weise allgemein vom
Mormonenschlößchen. Der Bäcker
schickte die Semmeln ins Mormonen -
schlößchen, der Fleischer das Fleisch,
und endlich schärfte auch der Schuster,
der Lerrn Thomasius ein Paar frisch
besohlter Stiefel schickte, dem Lehrling
ein, er sollte sie ins Mormonenschlöß-
chen tragen.
Frau Alwine Thomasius kam das
durch das Dienstpersonal zu Ohren.
And sie handelte — aber nicht rauh
und mit heimlichem Bedauern, auf eine
liebgewordene Gesellschaft verzichten
zu müssen. Das Ehepaar Thomasius
trat eine Reise nach Italien an. Das
Dienstpersonal wurde in großzügiger
Weise auf acht Wochen mit Lohn und
Kostgeld beurlaubt, und das Laus
wurde zugeschlossen. Unter diesen Um-
ständen mußten sich natürlich die Gäste
empfehlen.
Leider ist zu berichten, daß Daniel
Thomasius, der sehr vergnügt aus Ita-
lien zurück kam, weil er sich nun so
recht seines Laufes, des Gartens und
des Parks erfreuen wollte, dieses schöne
Besitztum dann bald mit dem unbe-
kannten Bezirk, aus dem man nicht wie-
der zurückkommt, vertauschen mußte.
Seine Gattin folgte ihm nach kurzer
Zeit. Das Grundstück fiel einem Erben
fern im Auslande zu, der sich nicht da-
rum gekümmert hat; wahrscheinlich
hatte er genug anderen Besitz. Es
mag inzwischen weiter vererbt wor-
den sein und auch kein Interesse
280
Zwei Geister sind es notorisch,
Kein toller Zechertraum!
Es setzte sie allegorisch
Der Maler in den Raum.
Und das kann nur bedeuten,
Daß Stoff zu jeder Frist,
Doch Geist zu allen Zeiten
Niemals recht „faßbar“ ist.
Das Mormonenschlößchen
Verständnis zeigte, setzte sie hinzu:
„Ja, Ihre Villa wird doch das Mor-
monenschlößchen genannt.“
Alwine Thomasius wurde durch den
Aufbruch zur Festtafel einer Antwort
enthoben. Sie wußte: Mormonen
waren jene gräßlichen Kerle in Ame-
rika, die — damals noch! — zügelloser
Vielweiberei huldigten.und sie erkannte
auch den Zusammenhang, der dem
Lause Thomasius diese üble Bezeich-
nung eingetragen hatte. Sie war eine
sehr empfindliche Dame und war nun
entsetzt. Wie häßlich war das doch!
Und am nächsten Tage war sie ihrem
kleinen Lofstaat gegenüber zum ersten
Male etwas ungnädig.
Es ist mit manchem Wort wie mit
einer ansteckenden Krankheit: es kann
um sich greisen und in weite Kreise
dringen. Den Gründen heute noch nach-
zuspüren, dürste zwecklos sein. Viel-
leicht lag es an einigen Briefen aus der
Stadt, bei denen ungehörig scherz-
hafter Weise der Straße und Laus-
nummer noch in Klammern die An-
gabe „Mormonenschlößchen“ zugefügt
war, was sich dann der Briefträger
merkte und weiter erzählte, vielleicht
wurde in anderer Weise nachgeholfen
— genug, schließlich sprach man in der
(Text zu nebenstehendem Bilde)
„Ich nehme nur ein kleines Lelles,Maß-
Halten ziemt dem Geistesarbeiter."
„And ich bin für Shakespeare: Maß
für Maß!“
Umgebung des Laufes Thomasius ganz
unschuldiger Weise allgemein vom
Mormonenschlößchen. Der Bäcker
schickte die Semmeln ins Mormonen -
schlößchen, der Fleischer das Fleisch,
und endlich schärfte auch der Schuster,
der Lerrn Thomasius ein Paar frisch
besohlter Stiefel schickte, dem Lehrling
ein, er sollte sie ins Mormonenschlöß-
chen tragen.
Frau Alwine Thomasius kam das
durch das Dienstpersonal zu Ohren.
And sie handelte — aber nicht rauh
und mit heimlichem Bedauern, auf eine
liebgewordene Gesellschaft verzichten
zu müssen. Das Ehepaar Thomasius
trat eine Reise nach Italien an. Das
Dienstpersonal wurde in großzügiger
Weise auf acht Wochen mit Lohn und
Kostgeld beurlaubt, und das Laus
wurde zugeschlossen. Unter diesen Um-
ständen mußten sich natürlich die Gäste
empfehlen.
Leider ist zu berichten, daß Daniel
Thomasius, der sehr vergnügt aus Ita-
lien zurück kam, weil er sich nun so
recht seines Laufes, des Gartens und
des Parks erfreuen wollte, dieses schöne
Besitztum dann bald mit dem unbe-
kannten Bezirk, aus dem man nicht wie-
der zurückkommt, vertauschen mußte.
Seine Gattin folgte ihm nach kurzer
Zeit. Das Grundstück fiel einem Erben
fern im Auslande zu, der sich nicht da-
rum gekümmert hat; wahrscheinlich
hatte er genug anderen Besitz. Es
mag inzwischen weiter vererbt wor-
den sein und auch kein Interesse
280
Werk/Gegenstand/Objekt
Pool: UB Fliegende Blätter
Titel
Titel/Objekt
"Zwei Geister sind es notorisch, ..." "Ich nehme nur ein kleines Helles, Maßhalten ziemt dem Geistesarbeiter."
Weitere Titel/Paralleltitel
Serientitel
Fliegende Blätter
Sachbegriff/Objekttyp
Inschrift/Wasserzeichen
Aufbewahrung/Standort
Aufbewahrungsort/Standort (GND)
Inv. Nr./Signatur
G 5442-2 Folio RES
Objektbeschreibung
Maß-/Formatangaben
Auflage/Druckzustand
Werktitel/Werkverzeichnis
Herstellung/Entstehung
Künstler/Urheber/Hersteller (GND)
Entstehungsdatum
um 1938
Entstehungsdatum (normiert)
1933 - 1943
Entstehungsort (GND)
Auftrag
Publikation
Fund/Ausgrabung
Provenienz
Restaurierung
Sammlung Eingang
Ausstellung
Bearbeitung/Umgestaltung
Thema/Bildinhalt
Thema/Bildinhalt (GND)
Literaturangabe
Rechte am Objekt
Aufnahmen/Reproduktionen
Künstler/Urheber (GND)
Reproduktionstyp
Digitales Bild
Rechtsstatus
In Copyright (InC) / Urheberrechtsschutz
Creditline
Fliegende Blätter, 189.1938, Nr. 4866, S. 280
Beziehungen
Erschließung
Lizenz
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Rechteinhaber
Universitätsbibliothek Heidelberg