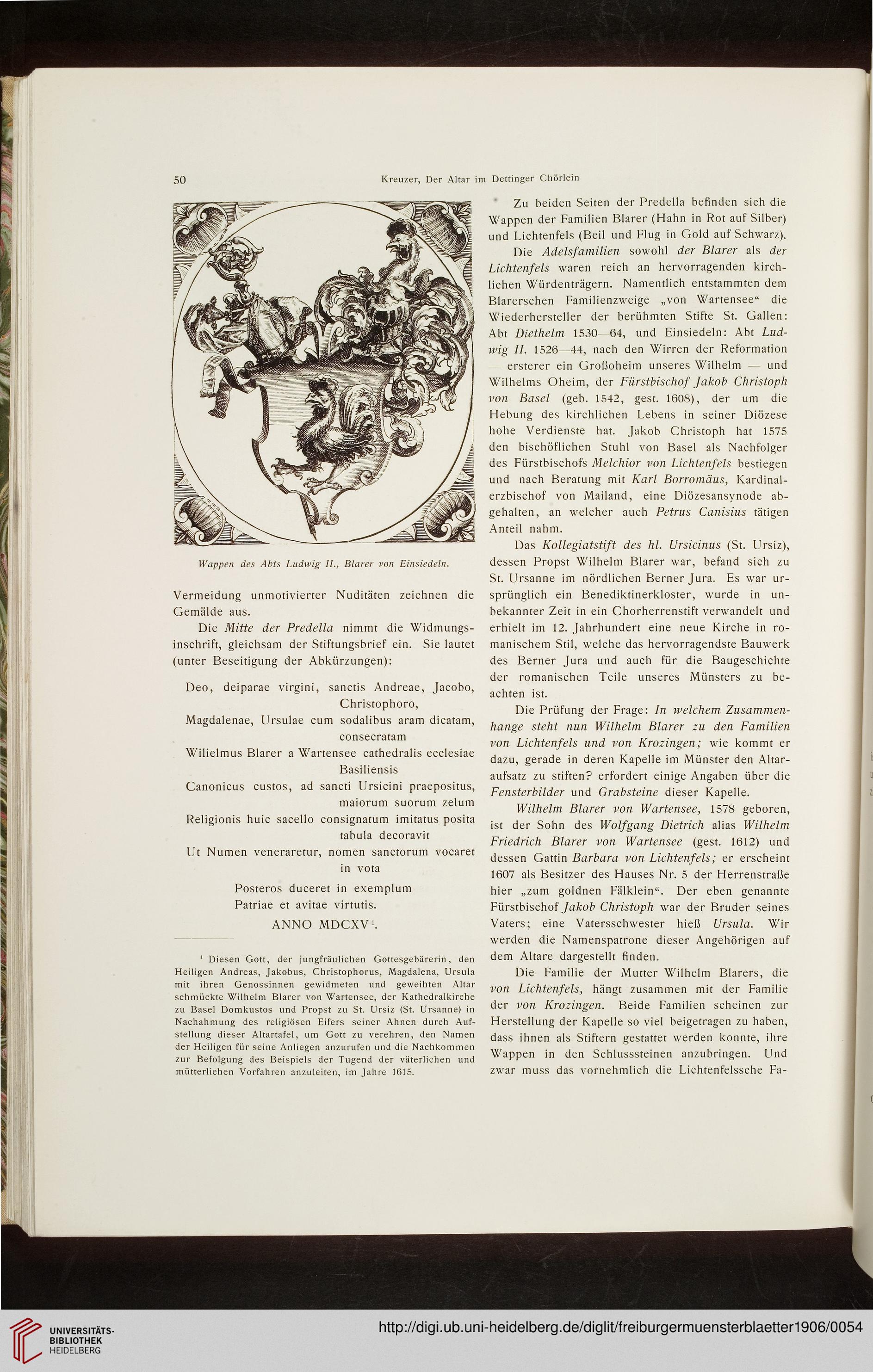Münsterbau-Verein <Freiburg, Breisgau> [Hrsg.]
Freiburger Münsterblätter: Halbjahrsschrift für die Geschichte und Kunst des Freiburger Münsters
— 2.1906
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.2397#0054
DOI Artikel:
Kreuzer, Emil: Der Altar im Dettinger Chörlein
DOI Seite / Zitierlink: https://doi.org/10.11588/diglit.2397#0054
Titelblätter
Inhaltsverzeichnis
Der romanische Bildfries am südlichen Choreingang des Freiburger Münsters
1
bald zu den besten von ihnen in ein wahrhaft per-
…
bald genug zu einem herzlich geliebten, innig ver-
…
logen erklärtes Amt, öffentlich von diesen Dingen zu
2
Rechts wegen zu beschäftigen habe. Darin mag denn Französische Archäologen2 haben zuerst richtig
…
umgang führt, ehemals aber den Eingang zu einer ordentlich, das ging so weit über alles Gewöhnliche
…
Manneshöhe zu beiden Seiten des Portals. In fester dungskraft sich in lieblichen oder schreckhaften
…
genug, und fast kein Lehrbuch der Kunstgeschichte nistischen Zeit selbst zu ihrem literarischen Abschluss
…
der erste Blick, dass sie zu einer Reihe einzelner listhenes als Verfasser genannt, der Philosoph aus
…
mit der Darstellung an dem Kapitale rechts, die nes zu bezeichnen pflegt. Hier zeigen sich nun ge-
5
langen packt, zu wissen, wie es unter und über ihr
…
Ems ward der Stoff zu Ende des 13. Jahrhunderts
6
Alexander, seine Speere zu senken. Da stoßen die
…
zu erzählen, und die Araber berichten die gleiche
…
men. Da dachte Nimrod, sich an Gott zu rächen.
…
rückkehren. Da glaubt er Gott vernichtet zu haben
…
Geister, bezwungen. Ihn zu verderben, lassen diese
…
Zur Schlafenszeit zu dem Adlerhorst,
7
Um dort zu streiten mit Pfeil und Bogen.
…
sehr genau zu dem, was wir schon von Nimrod und
…
7. 8. Elfenbeintafeln im Museum zu Darmstadt.
…
Geschichte zu melden.
…
der monumentalen Überlieferung zu beobachten. Wie
8
stimmt so genau zu unserem Frei-
…
der Venediger gearbeitet zu sein;
…
11. Kapital aus dem Chorumgang des Münsters zu Basel.
9
des Münsters zu Basel (Fig. 11) stimmt noch sehr
…
sonst keine Darstellung der Greifenfahrt zu begegnen,
…
Alexanders angeführt werden, haben damit nichts zu
…
oben zu erwäh-
11
altes Leinwandgewebe zu ge-
…
ohne Beziehung zu den kop-
…
antiken Typus zu Nutze ge-
…
lichsten zu predigen: dieser
…
vorher die Welt zu klein ge-
…
Geschichte denn auch zu all-
…
Vorliebe wählte, um dem Gläubigen zu zeigen, dass
12
Basler Kapital zu derselben Szene den Sündenfall
…
zu der rechten Längsseite unseres Frieses wenden,
14
dem David zu erkennen haben. nur der Bär unter-
…
der Absicht einer Darstellung Davids nicht zu zwei-
…
wohl zu Samson, nicht aber zu David passe. Diesen
…
findet sich an einem Reliquiar im Schatze zu Conques folger der Kir-
15
25. Von einem Reliquiar im Schatze zu Conches.
…
hält, darin zu schreiben oder vielleicht lesend zu
…
schließen, um ein Gegengewicht für ihre Sünden zu
…
Der Lehrer weist ihn ab: das sei für jetzt noch zu
16
schwer und vorher gelte es anderes zu lernen. „Sprich
…
niemand etwas zu lernen.
…
und kehrt in den heimischen Wald zurück zu den
…
nau zu entsprechen. Ein Unterschied zeigt sich nur
17
Hüben Schach zu spielen an;
…
27. Tympanon vom Dome zu Lund.
…
Kirche zu Marienhafe in Ostfriesland72 hervorgebracht,
18
nun gerade zu der oben S. 15 f. zitierten Stelle, die
…
auch in Bildern mit ihm zu umgeben; ein französi-
19
soeben den schön gespängten Schild zerspalten. zu zweifeln ist. Und dass man solchen Duellen
…
der Tierkreiszeichen zu
…
eine Parallele zu der
20
um Mord und Böses zu tun, müsse der Christ mit
…
spiel aus Basel zu geben (Fig. 35). Die besondere
21
33. Fries aus der Krypta des Münsters zu Basel.
…
et exsurge in adjutorium mihi! (Psalm 34 a) zu seiner
…
Meerfrau zu fassen scheint.
…
Kaie, zu trinken. Der König missgönnt den beiden,
…
34. Aus dem Kreuzgang an der Stiftskirche zu Neuberg
22
zu erblicken.
…
schen Text Veranlassung gegeben, sich mit ihnen zu
…
geistlich zu deuten. Nach ihm bedeutet das Meer
…
einem Kapital des Kreuzgangs der Stiftskirche zu
23
Sünde zu deuten liebt;
…
tungslos zu verderben.
…
melt101. Es ist dabei spasshaft zu sehen, wie die
…
schwänzen gebildet; nicht zu sel-
25
auffassen wollen114. Wenn nun auch nicht zu leugnen
…
zu einer Komposition wie die vorliegende kaum
…
ich mir die Sache denke, da dies eine zu weite Ab-
…
dunklen Abschnitt einiges Licht zu werfen.
26
zu verbreitete Motive, als dass sich hier bei dem
…
Beziehungen zu den entsprechenden Darstellungen
…
Die Beziehungen unseres Freiburger Portals zu
27
zwischen den beiden Portalen zu vollenden, werfen
…
46. Südportal der Stiftskirche zu S. Ursanne.
28
Doubs, es gehörte zur Diözese Basel. Zu der
…
seinen Auspizien ausgeführten, zu seiner Grabes-
…
regungen weiter zu verfolgen.
…
heiliger Stätte zu dulden bereit war. Einer solchen
…
manischer Symbolik mit Vorsicht zu verfahren ist
…
wie das zu oft geschieht, in einer größeren Reihe
…
zu Fall sich treffen lassen, aber sie kann gewiss nie
…
Skulpturen zu Grunde liegt, ist derselbe, der an un-
29
gesprochene näher zu begründen bestimmt sind, teils solchen
…
1 Zu nennen wären J. Marmon, Unserer lieben Frauen
…
Bauperiode des Münsters zu Freiburg i. B., 1894, S. 21 f., und
…
Zu dichtende die mere.
…
loch, Oberbad. Geschlechterbuch 2, 37. Dass die in einer Hs. zu
…
Himmel ruft ihm „eine Stimme" zu: „Wohin willst du Gott-
…
ohne diesen anders als durch Hörensagen zu kennen. Das Ge-
30
Alexanders Meerfahrt, dem Zug zu den Säulen des Herkules und
…
steht die Geschichte nach Strauch zu Enikel 19441.
…
dies die übliche Art zu reisen (Str. 4757 f. der Ausgabe von Hahn).
…
nicht zu handeln ist, an diesem Orte ist recht interessant. Denn
…
rechts und links oben die Greifen unsinnig genug zu bekränzen
31
sage zu bieten. Nur möchte ich hier die erste Szene links
…
stellung der Angabe sehen, dass Alexander bis zu den Säulen
…
des Mondes und Zug zu den Säulen der Semiramis und des
…
Überlieferung (Ottmann zu Lamprecht V. 6098) heimlich ge-
…
männlichen Figur auch hier Herakles zu erkennen sei, den die
…
der Phantasie des Zeichners entsprungen zu sein, da unsere
…
fahrt sei an der Fassade von Borgo San Donnino zu finden. Ich
…
Kreis der Darstellungen zu Psalm 90, 13: Super aspidem et basi-
…
der Beilage zur Allgem. Zeitung (No. 269, S. 382 f.) zu lesen
32
gen. — Ich kenne zu dieser eigentümlichen Umformung und
…
gelegentlich als Parallele zu dem Descensus ad infernum ver-
33
dass zu lesen sei: magister erroris, der Lehrer des Wolfes also
…
wird, der sich einfallen lässt, einen Wolf unterrichten zu
…
ken zu betätigen. Eine eigentümliche harmlose Deutung, die
…
zu Cremona; abgebildet bei Aus'm Weerth, Der Mosaikboden in
…
'•'- K. Schäfer, Die älteste Bauperiode des Münsters zu
…
Bild, um die ungeheure Kluft zu ermessen, die uns von diesen
Zur Geschichte des Präsenzstatuts vom 4. August 1400
35
nend von Anfang an auf alle Weise zu
…
zu einem seinem Stande nicht geziemenden Lebens-
…
wussten Gegensatz zu dem Statut sich setzte, das da
…
neten Punkten scheint sehr frühe eingesetzt zu haben,
…
billigte Statut allzu Unbilliges geboten zu haben, das
36
treulich zu halten und zu beobachten, dann aber be-
…
Weigerung und Widerrede zu zahlen habe. Davon
…
Kaplan zu den gleichen Abgaben in der gleichen
…
Gegensatz zu dem alten Statut verordnet, dass jeder
…
nig zu büßen, er sei gesund oder krank. Ein kranker
…
Kaplan nehme bis zu seiner Wiedergenesung an den
…
zu geben gehalten.
…
zu weitgehenden Irrungen führten.
…
Ordnung durch ein kilhherren zu derselben zit hie we-
…
haben si zu denselben ziten an die caplän langen lassen
37
hat er inen zu antwort geben: der bischoflich brief, der
…
haben zu beidersid mitsampt dem kilhhern underred ge-
…
das si sich glich partind zu der hochen schul und dem
…
burgermeister, Hans Han, schuldheis zu Fryburg, Brun
…
Und nach etlichen zankworten, die zu allen teilen
38
chen. Das haben die priester dozemal der gmeint zu
…
ist, zu welher zit und wie einer uf den andern soll mess
…
bis zu seinem Tode 1507 Weihbischof von Augsburg; vgl.
…
Item si haben ein Statut, das si zu allen vier hoch-
39
zu verston, us was grund es vlies, dann nit on in diser
…
zu gut nit sie und darum, dwil kilher nicht nuws an-
…
und löblich zu erschiessen uns, gmeiner statt und den
…
solhen jarziten pfarrhof schuldig presenz zu fürdern.
…
ler, zu Wurms und anderswa gesechen hab zweierlei
…
zu ziten bedunkt not sin, und im selbs das und anders
…
Und darum sie gut zu verston gefard der priester,
…
Mit vil andern Worten zu beiden siten geschechen.
40
in irm loblichen furgang ze laussen und mit inen zu ver-
…
beim bischöflichen Hof zu Konstanz, Augustin Tünger,
…
ringem Belang zu wissen, inwieweit sein Zustande-
…
suchung vorbehalten bleiben. Zu ihrer scharf be-
…
Österreich veranlasst worden, im Gegensatz zu dem
…
Bestimmungen, was bekanntlich den Anstoß zu den
Bibliographie des Freiburger Münsters
41
Beschreibung des Münsters zu sam-
…
Münsterbibliographie zu geben, die nicht bloß die
…
einen Versuch in dieser Richtung zu wagen, eines-
…
Auskunftsmittel an die Hand zu geben, andernteils
…
sam zu machen, damit es in einem spätem Nachtrag
…
Adler Friedrich, Das Münster zu Freiburg in Baden
…
mer 1796 als Kriegsbeute weggenommen und zu
…
L. Fr. Münster zu Freiburg i. Br. Freib. 1889.
42
im Münster zu Freiburg in der St. Alexander-
…
Braun Jos., Zwei Tragaltärchen im Münster zu Freiburg
…
der Vorhalle des Münsters zu Freiburg (Christliche
…
und Münsterkirche zu Freiburg i. Br. Freib. 1847.
…
Glasmalerei, Die- im Münster zu Freiburg (Badische
…
Gottesdienstordnung in der Metropolitankirche zu Frei-
…
Günther Karl, Unser Lieben Frauen Münster zu Frei-
…
Maler der - - im Münster zu Freiburg (Christi.
…
Kempf Friedr., Das Münster zu Freiburg i. Br. und seine
43
altare im Münster zu Freiburg (Freiburger Bote
…
Münsters (Rede, gehalten im Kornhaussaale zu
…
Kreuzer Emil, Standbilder am Münsterturm zu Freiburg
…
Leichtlin F. Jul., Inschriften am Münster zu Freiburg
…
zu U. L. Frau in Freiburg i. Br. (Freiburger Kath.
…
Marmon Jos., Unser Lieben Frauen Münster zu Freiburg.
…
Mayer K., Der Flügelaltar zu den hll. Ordensstiftern in
…
— —, Orgeln, zu Freiburg, Schliengen (das. 17, 1865,
…
halle des Münsters zu Freiburg und seine Stellung
…
Münsterkirche zu Freiburg. Freib. 1839.
…
Münsterglocke, Die große - - zu Freiburg. (Oberrhein.
…
Restaurationsarbeiten, Die --am Münster zu Freiburg
…
Redtenbacher Rud., Vorläufige Bemerkungen zu den
44
Schaefer Karl, Die älteste Bauperiode des Münsters zu
…
Malereien im Münster zu Freiburg i. Br.
…
- —, Das Münster zu Freiburg. Mit 13 lithogr. Blättern
…
— —, Geschichte und Beschreibung des Münsters zu
…
Stutz Ulrich, Das Münster zu Freiburg i. Br. im Lichte
…
Münster zu Freiburg (Freiburger Diözesan-
…
Münsterpräsenz zu einem Fenster im neuen Chor
Ein Entwurf zum Umbau des Lettners aus dem Jahre 1704
46
Stufen der Treppe zu stehen gekommen; im Aufriss ist
…
Da der Boden des untern Chores bis zu den obern
…
meinte. Nach der Bluemschen Zeichnung ist nicht zu
…
gezeichnet. Die Vierungspfeiler sind viel zu klein aus-
…
zu Freiburg in den Besitz des Bürgerrechts gelangten
…
60 fl." usw. Was unter diesem Modell des Lettners zu
Die "Hosanna"-Glocke des Freiburger Münsters als älteste Angelus-Glocke
47
der älteste Zeuge desselben zu erkennen gibt, mögen
…
kaner zu Pisa, dass in Zukunft alle Franziskaner „bei
…
vicibus salutarent) zu denken. Es ist hier nicht von der
…
der Glocke zu Ehren der glorreichen Jungfrau" und das
…
komm mit dem Frieden." Eine Glocke zu Nieder-
…
Eine Glocke zu Stötterlingenburg bei Halberstadt trägt
Der Altar im Dettinger Chörlein
49
rativen Wert" zu. Schreiber nennt unser Altarbild
…
dersche Verlagshandlung, 1906) S. 180 ff. zu Grunde.
50
zu Basel Domkustos und Propst zu St. Ursiz (St. Ursanne) in
…
Zu beiden Seiten der Predella befinden sich die
…
dessen Propst Wilhelm Blarer war, befand sich zu
…
der romanischen Teile unseres Münsters zu be-
…
Herstellung der Kapelle so viel beigetragen zu haben,
51
1507 als nächster „Vatermage" des noch zu nennen-
…
Freiburg i. Br. 2 (Freib. 1903), S. 206. — Zu unseren genea-
53
dann 1531 —1539 Schultheiß zu Freiburg und einer
…
1545 in Staufen ansässig, 1546 Vogt zu Landser, 1550
54
Anna entstammte den Ow (Aw) zu Hirrlingen und
…
Dompropst zu Basel und starb 73 Jahre alt 1615, am
…
platte trägt die Umschrift (soweit zu entziffern):
…
ber) zu lesen:
…
propst zu Basel, seines alters 73 Jahr; welchem der
…
zu unterst die Wappen der Bauern (?) und Kammer
55
kind auf dem Schoß, die große Mondsichel zu Füßen,
…
Schwieriger ist sein Gegenüber zu bestimmen. Es
…
bar1. Zu oberst an den Seiten des Hauptbildes be-
…
Zu oberst erscheint Gott Vater, eine überaus
…
Rechte zu einem majestätischen Gestus, jenes neue
56
Buch aufgeschlagen ist, zu abendlichem Gebet und
…
im Sinne der Erzählung des Evangeliums zu schil-
…
Augen zu führen. Matthäus (122 ff.) schreibt: „Alles
…
und Vorbild vorherverkündete Ereignis zu kenn-
59
Welten zu beglücken" (Parad. XXIII) und den hl. Ber-
…
bei Entfaltung der Blätter sich zu Mandeln aus- Osten. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes
…
aus der jungfräulichen Mutter Maria, zu welcher in
…
Blicken wir auf die Mondlandschaft zu unserer
…
(Joh. 4 10) zu der Sama-
60
und er führte mich des Weges zu dem äußeren Tore
…
Zu unterst sehen wir einen Spiegel, jenes Sinnbild
…
Weisheit zu sein, die selbst „Abglanz des ewigen
…
Israels berufen, sprach zu Gott: „Wenn du Israel
…
Aber noch einmal sprach er zu Gott: „Möge dein
…
Vließ wieder zu der Wolke inmitten unseres Ge-
…
(III Kön. 18), hier zu erwähnen, da es von jeher als
…
Blüten trägt, scheint nicht ohne tieferen Sinn zu sein.
…
Es wird wohl nicht zu gewagt sein, wenn wir hier
Die Archivräume in den Hahnentürmen des Münsters
66
eisens in das Guckloch zu verhindern. Die innere
…
hundert. (Im Rathaus befindet sich an der Türe zu
Die Schatzverzeichnisse des Münsters 1483-1748
75
Is Vorarbeit zu der in baldige Aussicht
…
kost 8 ducaten zu vergulden, dem goltschmit 9 gülden
…
4 lot 7ä quinsit und kosten 19 und 72 ducaten zu ver-
…
mark 31/-i lot, kost zu vergulden und zu machen 31
…
hat an silber 5Vä mark 4 löt, kost zu vergulden und
…
culosus und stat zu oberts ein engel.
76
kost 9 duccaten zu vergulden und ward ausgemacht
…
1ja quinsit und der fuß an kupfer 21/a mark, kost zu
…
lot, kost zu machen 15 gülden, ist gemacht worden, do
…
kosten zu machen 16x/ä gülden, sind gemacht worden,
…
vermacht worden zu einer monstranzen anno 1485.
…
quinsit und kost zu vergulden 8 ducaten und zu machen
…
Tucher zu der gezird. Item ein ganz gulde tuch,
…
selben Hand:] ist komen zu leviten rocken; her Nic-
77
czingen zu schilten.
…
ligent zu iren ziten im kor.
…
7 lot silber, kost 1 ducaten und 1 ort zu vergulden,
…
tag als sie zu himel für [15. August] etc. wurd daz
…
ran sin zu einer zierd, hab den paternoster yberantwurt
…
zum fronaltar in unser frauen münster zu Freiburg
…
einzelnen Festen und Sonntagen des Jahres zu ver-
…
poral und 1 gren sidin tiechlin zu der paten, und sol
78
die Riedderin zu einer ziert in bouw uf assumptionis
…
12. jar, und da hat doctor Hainrich Kolher, kircher zu
…
yberantwurt an unser lieben frauen zu henken etc.
…
hat geben ein gewirkt tuch zu einer zier in den chor
…
obend und sol man die bruchen zu sinen jorziten und
79
antwurt dem sigrist zu sant Niclaus uf den 20. tag
…
rist zu sant Niclaus.
…
levitenröcken, hat des priors muter zu den Augustiner
…
widerumb zuhanden gesteh werde und sol sollichs zu
…
Testament dem Münsterbau zu Händen der drei
…
donerstag zu dem mandat und dis sol man weder ver-
80
daran ein schön weiß bissamknöpflin, hat gewonet zu
…
Junker Casparus Stump ein schwarz sammeten rock zu
…
zu Freiburg wegen der Oschmenin fir den fal unser
81
Mariae umbsunsten zu lob der muttergottes gemacht
…
1649. Anno 1649 verehret zu eim weisen kelk
…
mit gold und guten berlin auf die monstranz gesteuret zu
…
pau pfleger verehret zu einem antipendium ins chörlin
…
silberen frauwenbilt zu verwenden in gelt 50 fl.
…
bekannt 3 fl 9 b., frau Schächtelin, amtmännin zu
…
1.) zwo güldene houben zum venerabili zu ge-
82
1748. Den 13. april anno 1748 verehret zu ehren gegen haltung eines ewigen jahrzeits durch 2 hl. messen'
…
und wurde zu dessen Gunsten öffentlich versteigert.
…
größten Teil ihrer Häuser verpfändet und sich zu
…
Abgabe hofrechtlicher Art zu denken. Auch diese
…
zu bringen, müsste man wegen des hohen Alters des
…
1 H.Schreiber, Das Münster zu Freiburg im Breisgau. Karlsr.
…
1748. Den 13. april anno 1748 verehret zu ehren gegen haltung eines ewigen jahrzeits durch 2 hl. messen'
…
und wurde zu dessen Gunsten öffentlich versteigert.
…
größten Teil ihrer Häuser verpfändet und sich zu
…
Abgabe hofrechtlicher Art zu denken. Auch diese
…
zu bringen, müsste man wegen des hohen Alters des
…
1 H.Schreiber, Das Münster zu Freiburg im Breisgau. Karlsr.
Der Ritt ums Grab im Münster
83
tigte Sammler gingen von Haus zu Haus, von Dorf
…
lich im Lauf der Zeit gewohnheitsrechtlich zu einer
…
burger nicht vergaßen, das Münster zu bedenken.
…
gewohnheitsmäßig geübte Sitte zurück, die sich zu
…
in alter Zeit auch die zu den Leichenfeierlichkeiten
…
Geist-Spital und den Frauen zu Günterstal'. In
…
dem Begräbnis -- besonders glänzend zu begehen,
…
begangen und 3 roß zu opfer und etlich tucher an die
Der neueste Münsterführer
84
zu schaffen1. An Vollständigkeit steht das neue Werk
…
fasser zu bewunderndem Entzücken verleiten, das ein
…
vielgebrauchten Führer vor allem viel zu empfindlich ist.
…
am nächsten steht, ist wohl zu merken: die baugeschicht-
…
Welt" zu benennen, in unserem Führer als „sinnlicher
…
(S. 51) scheint mir nur ein besseres Schwein zu sein
…
funden zu haben. Der Zusatz (gehalten?) hinter dem
…
Fußnoten namhaft zu machen. Doch vermisst man hier
…
schrieben worden ist, dass es sehr zu begrüßen wäre,
…
um die Orientierung bequemer zu machen. Alle diese
Umschlag hinten
50
Kreuzer, Der Altar im Dettinger Chörlein
Wappen des Abts Ludwig IL, Blarer von Einsiedeln.
Vermeidung unmotivierter Nuditäten zeichnen die
Gemälde aus.
Die Mitte der Predella nimmt die Widmungs-
inschrift, gleichsam der Stiftungsbrief ein. Sie lautet
(unter Beseitigung der Abkürzungen):
Deo, deiparae virgini, sanctis Andreae, Jacobo,
Christophoro,
Magdalenae, Ursulae cum sodalibus aram dicatam,
consecratam
Wilielmus Blarer a Wartensee cathedralis ecclesiae
Basiliensis
Canonicus custos, ad sancti Ursicini praepositus,
maiorum suorum zelum
Religionis huic sacello consignatum imitatus posita
tabula decoravit
Ut Numen veneraretur, nomen sanctorum vocaret
in vota
Posteros duceret in exemplum
Patriae et avitae virtutis.
ANNO MDCXV1.
1 Diesen Gott, der jungfräulichen Gottesgebärerin, den
Heiligen Andreas, Jakobus, Christophorus, Magdalena, Ursula
mit ihren Genossinnen gewidmeten und geweihten Altar
schmückte Wilhelm Blarer von Wartensee, der Kathedralkirche
zu Basel Domkustos und Propst zu St. Ursiz (St. Ursanne) in
Nachahmung des religiösen Eifers seiner Ahnen durch Auf-
stellung dieser Altartafel, um Gott zu verehren, den Namen
der Heiligen für seine Anliegen anzurufen und die Nachkommen
zur Befolgung des Beispiels der Tugend der väterlichen und
mütterlichen Vorfahren anzuleiten, im Jahre 1615.
Zu beiden Seiten der Predella befinden sich die
Wappen der Familien Blarer (Hahn in Rot auf Silber)
und Lichtenfels (Beil und Flug in Gold auf Schwarz).
Die Adelsfamilien sowohl der Blarer als der
Lichtenfels waren reich an hervorragenden kirch-
lichen Würdenträgern. Namentlich entstammten dem
Blarerschen Familienzweige „von Wartensee" die
Wiederhersteller der berühmten Stifte St. Gallen:
Abt Diethelm 1530—64, und Einsiedeln: Abt Lud-
wig II. 1526—44, nach den Wirren der Reformation
- ersterer ein Großoheim unseres Wilhelm -- und
Wilhelms Oheim, der Fürstbischof Jakob Christoph
von Basel (geb. 1542, gest. 1608), der um die
Hebung des kirchlichen Lebens in seiner Diözese
hohe Verdienste hat. Jakob Christoph hat 1575
den bischöflichen Stuhl von Basel als Nachfolger
des Fürstbischofs Melchior von Lichtenfels bestiegen
und nach Beratung mit Karl Borromäus, Kardinal-
erzbischof von Mailand, eine Diözesansynode ab-
gehalten, an welcher auch Petrus Canisius tätigen
Anteil nahm.
Das Kollegiatstift des hl. Ursicinus (St. Ursiz),
dessen Propst Wilhelm Blarer war, befand sich zu
St. Ursanne im nördlichen Berner Jura. Es war ur-
sprünglich ein Benediktinerkloster, wurde in un-
bekannter Zeit in ein Chorherrenstift verwandelt und
erhielt im 12. Jahrhundert eine neue Kirche in ro-
manischem Stil, welche das hervorragendste Bauwerk
des Berner Jura und auch für die Baugeschichte
der romanischen Teile unseres Münsters zu be-
achten ist.
Die Prüfung der Frage: In welchem Zusammen-
hange steht nun Wilhelm Blarer zu den Familien
von Lichtenfels und von Krozingen; wie kommt er
dazu, gerade in deren Kapelle im Münster den Altar-
aufsatz zu stiften? erfordert einige Angaben über die
Fensterbilder und Grabsteine dieser Kapelle.
Wilhelm Blarer von Wartensee, 1578 geboren,
ist der Sohn des Wolfgang Dietrich alias Wilhelm
Friedrich Blarer von Wartensee (gest. 1612) und
dessen Gattin Barbara von Lichtenfels; er erscheint
1607 als Besitzer des Hauses Nr. 5 der Herrenstraße
hier „zum goldnen Fälklein". Der eben genannte
Fürstbischof Jakob Christoph war der Bruder seines
Vaters; eine Vatersschwester hieß Ursula. Wir
werden die Namenspatrone dieser Angehörigen auf
dem Altare dargestellt finden.
Die Familie der Mutter Wilhelm Blarers, die
von Lichtenfels, hängt zusammen mit der Familie
der von Krozingen. Beide Familien scheinen zur
Herstellung der Kapelle so viel beigetragen zu haben,
dass ihnen als Stiftern gestattet werden konnte, ihre
Wappen in den Schlusssteinen anzubringen. Und
zwar muss das vornehmlich die Lichtenfelssche Fa-
Kreuzer, Der Altar im Dettinger Chörlein
Wappen des Abts Ludwig IL, Blarer von Einsiedeln.
Vermeidung unmotivierter Nuditäten zeichnen die
Gemälde aus.
Die Mitte der Predella nimmt die Widmungs-
inschrift, gleichsam der Stiftungsbrief ein. Sie lautet
(unter Beseitigung der Abkürzungen):
Deo, deiparae virgini, sanctis Andreae, Jacobo,
Christophoro,
Magdalenae, Ursulae cum sodalibus aram dicatam,
consecratam
Wilielmus Blarer a Wartensee cathedralis ecclesiae
Basiliensis
Canonicus custos, ad sancti Ursicini praepositus,
maiorum suorum zelum
Religionis huic sacello consignatum imitatus posita
tabula decoravit
Ut Numen veneraretur, nomen sanctorum vocaret
in vota
Posteros duceret in exemplum
Patriae et avitae virtutis.
ANNO MDCXV1.
1 Diesen Gott, der jungfräulichen Gottesgebärerin, den
Heiligen Andreas, Jakobus, Christophorus, Magdalena, Ursula
mit ihren Genossinnen gewidmeten und geweihten Altar
schmückte Wilhelm Blarer von Wartensee, der Kathedralkirche
zu Basel Domkustos und Propst zu St. Ursiz (St. Ursanne) in
Nachahmung des religiösen Eifers seiner Ahnen durch Auf-
stellung dieser Altartafel, um Gott zu verehren, den Namen
der Heiligen für seine Anliegen anzurufen und die Nachkommen
zur Befolgung des Beispiels der Tugend der väterlichen und
mütterlichen Vorfahren anzuleiten, im Jahre 1615.
Zu beiden Seiten der Predella befinden sich die
Wappen der Familien Blarer (Hahn in Rot auf Silber)
und Lichtenfels (Beil und Flug in Gold auf Schwarz).
Die Adelsfamilien sowohl der Blarer als der
Lichtenfels waren reich an hervorragenden kirch-
lichen Würdenträgern. Namentlich entstammten dem
Blarerschen Familienzweige „von Wartensee" die
Wiederhersteller der berühmten Stifte St. Gallen:
Abt Diethelm 1530—64, und Einsiedeln: Abt Lud-
wig II. 1526—44, nach den Wirren der Reformation
- ersterer ein Großoheim unseres Wilhelm -- und
Wilhelms Oheim, der Fürstbischof Jakob Christoph
von Basel (geb. 1542, gest. 1608), der um die
Hebung des kirchlichen Lebens in seiner Diözese
hohe Verdienste hat. Jakob Christoph hat 1575
den bischöflichen Stuhl von Basel als Nachfolger
des Fürstbischofs Melchior von Lichtenfels bestiegen
und nach Beratung mit Karl Borromäus, Kardinal-
erzbischof von Mailand, eine Diözesansynode ab-
gehalten, an welcher auch Petrus Canisius tätigen
Anteil nahm.
Das Kollegiatstift des hl. Ursicinus (St. Ursiz),
dessen Propst Wilhelm Blarer war, befand sich zu
St. Ursanne im nördlichen Berner Jura. Es war ur-
sprünglich ein Benediktinerkloster, wurde in un-
bekannter Zeit in ein Chorherrenstift verwandelt und
erhielt im 12. Jahrhundert eine neue Kirche in ro-
manischem Stil, welche das hervorragendste Bauwerk
des Berner Jura und auch für die Baugeschichte
der romanischen Teile unseres Münsters zu be-
achten ist.
Die Prüfung der Frage: In welchem Zusammen-
hange steht nun Wilhelm Blarer zu den Familien
von Lichtenfels und von Krozingen; wie kommt er
dazu, gerade in deren Kapelle im Münster den Altar-
aufsatz zu stiften? erfordert einige Angaben über die
Fensterbilder und Grabsteine dieser Kapelle.
Wilhelm Blarer von Wartensee, 1578 geboren,
ist der Sohn des Wolfgang Dietrich alias Wilhelm
Friedrich Blarer von Wartensee (gest. 1612) und
dessen Gattin Barbara von Lichtenfels; er erscheint
1607 als Besitzer des Hauses Nr. 5 der Herrenstraße
hier „zum goldnen Fälklein". Der eben genannte
Fürstbischof Jakob Christoph war der Bruder seines
Vaters; eine Vatersschwester hieß Ursula. Wir
werden die Namenspatrone dieser Angehörigen auf
dem Altare dargestellt finden.
Die Familie der Mutter Wilhelm Blarers, die
von Lichtenfels, hängt zusammen mit der Familie
der von Krozingen. Beide Familien scheinen zur
Herstellung der Kapelle so viel beigetragen zu haben,
dass ihnen als Stiftern gestattet werden konnte, ihre
Wappen in den Schlusssteinen anzubringen. Und
zwar muss das vornehmlich die Lichtenfelssche Fa-