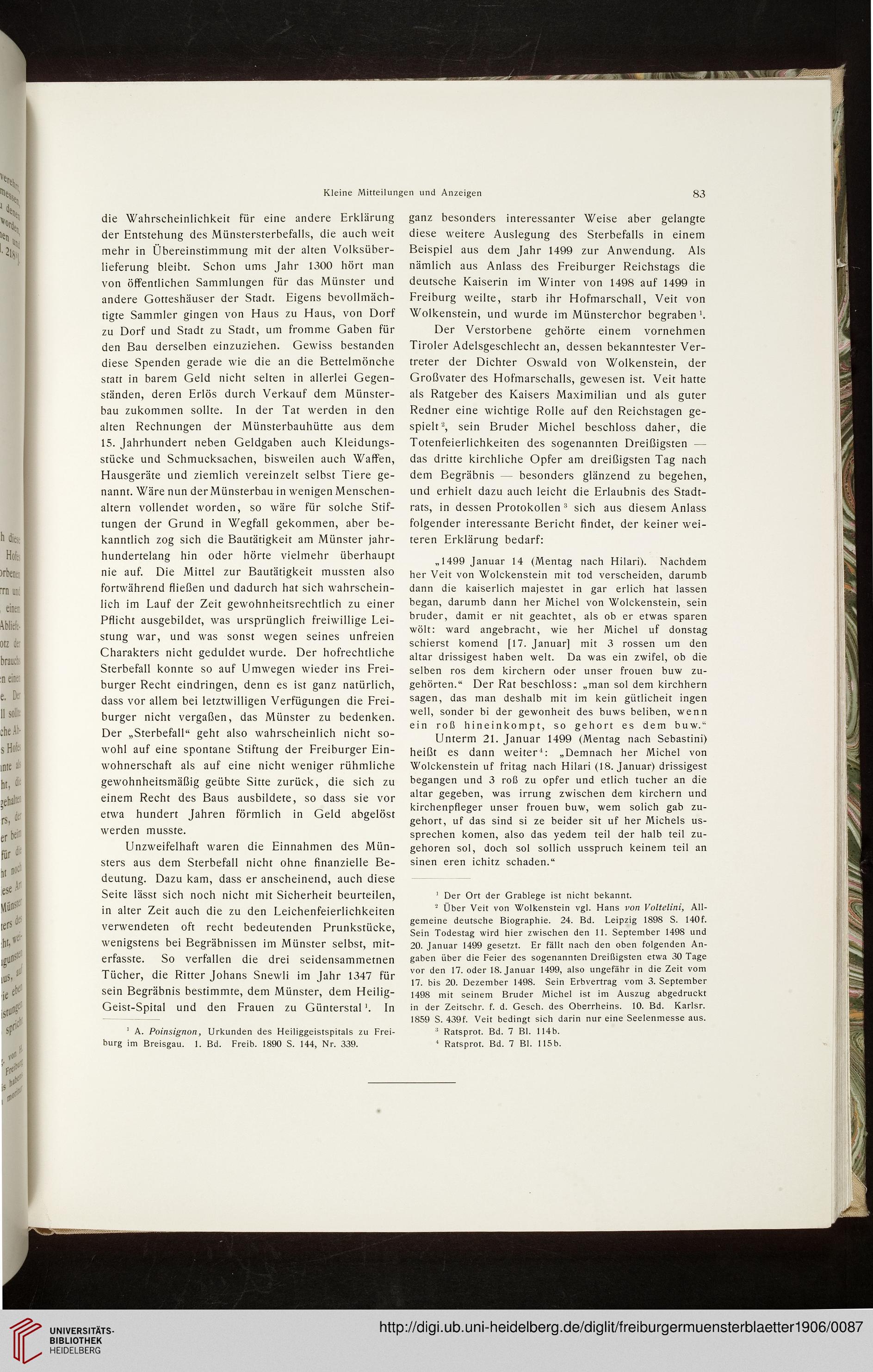Kleine Mitteilungen und Anzeigen
83
die Wahrscheinlichkeit für eine andere Erklärung
der Entstehung des Münstersterbefalls, die auch weit
mehr in Übereinstimmung mit der alten Volksüber-
lieferung bleibt. Schon ums Jahr 1300 hört man
von öffentlichen Sammlungen für das Münster und
andere Gotteshäuser der Stadt. Eigens bevollmäch-
tigte Sammler gingen von Haus zu Haus, von Dorf
zu Dorf und Stadt zu Stadt, um fromme Gaben für
den Bau derselben einzuziehen. Gewiss bestanden
diese Spenden gerade wie die an die Bettelmönche
statt in barem Geld nicht selten in allerlei Gegen-
ständen, deren Erlös durch Verkauf dem Münster-
bau zukommen sollte. In der Tat werden in den
alten Rechnungen der Münsterbauhütte aus dem
15. Jahrhundert neben Geldgaben auch Kleidungs-
stücke und Schmucksachen, bisweilen auch Waffen,
Hausgeräte und ziemlich vereinzelt selbst Tiere ge-
nannt. Wäre nun der Münsterbau in wenigen Menschen-
altern vollendet worden, so wäre für solche Stif-
tungen der Grund in Wegfall gekommen, aber be-
kanntlich zog sich die Bautätigkeit am Münster jahr-
hundertelang hin oder hörte vielmehr überhaupt
nie auf. Die Mittel zur Bautätigkeit mussten also
fortwährend fließen und dadurch hat sich wahrschein-
lich im Lauf der Zeit gewohnheitsrechtlich zu einer
Pflicht ausgebildet, was ursprünglich freiwillige Lei-
stung war, und was sonst wegen seines unfreien
Charakters nicht geduldet wurde. Der hofrechtliche
Sterbefall konnte so auf Umwegen wieder ins Frei-
burger Recht eindringen, denn es ist ganz natürlich,
dass vor allem bei letztwilligen Verfügungen die Frei-
burger nicht vergaßen, das Münster zu bedenken.
Der „Sterbefall" geht also wahrscheinlich nicht so-
wohl auf eine spontane Stiftung der Freiburger Ein-
wohnerschaft als auf eine nicht weniger rühmliche
gewohnheitsmäßig geübte Sitte zurück, die sich zu
einem Recht des Baus ausbildete, so dass sie vor
etwa hundert Jahren förmlich in Geld abgelöst
werden musste.
Unzweifelhaft waren die Einnahmen des Mün-
sters aus dem Sterbefall nicht ohne finanzielle Be-
deutung. Dazu kam, dass er anscheinend, auch diese
Seite lässt sich noch nicht mit Sicherheit beurteilen,
in alter Zeit auch die zu den Leichenfeierlichkeiten
verwendeten oft recht bedeutenden Prunkstücke,
wenigstens bei Begräbnissen im Münster selbst, mit-
erfasste. So verfallen die drei seidensammetnen
Tücher, die Ritter Johans Snewli im Jahr 1347 für
sein Begräbnis bestimmte, dem Münster, dem Heilig-
Geist-Spital und den Frauen zu Günterstal'. In
1 A. Poinsignon, Urkunden des Heiliggeistspitals zu Frei-
burg im Breisgau. 1. Bd. Freib. 1890 S. 144, Nr. 339.
ganz besonders interessanter Weise aber gelangte
diese weitere Auslegung des Sterbefalls in einem
Beispiel aus dem Jahr 1499 zur Anwendung. Als
nämlich aus Anlass des Freiburger Reichstags die
deutsche Kaiserin im Winter von 1498 auf 1499 in
Freiburg weilte, starb ihr Hofmarschall, Veit von
Wolkenstein, und wurde im Münsterchor begraben1.
Der Verstorbene gehörte einem vornehmen
Tiroler Adelsgeschlecht an, dessen bekanntester Ver-
treter der Dichter Oswald von Wolkenstein, der
Großvater des Hofmarschalls, gewesen ist. Veit hatte
als Ratgeber des Kaisers Maximilian und als guter
Redner eine wichtige Rolle auf den Reichstagen ge-
spielt'2, sein Bruder Michel beschloss daher, die
Totenfeierlichkeiten des sogenannten Dreißigsten —
das dritte kirchliche Opfer am dreißigsten Tag nach
dem Begräbnis -- besonders glänzend zu begehen,
und erhielt dazu auch leicht die Erlaubnis des Stadt-
rats, in dessen Protokollen3 sich aus diesem Anlass
folgender interessante Bericht findet, der keiner wei-
teren Erklärung bedarf:
„1499 Januar 14 (Mentag nach Hilari). Nachdem
her Veit von Wolckenstein mit tod verscheiden, darumb
dann die kaiserlich majestet in gar erlich hat lassen
began, darumb dann her Michel von Wolckenstein, sein
bruder, damit er nit geachtet, als ob er etwas sparen
wölt: ward angebracht, wie her Michel uf donstag
schierst körnend [17. Januar] mit 3 rossen um den
altar drissigest haben weit. Da was ein zwifel, ob die
selben ros dem kirchern oder unser frouen buw zu-
gehörten." Der Rat beschloss: „man sol dem kirchhern
sagen, das man deshalb mit im kein gütlicheit ingen
well, sonder bi der gewonheit des buws beliben, wenn
ein roß hineinkompt, so gehört es dem buw."
Unterm 21. Januar 1499 (Mentag nach Sebastini)
heißt es dann weiter4: „Demnach her Michel von
Wolckenstein uf fritag nach Hilari (18. Januar) drissigest
begangen und 3 roß zu opfer und etlich tucher an die
altar gegeben, was irrung zwischen dem kirchern und
kirchenpfleger unser frouen buw, wem solich gab zu-
gehört, uf das sind si ze beider sit uf her Michels us-
sprechen komen, also das yedem teil der halb teil zu-
gehoren sol, doch sol sollich usspruch keinem teil an
sinen eren ichitz schaden."
1 Der Ort der Grablege ist nicht bekannt.
2 Über Veit von Wolkenstein vgl. Hans von Voltelini, All-
gemeine deutsche Biographie. 24. Bd. Leipzig 1898 S. 140f.
Sein Todestag wird hier zwischen den 11. September 1498 und
20. Januar 1499 gesetzt. Er fällt nach den oben folgenden An-
gaben über die Feier des sogenannten Dreißigsten etwa 30 Tage
vor den 17. oder 18. Januar 1499, also ungefähr in die Zeit vom
17. bis 20. Dezember 1498. Sein Erbvertrag vom 3. September
1498 mit seinem Bruder Michel ist im Auszug abgedruckt
in der Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins. 10. Bd. Karlsr.
1859 S. 439f. Veit bedingt sich darin nur eine Seelenmesse aus.
3 Ratsprot. Bd. 7 Bl. 114b.
" Ratsprot. Bd. 7 Bl. 115 b.
■
■3-.,
4L
jTOfWni
83
die Wahrscheinlichkeit für eine andere Erklärung
der Entstehung des Münstersterbefalls, die auch weit
mehr in Übereinstimmung mit der alten Volksüber-
lieferung bleibt. Schon ums Jahr 1300 hört man
von öffentlichen Sammlungen für das Münster und
andere Gotteshäuser der Stadt. Eigens bevollmäch-
tigte Sammler gingen von Haus zu Haus, von Dorf
zu Dorf und Stadt zu Stadt, um fromme Gaben für
den Bau derselben einzuziehen. Gewiss bestanden
diese Spenden gerade wie die an die Bettelmönche
statt in barem Geld nicht selten in allerlei Gegen-
ständen, deren Erlös durch Verkauf dem Münster-
bau zukommen sollte. In der Tat werden in den
alten Rechnungen der Münsterbauhütte aus dem
15. Jahrhundert neben Geldgaben auch Kleidungs-
stücke und Schmucksachen, bisweilen auch Waffen,
Hausgeräte und ziemlich vereinzelt selbst Tiere ge-
nannt. Wäre nun der Münsterbau in wenigen Menschen-
altern vollendet worden, so wäre für solche Stif-
tungen der Grund in Wegfall gekommen, aber be-
kanntlich zog sich die Bautätigkeit am Münster jahr-
hundertelang hin oder hörte vielmehr überhaupt
nie auf. Die Mittel zur Bautätigkeit mussten also
fortwährend fließen und dadurch hat sich wahrschein-
lich im Lauf der Zeit gewohnheitsrechtlich zu einer
Pflicht ausgebildet, was ursprünglich freiwillige Lei-
stung war, und was sonst wegen seines unfreien
Charakters nicht geduldet wurde. Der hofrechtliche
Sterbefall konnte so auf Umwegen wieder ins Frei-
burger Recht eindringen, denn es ist ganz natürlich,
dass vor allem bei letztwilligen Verfügungen die Frei-
burger nicht vergaßen, das Münster zu bedenken.
Der „Sterbefall" geht also wahrscheinlich nicht so-
wohl auf eine spontane Stiftung der Freiburger Ein-
wohnerschaft als auf eine nicht weniger rühmliche
gewohnheitsmäßig geübte Sitte zurück, die sich zu
einem Recht des Baus ausbildete, so dass sie vor
etwa hundert Jahren förmlich in Geld abgelöst
werden musste.
Unzweifelhaft waren die Einnahmen des Mün-
sters aus dem Sterbefall nicht ohne finanzielle Be-
deutung. Dazu kam, dass er anscheinend, auch diese
Seite lässt sich noch nicht mit Sicherheit beurteilen,
in alter Zeit auch die zu den Leichenfeierlichkeiten
verwendeten oft recht bedeutenden Prunkstücke,
wenigstens bei Begräbnissen im Münster selbst, mit-
erfasste. So verfallen die drei seidensammetnen
Tücher, die Ritter Johans Snewli im Jahr 1347 für
sein Begräbnis bestimmte, dem Münster, dem Heilig-
Geist-Spital und den Frauen zu Günterstal'. In
1 A. Poinsignon, Urkunden des Heiliggeistspitals zu Frei-
burg im Breisgau. 1. Bd. Freib. 1890 S. 144, Nr. 339.
ganz besonders interessanter Weise aber gelangte
diese weitere Auslegung des Sterbefalls in einem
Beispiel aus dem Jahr 1499 zur Anwendung. Als
nämlich aus Anlass des Freiburger Reichstags die
deutsche Kaiserin im Winter von 1498 auf 1499 in
Freiburg weilte, starb ihr Hofmarschall, Veit von
Wolkenstein, und wurde im Münsterchor begraben1.
Der Verstorbene gehörte einem vornehmen
Tiroler Adelsgeschlecht an, dessen bekanntester Ver-
treter der Dichter Oswald von Wolkenstein, der
Großvater des Hofmarschalls, gewesen ist. Veit hatte
als Ratgeber des Kaisers Maximilian und als guter
Redner eine wichtige Rolle auf den Reichstagen ge-
spielt'2, sein Bruder Michel beschloss daher, die
Totenfeierlichkeiten des sogenannten Dreißigsten —
das dritte kirchliche Opfer am dreißigsten Tag nach
dem Begräbnis -- besonders glänzend zu begehen,
und erhielt dazu auch leicht die Erlaubnis des Stadt-
rats, in dessen Protokollen3 sich aus diesem Anlass
folgender interessante Bericht findet, der keiner wei-
teren Erklärung bedarf:
„1499 Januar 14 (Mentag nach Hilari). Nachdem
her Veit von Wolckenstein mit tod verscheiden, darumb
dann die kaiserlich majestet in gar erlich hat lassen
began, darumb dann her Michel von Wolckenstein, sein
bruder, damit er nit geachtet, als ob er etwas sparen
wölt: ward angebracht, wie her Michel uf donstag
schierst körnend [17. Januar] mit 3 rossen um den
altar drissigest haben weit. Da was ein zwifel, ob die
selben ros dem kirchern oder unser frouen buw zu-
gehörten." Der Rat beschloss: „man sol dem kirchhern
sagen, das man deshalb mit im kein gütlicheit ingen
well, sonder bi der gewonheit des buws beliben, wenn
ein roß hineinkompt, so gehört es dem buw."
Unterm 21. Januar 1499 (Mentag nach Sebastini)
heißt es dann weiter4: „Demnach her Michel von
Wolckenstein uf fritag nach Hilari (18. Januar) drissigest
begangen und 3 roß zu opfer und etlich tucher an die
altar gegeben, was irrung zwischen dem kirchern und
kirchenpfleger unser frouen buw, wem solich gab zu-
gehört, uf das sind si ze beider sit uf her Michels us-
sprechen komen, also das yedem teil der halb teil zu-
gehoren sol, doch sol sollich usspruch keinem teil an
sinen eren ichitz schaden."
1 Der Ort der Grablege ist nicht bekannt.
2 Über Veit von Wolkenstein vgl. Hans von Voltelini, All-
gemeine deutsche Biographie. 24. Bd. Leipzig 1898 S. 140f.
Sein Todestag wird hier zwischen den 11. September 1498 und
20. Januar 1499 gesetzt. Er fällt nach den oben folgenden An-
gaben über die Feier des sogenannten Dreißigsten etwa 30 Tage
vor den 17. oder 18. Januar 1499, also ungefähr in die Zeit vom
17. bis 20. Dezember 1498. Sein Erbvertrag vom 3. September
1498 mit seinem Bruder Michel ist im Auszug abgedruckt
in der Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins. 10. Bd. Karlsr.
1859 S. 439f. Veit bedingt sich darin nur eine Seelenmesse aus.
3 Ratsprot. Bd. 7 Bl. 114b.
" Ratsprot. Bd. 7 Bl. 115 b.
■
■3-.,
4L
jTOfWni