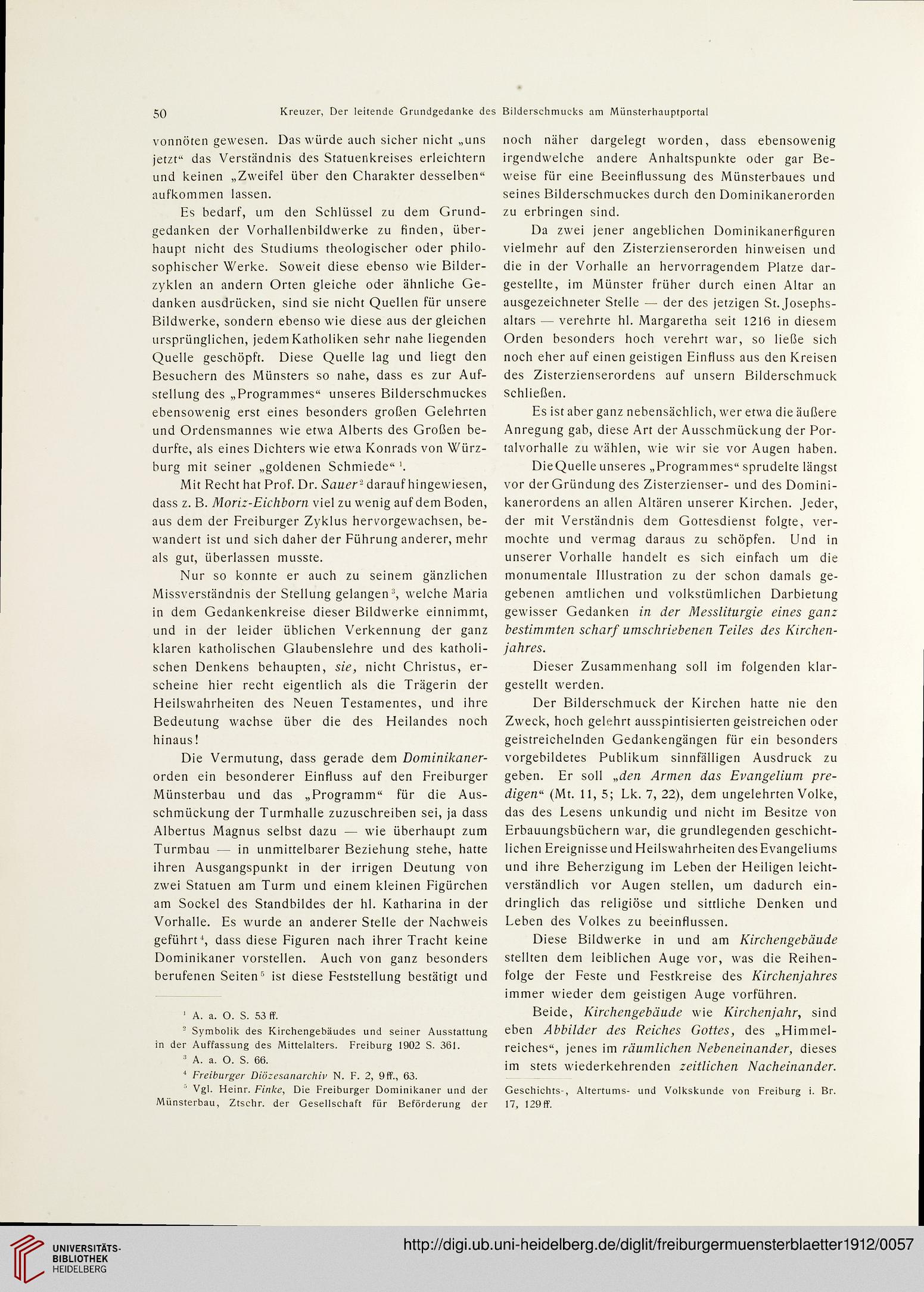50
Kreuzer, Der leitende Grundgedanke des Bilderschmucks am Münsterhauptportal
vonnöten gewesen. Das würde auch sicher nicht „uns
jetzt" das Verständnis des Statuenkreises erleichtern
und keinen „Zweifel über den Charakter desselben"
aufkommen lassen.
Es bedarf, um den Schlüssel zu dem Grund-
gedanken der Vorhallenbildwerke zu finden, über-
haupt nicht des Studiums theologischer oder philo-
sophischer Werke. Soweit diese ebenso wie Bilder-
zyklen an andern Orten gleiche oder ähnliche Ge-
danken ausdrücken, sind sie nicht Quellen für unsere
Bildwerke, sondern ebenso wie diese aus dergleichen
ursprünglichen, jedem Katholiken sehr nahe liegenden
Quelle geschöpft. Diese Quelle lag und liegt den
Besuchern des Münsters so nahe, dass es zur Auf-
stellung des „Programmes" unseres Bilderschmuckes
ebensowenig erst eines besonders großen Gelehrten
und Ordensmannes wie etwa Alberts des Großen be-
durfte, als eines Dichters wie etwa Konrads von Würz-
burg mit seiner „goldenen Schmiede"l.
Mit Recht hat Prof. Dr. Sauer2 daraufhingewiesen,
dass z. B. Moriz-Eichborn viel zu wenig auf dem Boden,
aus dem der Freiburger Zyklus hervorgewachsen, be-
wandert ist und sich daher der Führung anderer, mehr
als gut, überlassen musste.
Nur so konnte er auch zu seinem gänzlichen
Missverständnis der Stellung gelangen3, welche Maria
in dem Gedankenkreise dieser Bildwerke einnimmt,
und in der leider üblichen Verkennung der ganz
klaren katholischen Glaubenslehre und des katholi-
schen Denkens behaupten, sie, nicht Christus, er-
scheine hier recht eigentlich als die Trägerin der
Heilswahrheiten des Neuen Testamentes, und ihre
Bedeutung wachse über die des Heilandes noch
hinaus!
Die Vermutung, dass gerade dem Dominikaner-
orden ein besonderer Einfluss auf den Freiburger
Münsterbau und das „Programm" für die Aus-
schmückung der Turmhalle zuzuschreiben sei, ja dass
Albertus Magnus selbst dazu — wie überhaupt zum
Turmbau — in unmittelbarer Beziehung stehe, hatte
ihren Ausgangspunkt in der irrigen Deutung von
zwei Statuen am Turm und einem kleinen Figürchen
am Sockel des Standbildes der hl. Katharina in der
Vorhalle. Es wurde an anderer Stelle der Nachweis
geführt4, dass diese Figuren nach ihrer Tracht keine
Dominikaner vorstellen. Auch von ganz besonders
berufenen Seiten5 ist diese Feststellung bestätigt und
1 A. a. O. S. 53 ff.
2 Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung
in der Auffassung des Mittelalters. Freiburg 1902 S. 361.
" A. a. O. S. 66.
4 Freiburger Diözesanarchiv N. F. 2, 9ff., 63.
" Vgl. Heinr. Finke, Die Freiburger Dominikaner und der
Münsterbau, Ztschr. der Gesellschaft für Beförderung der
noch näher dargelegt worden, dass ebensowenig
irgendwelche andere Anhaltspunkte oder gar Be-
weise für eine Beeinflussung des Münsterbaues und
seines Bilderschmuckes durch den Dominikanerorden
zu erbringen sind.
Da zwei jener angeblichen Dominikanerfiguren
vielmehr auf den Zisterzienserorden hinweisen und
die in der Vorhalle an hervorragendem Platze dar-
gestellte, im Münster früher durch einen Altar an
ausgezeichneter Stelle — der des jetzigen St. Josephs-
altars — verehrte hl. Margaretha seit 1216 in diesem
Orden besonders hoch verehrt war, so ließe sich
noch eher auf einen geistigen Einfluss aus den Kreisen
des Zisterzienserordens auf unsern Bilderschmuck
Schließen.
Es ist aber ganz nebensächlich, wer etwa die äußere
Anregung gab, diese Art der Ausschmückung der Por-
talvorhalle zu wählen, wie wir sie vor Augen haben.
DieQuelle unseres „Programmes" sprudelte längst
vor derGründung des Zisterzienser- und des Domini-
kanerordens an allen Altären unserer Kirchen. Jeder,
der mit Verständnis dem Gottesdienst folgte, ver-
mochte und vermag daraus zu schöpfen. Und in
unserer Vorhalle handelt es sich einfach um die
monumentale Illustration zu der schon damals ge-
gebenen amtlichen und volkstümlichen Darbietung
gewisser Gedanken in der Messliturgie eines ganz
bestimmten scharf umschriebenen Teiles des Kirchen-
jahres.
Dieser Zusammenhang soll im folgenden klar-
gestellt werden.
Der Bilderschmuck der Kirchen hatte nie den
Zweck, hoch gelehrt ausspintisierten geistreichen oder
geistreichelnden Gedankengängen für ein besonders
vorgebildetes Publikum sinnfälligen Ausdruck zu
geben. Er soll „den Armen das Evangelium pre-
digen11 (Mt. 11, 5; Lk. 7, 22), dem ungelehrten Volke,
das des Lesens unkundig und nicht im Besitze von
Erbauungsbüchern war, die grundlegenden geschicht-
lichen Ereignisseund Heilswahrheiten des Evangeliums
und ihre Beherzigung im Leben der Heiligen leicht-
verständlich vor Augen stellen, um dadurch ein-
dringlich das religiöse und sittliche Denken und
Leben des Volkes zu beeinflussen.
Diese Bildwerke in und am Kirchengebäude
stellten dem leiblichen Auge vor, was die Reihen-
folge der Feste und Festkreise des Kirchenjahres
immer wieder dem geistigen Auge vorführen.
Beide, Kirchengebäude wie Kirchenjahr, sind
eben Abbilder des Reiches Gottes, des „Himmel-
reiches", jenes im räumlichen Nebeneinander, dieses
im stets wiederkehrenden zeitlichen Nacheinander.
Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg i. Br.
17, 129 ff.
Kreuzer, Der leitende Grundgedanke des Bilderschmucks am Münsterhauptportal
vonnöten gewesen. Das würde auch sicher nicht „uns
jetzt" das Verständnis des Statuenkreises erleichtern
und keinen „Zweifel über den Charakter desselben"
aufkommen lassen.
Es bedarf, um den Schlüssel zu dem Grund-
gedanken der Vorhallenbildwerke zu finden, über-
haupt nicht des Studiums theologischer oder philo-
sophischer Werke. Soweit diese ebenso wie Bilder-
zyklen an andern Orten gleiche oder ähnliche Ge-
danken ausdrücken, sind sie nicht Quellen für unsere
Bildwerke, sondern ebenso wie diese aus dergleichen
ursprünglichen, jedem Katholiken sehr nahe liegenden
Quelle geschöpft. Diese Quelle lag und liegt den
Besuchern des Münsters so nahe, dass es zur Auf-
stellung des „Programmes" unseres Bilderschmuckes
ebensowenig erst eines besonders großen Gelehrten
und Ordensmannes wie etwa Alberts des Großen be-
durfte, als eines Dichters wie etwa Konrads von Würz-
burg mit seiner „goldenen Schmiede"l.
Mit Recht hat Prof. Dr. Sauer2 daraufhingewiesen,
dass z. B. Moriz-Eichborn viel zu wenig auf dem Boden,
aus dem der Freiburger Zyklus hervorgewachsen, be-
wandert ist und sich daher der Führung anderer, mehr
als gut, überlassen musste.
Nur so konnte er auch zu seinem gänzlichen
Missverständnis der Stellung gelangen3, welche Maria
in dem Gedankenkreise dieser Bildwerke einnimmt,
und in der leider üblichen Verkennung der ganz
klaren katholischen Glaubenslehre und des katholi-
schen Denkens behaupten, sie, nicht Christus, er-
scheine hier recht eigentlich als die Trägerin der
Heilswahrheiten des Neuen Testamentes, und ihre
Bedeutung wachse über die des Heilandes noch
hinaus!
Die Vermutung, dass gerade dem Dominikaner-
orden ein besonderer Einfluss auf den Freiburger
Münsterbau und das „Programm" für die Aus-
schmückung der Turmhalle zuzuschreiben sei, ja dass
Albertus Magnus selbst dazu — wie überhaupt zum
Turmbau — in unmittelbarer Beziehung stehe, hatte
ihren Ausgangspunkt in der irrigen Deutung von
zwei Statuen am Turm und einem kleinen Figürchen
am Sockel des Standbildes der hl. Katharina in der
Vorhalle. Es wurde an anderer Stelle der Nachweis
geführt4, dass diese Figuren nach ihrer Tracht keine
Dominikaner vorstellen. Auch von ganz besonders
berufenen Seiten5 ist diese Feststellung bestätigt und
1 A. a. O. S. 53 ff.
2 Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung
in der Auffassung des Mittelalters. Freiburg 1902 S. 361.
" A. a. O. S. 66.
4 Freiburger Diözesanarchiv N. F. 2, 9ff., 63.
" Vgl. Heinr. Finke, Die Freiburger Dominikaner und der
Münsterbau, Ztschr. der Gesellschaft für Beförderung der
noch näher dargelegt worden, dass ebensowenig
irgendwelche andere Anhaltspunkte oder gar Be-
weise für eine Beeinflussung des Münsterbaues und
seines Bilderschmuckes durch den Dominikanerorden
zu erbringen sind.
Da zwei jener angeblichen Dominikanerfiguren
vielmehr auf den Zisterzienserorden hinweisen und
die in der Vorhalle an hervorragendem Platze dar-
gestellte, im Münster früher durch einen Altar an
ausgezeichneter Stelle — der des jetzigen St. Josephs-
altars — verehrte hl. Margaretha seit 1216 in diesem
Orden besonders hoch verehrt war, so ließe sich
noch eher auf einen geistigen Einfluss aus den Kreisen
des Zisterzienserordens auf unsern Bilderschmuck
Schließen.
Es ist aber ganz nebensächlich, wer etwa die äußere
Anregung gab, diese Art der Ausschmückung der Por-
talvorhalle zu wählen, wie wir sie vor Augen haben.
DieQuelle unseres „Programmes" sprudelte längst
vor derGründung des Zisterzienser- und des Domini-
kanerordens an allen Altären unserer Kirchen. Jeder,
der mit Verständnis dem Gottesdienst folgte, ver-
mochte und vermag daraus zu schöpfen. Und in
unserer Vorhalle handelt es sich einfach um die
monumentale Illustration zu der schon damals ge-
gebenen amtlichen und volkstümlichen Darbietung
gewisser Gedanken in der Messliturgie eines ganz
bestimmten scharf umschriebenen Teiles des Kirchen-
jahres.
Dieser Zusammenhang soll im folgenden klar-
gestellt werden.
Der Bilderschmuck der Kirchen hatte nie den
Zweck, hoch gelehrt ausspintisierten geistreichen oder
geistreichelnden Gedankengängen für ein besonders
vorgebildetes Publikum sinnfälligen Ausdruck zu
geben. Er soll „den Armen das Evangelium pre-
digen11 (Mt. 11, 5; Lk. 7, 22), dem ungelehrten Volke,
das des Lesens unkundig und nicht im Besitze von
Erbauungsbüchern war, die grundlegenden geschicht-
lichen Ereignisseund Heilswahrheiten des Evangeliums
und ihre Beherzigung im Leben der Heiligen leicht-
verständlich vor Augen stellen, um dadurch ein-
dringlich das religiöse und sittliche Denken und
Leben des Volkes zu beeinflussen.
Diese Bildwerke in und am Kirchengebäude
stellten dem leiblichen Auge vor, was die Reihen-
folge der Feste und Festkreise des Kirchenjahres
immer wieder dem geistigen Auge vorführen.
Beide, Kirchengebäude wie Kirchenjahr, sind
eben Abbilder des Reiches Gottes, des „Himmel-
reiches", jenes im räumlichen Nebeneinander, dieses
im stets wiederkehrenden zeitlichen Nacheinander.
Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg i. Br.
17, 129 ff.