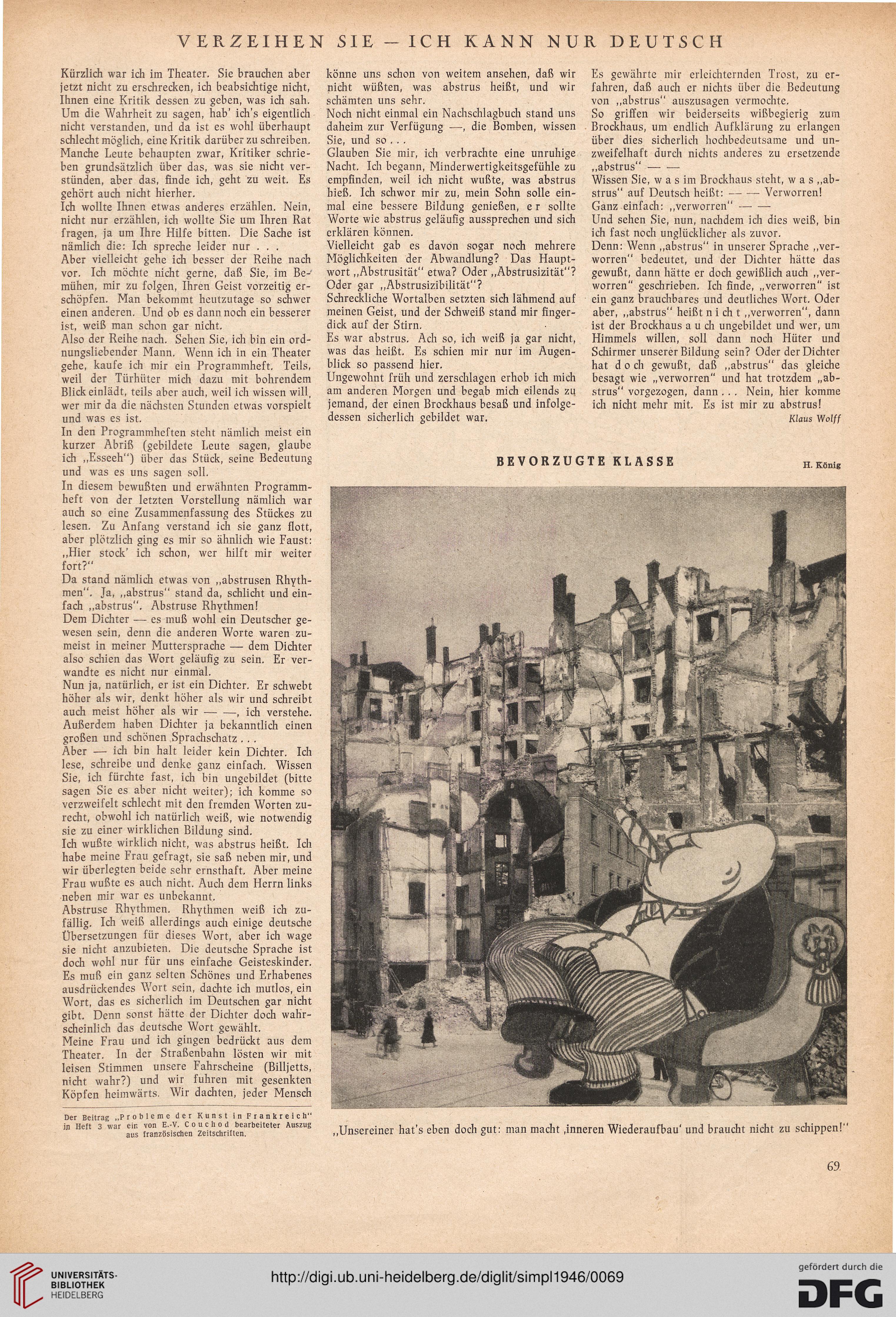VERZEIHEN SIE
-ICH KANN NUR DEUTSCH
Kürzlich war ich im Theater. Sie brauchen aber
jetzt nicht zu erschrecken, ich beabsichtige nicht,
Ihnen eine Kritik dessen zu geben, was ich sah.
Um die Wahrheit zu sagen, hab' ich's eigentlich
nicht verstanden, und da ist es wohl überhaupt
schlecht möglich, eine Kritik darüber zu schreiben.
Manche Leute behaupten zwar, Kritiker schrie-
ben grundsätzlich über das, was sie nicht ver-
stünden, aber das, finde ich, geht zu weit. Es
gehört auch nicht hierher.
Ich wollte Ihnen etwas anderes erzählen. Nein,
nicht nur erzählen, ich wollte Sie um Ihren Rat
fragen, ja um Ihre Hilfe bitten. Die Sache ist
nämlich die: Ich spreche leider nur . . .
Aber vielleicht gehe ich besser der Reihe nach
vor. Ich möchte nicht gerne, daß Sie, im Be-
mühen, mir zu folgen, Ihren Geist vorzeitig er-
schöpfen. Man bekommt heutzutage so schwer
einen anderen. Und ob es dann noch ein besserer
ist, weiß man schon gar nicht.
Also der Reihe nach. Sehen Sie, ich bin ein ord-
nungsliebender Mann. Wenn ich in ein Theater
gehe, kaufe ich mir ein Programmheft. Teils,
weil der Türhüter mich dazu mit bohrendem
Blick einlädt, teils aber auch, weil ich wissen will,
wer mir da die nächsten Stunden etwas vorspielt
und was es ist.
In den Programmheften steht nämlich meist ein
kurzer Abriß (gebildete Leute sagen, glaube
ich „Esseeh") über das Stück, seine Bedeutung
und was es uns sagen soll.
In diesem bewußten und erwähnten Programm-
heft von der letzten Vorstellung nämlich war
auch so eine Zusammenfassung des Stückes zu
lesen. Zu Anfang verstand ich sie ganz flott,
aber plötzlich ging es mir so ähnlich wie Faust:
„Hier stock' ich schon, wer hilft mir weiter
fort?"
Da stand nämlich etwas von „abstrusen Rhyth-
men". Ja, „abstrus" stand da, schlicht und ein-
fach „abstrus". Abstruse Rhythmen!
Dem Dichter — es muß wohl ein Deutscher ge-
wesen sein, denn die anderen Worte waren zu-
meist in meiner Muttersprache — dem Dichter
also schien das Wort geläufig zu sein. Er ver-
wandte es nicht nur einmal.
Nun ja, natürlich, er ist ein Dichter. Er schwebt
höher als wir, denkt höher als wir und schreibt
auch meist höher als wir--, ich verstehe.
Außerdem haben Dichter ja bekanntlich einen
großen und schönen Sprachschatz . . .
Aber — ich bin halt leider kein Dichter. Ich
lese, schreibe und denke ganz einfach. Wissen
Sie, ich fürchte fast, ich bin ungebildet (bitte
sagen Sie es aber nicht weiter); ich komme so
verzweifelt schlecht mit den fremden Worten zu-
recht, obwohl ich natürlich weiß, wie notwendig
sie zu einer wirklichen Bildung sind.
Ich wußte wirklich nicht, was abstrus heißt. Ich
habe meine Frau gefragt, sie saß neben mir, und
wir überlegten beide sehr ernsthaft. Aber meine
Frau wußte es auch nicht. Auch dem Herrn links
neben mir war es unbekannt.
Abstruse Rhythmen. Rhythmen weiß ich zu-
fällig. Ich weiß allerdings auch einige deutsche
Ubersetzungen für dieses Wort, aber ich wage
sie nicht anzubieten. Die deutsche Sprache ist
doch wohl nur für uns einfache Geisteskinder.
Es muß ein ganz selten Schönes und Erhabenes
ausdrückendes Wort sein, dachte ich mutlos, ein
Wort, das es sicherlich im Deutschen gar nicht
gibt. Denn sonst hätte der Dichter doch wahr-
scheinlich das deutsche Wort gewählt.
Meine Frau und ich gingen bedrückt aus dem
Theater. In der Straßenbahn lösten wir mit
leisen Stimmen unsere Fahrscheine (Billjetts,
nicht wahr?) und wir fuhren mit gesenkten
Köpfen heimwärts. Wir dachten, jeder Mensch
Der Beitrag „Probleme der Kunst in Frankreich"
in Heft 3 war ein von E.-V. Coucliod bearbeiteter Auszug
aus französischen Zeitschriften.
könne uns schon von weitem ansehen, daß wir
nicht wüßten, was abstrus heißt, und wir
schämten uns sehr.
Noch nicht einmal ein Nachschlagbuch stand uns
daheim zur Verfügung —, die Bomben, wissen
Sie, und so . . .
Glauben Sie mir, ich verbrachte eine unruhige
Nacht. Ich begann, Minderwertigkeitsgefühle zu
empfinden, weil ich nicht wußte, was abstrus
hieß. Ich schwor mir zu, mein Sohn solle ein-
mal eine bessere Bildung genießen, e r sollte
Worte wie abstrus geläufig aussprechen und sich
erklären können.
Vielleicht gab es davon sogar noch mehrere
Möglichkeiten der Abwandlung? Das Haupt-
wort „Abstrusität" etwa? Oder „Abstrusizität"?
Oder gar „Abstrusizibilität"?
Schreckliche Wortalben setzten sich lähmend auf
meinen Geist, und der Schweiß stand mir finger-
dick auf der Stirn.
Es war abstrus. Ach so, ich weiß ja gar nicht,
was das heißt. Es schien mir nur im Augen-
blick so passend hier.
Ungewohnt früh und zerschlagen erhob ich mich
am anderen Morgen und begab mich eilends zu
jemand, der einen Brockhaus besaß und infolge-
dessen sicherlich gebildet war.
Es gewährte mir erleichternden Trost, zu er-
fahren, daß auch er nichts über die Bedeutung
von „abstrus" auszusagen vermochte.
So griffen wir beiderseits wißbegierig zum
Brockhaus, um endlich Aufklärung zu erlangen
über dies sicherlich hochbedeutsame und un-
zweifelhaft durch nichts anderes zu ersetzende
„abstrus"--
Wissen Sie, was im Brockhaus steht, was „ab-
strus" auf Deutsch heißt:---Verworren!
Ganz einfach: „verworren"---
Und sehen Sie, nun, nachdem ich dies weiß, bin
ich fast noch unglücklicher als zuvor.
Denn: Wenn „abstrus" in unserer Sprache „ver-
worren" bedeutet, und der Dichter hätte das
gewußt, dann hätte er doch gewißlich auch „ver-
worren" geschrieben. Ich finde, „verworren" ist
ein ganz brauchbares und deutliches Wort. Oder
aber, „abstrus" heißt ni ch t „verworren", dann
ist der Brockhaus a u ch ungebildet und wer, um
Himmels willen, soll dann noch Hüter und
Schirmer unserer Bildung sein? Oder der Dichter
hat d o ch gewußt, daß „abstrus" das gleiche
besagt wie „verworren" und hat trotzdem „ab-
strus" vorgezogen, dann . . . Nein, hier komme
ich nicht mehr mit. Es ist mir zu abstrus!
Klaus Wolff
69
-ICH KANN NUR DEUTSCH
Kürzlich war ich im Theater. Sie brauchen aber
jetzt nicht zu erschrecken, ich beabsichtige nicht,
Ihnen eine Kritik dessen zu geben, was ich sah.
Um die Wahrheit zu sagen, hab' ich's eigentlich
nicht verstanden, und da ist es wohl überhaupt
schlecht möglich, eine Kritik darüber zu schreiben.
Manche Leute behaupten zwar, Kritiker schrie-
ben grundsätzlich über das, was sie nicht ver-
stünden, aber das, finde ich, geht zu weit. Es
gehört auch nicht hierher.
Ich wollte Ihnen etwas anderes erzählen. Nein,
nicht nur erzählen, ich wollte Sie um Ihren Rat
fragen, ja um Ihre Hilfe bitten. Die Sache ist
nämlich die: Ich spreche leider nur . . .
Aber vielleicht gehe ich besser der Reihe nach
vor. Ich möchte nicht gerne, daß Sie, im Be-
mühen, mir zu folgen, Ihren Geist vorzeitig er-
schöpfen. Man bekommt heutzutage so schwer
einen anderen. Und ob es dann noch ein besserer
ist, weiß man schon gar nicht.
Also der Reihe nach. Sehen Sie, ich bin ein ord-
nungsliebender Mann. Wenn ich in ein Theater
gehe, kaufe ich mir ein Programmheft. Teils,
weil der Türhüter mich dazu mit bohrendem
Blick einlädt, teils aber auch, weil ich wissen will,
wer mir da die nächsten Stunden etwas vorspielt
und was es ist.
In den Programmheften steht nämlich meist ein
kurzer Abriß (gebildete Leute sagen, glaube
ich „Esseeh") über das Stück, seine Bedeutung
und was es uns sagen soll.
In diesem bewußten und erwähnten Programm-
heft von der letzten Vorstellung nämlich war
auch so eine Zusammenfassung des Stückes zu
lesen. Zu Anfang verstand ich sie ganz flott,
aber plötzlich ging es mir so ähnlich wie Faust:
„Hier stock' ich schon, wer hilft mir weiter
fort?"
Da stand nämlich etwas von „abstrusen Rhyth-
men". Ja, „abstrus" stand da, schlicht und ein-
fach „abstrus". Abstruse Rhythmen!
Dem Dichter — es muß wohl ein Deutscher ge-
wesen sein, denn die anderen Worte waren zu-
meist in meiner Muttersprache — dem Dichter
also schien das Wort geläufig zu sein. Er ver-
wandte es nicht nur einmal.
Nun ja, natürlich, er ist ein Dichter. Er schwebt
höher als wir, denkt höher als wir und schreibt
auch meist höher als wir--, ich verstehe.
Außerdem haben Dichter ja bekanntlich einen
großen und schönen Sprachschatz . . .
Aber — ich bin halt leider kein Dichter. Ich
lese, schreibe und denke ganz einfach. Wissen
Sie, ich fürchte fast, ich bin ungebildet (bitte
sagen Sie es aber nicht weiter); ich komme so
verzweifelt schlecht mit den fremden Worten zu-
recht, obwohl ich natürlich weiß, wie notwendig
sie zu einer wirklichen Bildung sind.
Ich wußte wirklich nicht, was abstrus heißt. Ich
habe meine Frau gefragt, sie saß neben mir, und
wir überlegten beide sehr ernsthaft. Aber meine
Frau wußte es auch nicht. Auch dem Herrn links
neben mir war es unbekannt.
Abstruse Rhythmen. Rhythmen weiß ich zu-
fällig. Ich weiß allerdings auch einige deutsche
Ubersetzungen für dieses Wort, aber ich wage
sie nicht anzubieten. Die deutsche Sprache ist
doch wohl nur für uns einfache Geisteskinder.
Es muß ein ganz selten Schönes und Erhabenes
ausdrückendes Wort sein, dachte ich mutlos, ein
Wort, das es sicherlich im Deutschen gar nicht
gibt. Denn sonst hätte der Dichter doch wahr-
scheinlich das deutsche Wort gewählt.
Meine Frau und ich gingen bedrückt aus dem
Theater. In der Straßenbahn lösten wir mit
leisen Stimmen unsere Fahrscheine (Billjetts,
nicht wahr?) und wir fuhren mit gesenkten
Köpfen heimwärts. Wir dachten, jeder Mensch
Der Beitrag „Probleme der Kunst in Frankreich"
in Heft 3 war ein von E.-V. Coucliod bearbeiteter Auszug
aus französischen Zeitschriften.
könne uns schon von weitem ansehen, daß wir
nicht wüßten, was abstrus heißt, und wir
schämten uns sehr.
Noch nicht einmal ein Nachschlagbuch stand uns
daheim zur Verfügung —, die Bomben, wissen
Sie, und so . . .
Glauben Sie mir, ich verbrachte eine unruhige
Nacht. Ich begann, Minderwertigkeitsgefühle zu
empfinden, weil ich nicht wußte, was abstrus
hieß. Ich schwor mir zu, mein Sohn solle ein-
mal eine bessere Bildung genießen, e r sollte
Worte wie abstrus geläufig aussprechen und sich
erklären können.
Vielleicht gab es davon sogar noch mehrere
Möglichkeiten der Abwandlung? Das Haupt-
wort „Abstrusität" etwa? Oder „Abstrusizität"?
Oder gar „Abstrusizibilität"?
Schreckliche Wortalben setzten sich lähmend auf
meinen Geist, und der Schweiß stand mir finger-
dick auf der Stirn.
Es war abstrus. Ach so, ich weiß ja gar nicht,
was das heißt. Es schien mir nur im Augen-
blick so passend hier.
Ungewohnt früh und zerschlagen erhob ich mich
am anderen Morgen und begab mich eilends zu
jemand, der einen Brockhaus besaß und infolge-
dessen sicherlich gebildet war.
Es gewährte mir erleichternden Trost, zu er-
fahren, daß auch er nichts über die Bedeutung
von „abstrus" auszusagen vermochte.
So griffen wir beiderseits wißbegierig zum
Brockhaus, um endlich Aufklärung zu erlangen
über dies sicherlich hochbedeutsame und un-
zweifelhaft durch nichts anderes zu ersetzende
„abstrus"--
Wissen Sie, was im Brockhaus steht, was „ab-
strus" auf Deutsch heißt:---Verworren!
Ganz einfach: „verworren"---
Und sehen Sie, nun, nachdem ich dies weiß, bin
ich fast noch unglücklicher als zuvor.
Denn: Wenn „abstrus" in unserer Sprache „ver-
worren" bedeutet, und der Dichter hätte das
gewußt, dann hätte er doch gewißlich auch „ver-
worren" geschrieben. Ich finde, „verworren" ist
ein ganz brauchbares und deutliches Wort. Oder
aber, „abstrus" heißt ni ch t „verworren", dann
ist der Brockhaus a u ch ungebildet und wer, um
Himmels willen, soll dann noch Hüter und
Schirmer unserer Bildung sein? Oder der Dichter
hat d o ch gewußt, daß „abstrus" das gleiche
besagt wie „verworren" und hat trotzdem „ab-
strus" vorgezogen, dann . . . Nein, hier komme
ich nicht mehr mit. Es ist mir zu abstrus!
Klaus Wolff
69
Werk/Gegenstand/Objekt
Pool: UB Der Simpl
Titel
Titel/Objekt
"Bevorzugte Klasse"
Weitere Titel/Paralleltitel
Serientitel
Der Simpl: Kunst - Karikatur - Kritik
Sachbegriff/Objekttyp
Inschrift/Wasserzeichen
Aufbewahrung/Standort
Aufbewahrungsort/Standort (GND)
Inv. Nr./Signatur
G 5442-11-5 Folio RES
Objektbeschreibung
Maß-/Formatangaben
Auflage/Druckzustand
Werktitel/Werkverzeichnis
Herstellung/Entstehung
Künstler/Urheber/Hersteller (GND)
Entstehungsort (GND)
Auftrag
Publikation
Fund/Ausgrabung
Provenienz
Restaurierung
Sammlung Eingang
Ausstellung
Bearbeitung/Umgestaltung
Thema/Bildinhalt
Thema/Bildinhalt (GND)
Literaturangabe
Rechte am Objekt
Aufnahmen/Reproduktionen
Künstler/Urheber (GND)
Reproduktionstyp
Digitales Bild
Rechtsstatus
In Copyright (InC) / Urheberrechtsschutz
Creditline
Der Simpl, 1.1946, Nr. 6, S. 69.
Beziehungen
Erschließung
Lizenz
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Rechteinhaber
Universitätsbibliothek Heidelberg