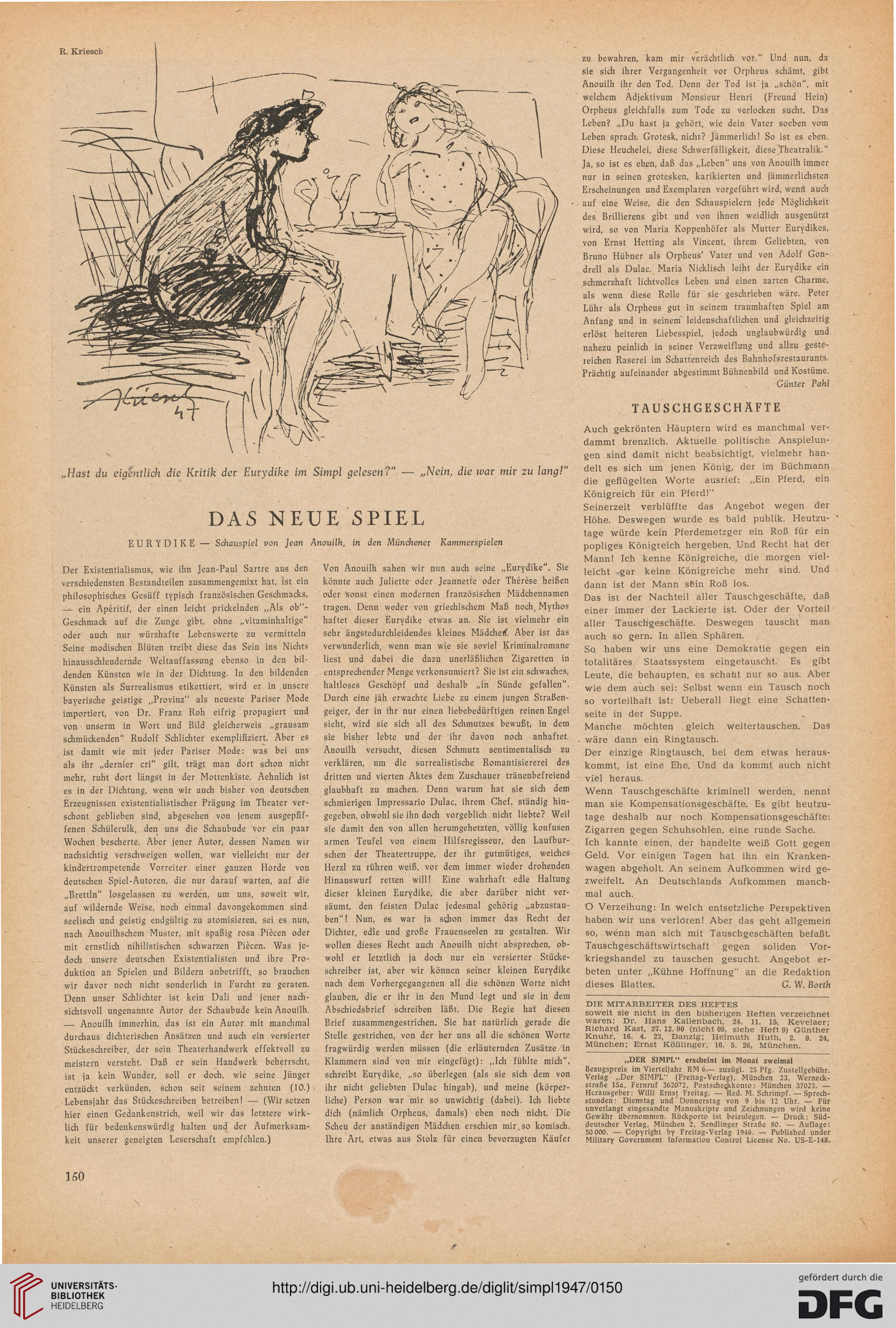R. Kriescb
,Hast du eigentlich die Kritik der Eurydike im Simpl gelesen?" — „Nein, die war mir zu lang!"
DAS NEUE SPIEL
EURYDIKE — Schauspiel von Jean Anouilh, in den Münchener Kammerspielen
Der Existentialismus, wie ihn Jean-Paul Sartre aus den
verschiedensten Bestandteilen zusammengemixt hat, ist ein
philosophisches Gesüff typisch französischen Geschmacks,
—>- ein Aperitif, der einen leicht prickelnden „Als ob"-
Geschmack auf die Zunge gibt, ohne „vitaminhaltige"
oder auch nur würzhafte Lebenswerte zu vermitteln
Seine modischen Blüten treibt diese das Sein ins Nichts
hinausschleudernde Weltauffassung ebenso in den bil-
denden Künsten wie in der Dichtung. In den bildenden
Künsten als Surrealismus etikettiert, wird er in unsere
bayerische geistige ,,Provinz" als neueste Pariser Mode
importiert, von Dr. Franz Roh eifrig propagiert und
von unserm in Wort und Bild gleicherwcis „grausam
schmückenden" Rudolf Schlichter exemplifiziert. Aber es
ist damit wie mit jeder Pariser Mode: was bei uns
als ihr „dernier cri" gilt, trägt man dort schon nicht
mehr, ruht dort längst in der Mottenkiste. Aehnlich ist
es in der Dichtung, wenn wir auch bisher von deutschen
Erzeugnissen existentialistischer Prägung im Theater ver-
schont geblieben sind, abgesehen von jenem ausgepfif-
fenen Schülerulk, den uns die Schaubude vor ein paar
Wochen bescherte. Aber jener Autor, dessen Namen wir
nachsichtig verschweigen wollen, war vielleicht nur der
kind'ertrompetcnde Vorreiter einer ganzen Horde von
deutschen Spiel-Autoren, die nur darauf warten, auf die
„Brettln" losgelassen zu werden, um uns, soweit wir,
auf wildernde Weise, noch einmal davongekommen sind,
seelisch und geistig endgültig zu atomisieren, sei es nun,
nach Anouilhschcm Muster, mit spaßig rosa Piecen oder
mit ernstlich nihilistischen schwarzen Piecen. Was je-
doch unsere deutschen Existcntialisten und ihre Pro-
duktion an Spielen und Bildern anbetrifft, so brauchen
wir davor noch nicht sonderlich in Furcht zu geraten.
Denn unser Schlichter ist kein Dali und jener nach-
sichtsvoll ungenannte Autor der Schaubude kein Anouilh.
— Anouilh immerhin, das ist ein Autor mit manchmal
durchaus dichterischen Ansätzen und auch ein versierter
Stückeschreiber, der sein Theaterhandwerk effektvoll zu
meistern versteht. Daß er sein Handwerk beherrscht,
ist ja kein Wunder, soll er doch, wie seine Jünger
entzückt verkünden, schon seit seinem zehnten (10.)
Lebensjahr das Stückeschreiben betreiben! — (Wir setzen
hier einen Gedankenstrich, weil wir das letztere wirk-
lich für bedenkenswürdig halten und der Aufmerksam-
keit unserer geneigten Leserschaft empfehlen.)
Von Anouilh sahen wir nun auch seine „Eurydike". Sie
könnte auch Juliette oder Jeannette oder Therese heißen
oder sonst einen modernen französischen Mädchennamen
tragen. Denn weder von griechischem Maß noch, Mythos
haftet dieser Eurydike etwas an. Sie ist vielmehr ein
sehr ängstcdurchleidendes kleines Mädcherf. Aber ist das
verwunderlich, wenn man wie sie soviel Kriminalromane
liest und dabei die dazu unerläßlichen Zigaretten in
entsprechender Menge verkonsumiert? Sie ist ein schwaches,
haltloses Geschöpf und deshalb „in Sünde gefallen".
Durch eine jäh erwachte Liebe zu einem jungen Straßen-
geiger, der in ihr nur einen liebebedürftigen reinen Engel
sieht, wird sie sich all des Schmutzes bewußt, in dem
sie bisher lebte und der ihr davon noch anhaftet.
Anouilh versucht, diesen Schmutz sentimentalisch zu
verklären, um die surrealistische Romantisiererei des
dritten und vierten Aktes dem Zuschauer tränenbefreiend
glaubhaft zu machen. Denn warum hat sie sich dem
schmierigen Impressario Dulac, ihrem Chef, ständig hin-
gegeben, obwohl sie ihn doch vorgeblich nicht liebte? Weil
sie damit den von allen herumgehetzten, völlig konfusen
armen Teufel von einem Hilfsregisseur, den Laufbur-
schen der Theatertruppe, der ihr gutmütiges, weiches
Herzl zu rühren weiß, vor dem immer wieder drohenden
Hinauswurf retten will! Eine wahrhaft edle Haltung
dieser kleinen Eurydike, die aber darüber nicht ver-
säumt, den feisten Dulac jedesmal gehörig „abzustau-
ben"! Nun, es war ja schon immer das Recht der
Dichter, edle und große Frauenseelen zu gestalten. Wir
wollen dieses Recht auch Anouilh nicht absprechen, ob-
wohl er letztlich ja doch nur ein versierter Stücke-
schreiber ist, aber wir können seiner kleinen Eurydike
nach dem Vorhergegangenen all die schönen Worte nicht
glauben, die er ihr in den Mund legt und sie in dem
Abschiedsbrief schreiben läßt. Die Regie hat diesen
Brief zusammengestrichen. Sie hat natürlich gerade die
Stelle gestrichen, von der her uns all die schönen Worte
fragwürdig werden müssen (die erläuternden Zusätze in
Klammern sind von mir eingefügt): „Ich fühlte mich",
schreibt Eurydike, „so überlegen (als sie sich dem von
ihr nicht geliebten Dulac hingab), und meine (körper-
liche) Person war mir so unwichtig (dabei). Ich liebte
dich (nämlich Orpheus, damals) eben noch nicht. Die
Scheu der anständigen Mädchen erschien mir.so komisch.
Ihre Art, etwas aus Stolz für einen bevorzugten Käufer
zu bewahren, kam mir verächtlich vor." Und nun, da
sie sich ihrer Vergangenheit vor Orpheus schämt, gibt
Anouilh ihr den Tod. Denn der Tod ist ja „schön", mit
welchem Adjektivum Monsieur Henri (Freund Hein)
Orpheus gleichfalls zum Tode zu verlocken sucht. Das
Leben? „Du hast ja gehört, wie dein Vater soeben vom
Leben sprach. Grotesk, nicht? Jämmerlich! So ist es eben.
Diese Heuchelei, diese Schwerfälligkeit, diese.Theatralik."
Ja, so ist es eben, daß das „Leben" uns von Anouilh immer
nur in seinen grotesken, karikierten und jämmerlichsten
Erscheinungen und Exemplaren vorgeführt wird, wenrt auch
auf eine Weise, die den Schauspielern jede Möglichkeit
des Brillierens gibt und von ihnen weidlich ausgenützt
wird, so von Maria Koppcnhöfcr als Mutter Eurydikes,
von Ernst Hetting als Vincent, ihrem Geliebten, von
Bruno Hübner als Orpheus' Vater und von Adolf Gon-
drell als Dulac. Maria Nicklisch leiht der Eurydike ein
schmerzhaft lichtvolles Leben und einen zarten Charme,
als wenn diese Rolle für sie geschrieben wäre. Peter
Lühr als Orpheus gut in seinem traumhaften Spiel am
Anfang und in seinem leidenschaftlichen und gleichzeitig
erlöst heiteren Liebesspiel, jedoch unglaubwürdig und
nahezu peinlich in seiner Verzweiflung und allzu geste-
reichen Raserei im Schattenreich des Bahnhofsrestaurants.
Prächtig aufeinander abgestimmt Bühnenbild und Kostüme.
Günter Pähl
TAUSCHGESCHÄFTE
Auch gekrönten Häuptern wird es manchmal ver-
dammt brenzlich. Aktuelle politische Anspielun-
gen sind damit nicht beabsichtigt, vielmehr han-
delt es sich um jenen König, der im Büchmann
die geflügelten Worte ausrief: „Ein Pferd, ein
Königreich für ein Pferd!"
Seinerzeit verblüffte das Angebot wegen der
Höhe. Deswegen wurde es bald publik. Heutzu-
tage würde kein Pferdemetzger ein Roß für ein
popliges Königreich hergeben. Und Recht hat der
Mann! Ich kenne Königreiche, die morgen viel-
leicht -gar keine Königreiche mehr sind. Und
dann ist der Mann sein Roß los.
Das ist der Nachteil aller Tauschgeschäfte, daß
einer immer der Lackierte ist. Oder der Vorteil
aller Tauschgeschäfte. Deswegen tauscht man
auch so gern. In allen Sphären.
So haben wir uns eine Demokratie gegen ein
totalitäres Staatssystem eingetauscht. Es gibt
Leute, die behaupten, es schaut nur so aus. Aber
wie dem auch sei: Selbst wenn ein Tausch noch
so vorteilhaft ist: Ueberall liegt eine Schatten-
seite in der Suppe.
Manche möchten gleich weitertauschen. Das
wäre dann ein Ringtausch.
Der einzige Ringtausch, bei dem etwas heraus-
kommt, ist eine Ehe. Und da kommt auch nicht
viel heraus.
Wenn Tauschgeschäfte kriminell werden, nennt
man sie Kompensationsgeschäfte. Es gibt heutzu-
tage deshalb nur noch Kompensationsgeschäfte:
Zigarren gegen Schuhsohlen, eine runde Sache.
Ich kannte einen, der handelte weiß Gott gegen
Geld. Vor einigen Tagen hat ihn ein Kranken-
wagen abgeholt. An seinem Aufkommen wird ge-
zweifelt. An Deutschlands Aufkommen manch-
mal auch.
O Verzeihung: In welch entsetzliche Perspektiven
haben wir uns verloren! Aber das geht allgemein
so, wenn man sich mit Tauschgeschäften befaßt.
Tauschgeschäftswirtschaft gegen soliden Vor-
kriegshandel zu tauschen gesucht. Angebot er-
beten unter „Kühne Hoffnung" an die Redaktion
dieses Blattes. G. W. Borth
DIE MITARBEITER DES HEFTES
soweit sie nicht in den bisherigen Heften verzeichnet
waren: Dr. Hans Kallenbach, 24. 11. 15-, Kevelaer-
Richard Kast, 27. 12. 90 (nicht 09, siehe Heft 9) Günther
Knuhr, 16. 4. 23, Danzig; Helmuth Huth, 2. 9 24
München; Ernst Kößlinger, 16. 5. 26, München.
„DER SIMPL" erscheint im Monat zweimal
Bezugspreis im Vierteljahr RM 6.— zuzügl. 25 Pfg. Zustellgebühr.
Verlag „Der SIMPL" (Freitag-Verlag), München 23, Wcrneck-
straße 15a, Fernruf 3620'2, Postscheckkonto: München 37023. —
Herausgeber: Willi Ernst Freitag. — Red. M. Schrimpf. — Sprech-
stunden: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. — Für
unverlangt eingesandte Manuskripte und Zeichnungen wird keine
Gewähr übernommen. Rückporto ist beizulegen. — Druck: Süd-
deutscher Verlag, Mündien 2. Sendlinger Straße 80. — Auflage:
50 000. — Copyright by Freitag-Verlag 1946. — Publishcd under
Military Government Information Control License No. US-E-148.
150
,Hast du eigentlich die Kritik der Eurydike im Simpl gelesen?" — „Nein, die war mir zu lang!"
DAS NEUE SPIEL
EURYDIKE — Schauspiel von Jean Anouilh, in den Münchener Kammerspielen
Der Existentialismus, wie ihn Jean-Paul Sartre aus den
verschiedensten Bestandteilen zusammengemixt hat, ist ein
philosophisches Gesüff typisch französischen Geschmacks,
—>- ein Aperitif, der einen leicht prickelnden „Als ob"-
Geschmack auf die Zunge gibt, ohne „vitaminhaltige"
oder auch nur würzhafte Lebenswerte zu vermitteln
Seine modischen Blüten treibt diese das Sein ins Nichts
hinausschleudernde Weltauffassung ebenso in den bil-
denden Künsten wie in der Dichtung. In den bildenden
Künsten als Surrealismus etikettiert, wird er in unsere
bayerische geistige ,,Provinz" als neueste Pariser Mode
importiert, von Dr. Franz Roh eifrig propagiert und
von unserm in Wort und Bild gleicherwcis „grausam
schmückenden" Rudolf Schlichter exemplifiziert. Aber es
ist damit wie mit jeder Pariser Mode: was bei uns
als ihr „dernier cri" gilt, trägt man dort schon nicht
mehr, ruht dort längst in der Mottenkiste. Aehnlich ist
es in der Dichtung, wenn wir auch bisher von deutschen
Erzeugnissen existentialistischer Prägung im Theater ver-
schont geblieben sind, abgesehen von jenem ausgepfif-
fenen Schülerulk, den uns die Schaubude vor ein paar
Wochen bescherte. Aber jener Autor, dessen Namen wir
nachsichtig verschweigen wollen, war vielleicht nur der
kind'ertrompetcnde Vorreiter einer ganzen Horde von
deutschen Spiel-Autoren, die nur darauf warten, auf die
„Brettln" losgelassen zu werden, um uns, soweit wir,
auf wildernde Weise, noch einmal davongekommen sind,
seelisch und geistig endgültig zu atomisieren, sei es nun,
nach Anouilhschcm Muster, mit spaßig rosa Piecen oder
mit ernstlich nihilistischen schwarzen Piecen. Was je-
doch unsere deutschen Existcntialisten und ihre Pro-
duktion an Spielen und Bildern anbetrifft, so brauchen
wir davor noch nicht sonderlich in Furcht zu geraten.
Denn unser Schlichter ist kein Dali und jener nach-
sichtsvoll ungenannte Autor der Schaubude kein Anouilh.
— Anouilh immerhin, das ist ein Autor mit manchmal
durchaus dichterischen Ansätzen und auch ein versierter
Stückeschreiber, der sein Theaterhandwerk effektvoll zu
meistern versteht. Daß er sein Handwerk beherrscht,
ist ja kein Wunder, soll er doch, wie seine Jünger
entzückt verkünden, schon seit seinem zehnten (10.)
Lebensjahr das Stückeschreiben betreiben! — (Wir setzen
hier einen Gedankenstrich, weil wir das letztere wirk-
lich für bedenkenswürdig halten und der Aufmerksam-
keit unserer geneigten Leserschaft empfehlen.)
Von Anouilh sahen wir nun auch seine „Eurydike". Sie
könnte auch Juliette oder Jeannette oder Therese heißen
oder sonst einen modernen französischen Mädchennamen
tragen. Denn weder von griechischem Maß noch, Mythos
haftet dieser Eurydike etwas an. Sie ist vielmehr ein
sehr ängstcdurchleidendes kleines Mädcherf. Aber ist das
verwunderlich, wenn man wie sie soviel Kriminalromane
liest und dabei die dazu unerläßlichen Zigaretten in
entsprechender Menge verkonsumiert? Sie ist ein schwaches,
haltloses Geschöpf und deshalb „in Sünde gefallen".
Durch eine jäh erwachte Liebe zu einem jungen Straßen-
geiger, der in ihr nur einen liebebedürftigen reinen Engel
sieht, wird sie sich all des Schmutzes bewußt, in dem
sie bisher lebte und der ihr davon noch anhaftet.
Anouilh versucht, diesen Schmutz sentimentalisch zu
verklären, um die surrealistische Romantisiererei des
dritten und vierten Aktes dem Zuschauer tränenbefreiend
glaubhaft zu machen. Denn warum hat sie sich dem
schmierigen Impressario Dulac, ihrem Chef, ständig hin-
gegeben, obwohl sie ihn doch vorgeblich nicht liebte? Weil
sie damit den von allen herumgehetzten, völlig konfusen
armen Teufel von einem Hilfsregisseur, den Laufbur-
schen der Theatertruppe, der ihr gutmütiges, weiches
Herzl zu rühren weiß, vor dem immer wieder drohenden
Hinauswurf retten will! Eine wahrhaft edle Haltung
dieser kleinen Eurydike, die aber darüber nicht ver-
säumt, den feisten Dulac jedesmal gehörig „abzustau-
ben"! Nun, es war ja schon immer das Recht der
Dichter, edle und große Frauenseelen zu gestalten. Wir
wollen dieses Recht auch Anouilh nicht absprechen, ob-
wohl er letztlich ja doch nur ein versierter Stücke-
schreiber ist, aber wir können seiner kleinen Eurydike
nach dem Vorhergegangenen all die schönen Worte nicht
glauben, die er ihr in den Mund legt und sie in dem
Abschiedsbrief schreiben läßt. Die Regie hat diesen
Brief zusammengestrichen. Sie hat natürlich gerade die
Stelle gestrichen, von der her uns all die schönen Worte
fragwürdig werden müssen (die erläuternden Zusätze in
Klammern sind von mir eingefügt): „Ich fühlte mich",
schreibt Eurydike, „so überlegen (als sie sich dem von
ihr nicht geliebten Dulac hingab), und meine (körper-
liche) Person war mir so unwichtig (dabei). Ich liebte
dich (nämlich Orpheus, damals) eben noch nicht. Die
Scheu der anständigen Mädchen erschien mir.so komisch.
Ihre Art, etwas aus Stolz für einen bevorzugten Käufer
zu bewahren, kam mir verächtlich vor." Und nun, da
sie sich ihrer Vergangenheit vor Orpheus schämt, gibt
Anouilh ihr den Tod. Denn der Tod ist ja „schön", mit
welchem Adjektivum Monsieur Henri (Freund Hein)
Orpheus gleichfalls zum Tode zu verlocken sucht. Das
Leben? „Du hast ja gehört, wie dein Vater soeben vom
Leben sprach. Grotesk, nicht? Jämmerlich! So ist es eben.
Diese Heuchelei, diese Schwerfälligkeit, diese.Theatralik."
Ja, so ist es eben, daß das „Leben" uns von Anouilh immer
nur in seinen grotesken, karikierten und jämmerlichsten
Erscheinungen und Exemplaren vorgeführt wird, wenrt auch
auf eine Weise, die den Schauspielern jede Möglichkeit
des Brillierens gibt und von ihnen weidlich ausgenützt
wird, so von Maria Koppcnhöfcr als Mutter Eurydikes,
von Ernst Hetting als Vincent, ihrem Geliebten, von
Bruno Hübner als Orpheus' Vater und von Adolf Gon-
drell als Dulac. Maria Nicklisch leiht der Eurydike ein
schmerzhaft lichtvolles Leben und einen zarten Charme,
als wenn diese Rolle für sie geschrieben wäre. Peter
Lühr als Orpheus gut in seinem traumhaften Spiel am
Anfang und in seinem leidenschaftlichen und gleichzeitig
erlöst heiteren Liebesspiel, jedoch unglaubwürdig und
nahezu peinlich in seiner Verzweiflung und allzu geste-
reichen Raserei im Schattenreich des Bahnhofsrestaurants.
Prächtig aufeinander abgestimmt Bühnenbild und Kostüme.
Günter Pähl
TAUSCHGESCHÄFTE
Auch gekrönten Häuptern wird es manchmal ver-
dammt brenzlich. Aktuelle politische Anspielun-
gen sind damit nicht beabsichtigt, vielmehr han-
delt es sich um jenen König, der im Büchmann
die geflügelten Worte ausrief: „Ein Pferd, ein
Königreich für ein Pferd!"
Seinerzeit verblüffte das Angebot wegen der
Höhe. Deswegen wurde es bald publik. Heutzu-
tage würde kein Pferdemetzger ein Roß für ein
popliges Königreich hergeben. Und Recht hat der
Mann! Ich kenne Königreiche, die morgen viel-
leicht -gar keine Königreiche mehr sind. Und
dann ist der Mann sein Roß los.
Das ist der Nachteil aller Tauschgeschäfte, daß
einer immer der Lackierte ist. Oder der Vorteil
aller Tauschgeschäfte. Deswegen tauscht man
auch so gern. In allen Sphären.
So haben wir uns eine Demokratie gegen ein
totalitäres Staatssystem eingetauscht. Es gibt
Leute, die behaupten, es schaut nur so aus. Aber
wie dem auch sei: Selbst wenn ein Tausch noch
so vorteilhaft ist: Ueberall liegt eine Schatten-
seite in der Suppe.
Manche möchten gleich weitertauschen. Das
wäre dann ein Ringtausch.
Der einzige Ringtausch, bei dem etwas heraus-
kommt, ist eine Ehe. Und da kommt auch nicht
viel heraus.
Wenn Tauschgeschäfte kriminell werden, nennt
man sie Kompensationsgeschäfte. Es gibt heutzu-
tage deshalb nur noch Kompensationsgeschäfte:
Zigarren gegen Schuhsohlen, eine runde Sache.
Ich kannte einen, der handelte weiß Gott gegen
Geld. Vor einigen Tagen hat ihn ein Kranken-
wagen abgeholt. An seinem Aufkommen wird ge-
zweifelt. An Deutschlands Aufkommen manch-
mal auch.
O Verzeihung: In welch entsetzliche Perspektiven
haben wir uns verloren! Aber das geht allgemein
so, wenn man sich mit Tauschgeschäften befaßt.
Tauschgeschäftswirtschaft gegen soliden Vor-
kriegshandel zu tauschen gesucht. Angebot er-
beten unter „Kühne Hoffnung" an die Redaktion
dieses Blattes. G. W. Borth
DIE MITARBEITER DES HEFTES
soweit sie nicht in den bisherigen Heften verzeichnet
waren: Dr. Hans Kallenbach, 24. 11. 15-, Kevelaer-
Richard Kast, 27. 12. 90 (nicht 09, siehe Heft 9) Günther
Knuhr, 16. 4. 23, Danzig; Helmuth Huth, 2. 9 24
München; Ernst Kößlinger, 16. 5. 26, München.
„DER SIMPL" erscheint im Monat zweimal
Bezugspreis im Vierteljahr RM 6.— zuzügl. 25 Pfg. Zustellgebühr.
Verlag „Der SIMPL" (Freitag-Verlag), München 23, Wcrneck-
straße 15a, Fernruf 3620'2, Postscheckkonto: München 37023. —
Herausgeber: Willi Ernst Freitag. — Red. M. Schrimpf. — Sprech-
stunden: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. — Für
unverlangt eingesandte Manuskripte und Zeichnungen wird keine
Gewähr übernommen. Rückporto ist beizulegen. — Druck: Süd-
deutscher Verlag, Mündien 2. Sendlinger Straße 80. — Auflage:
50 000. — Copyright by Freitag-Verlag 1946. — Publishcd under
Military Government Information Control License No. US-E-148.
150
Werk/Gegenstand/Objekt
Pool: UB Der Simpl
Titel
Titel/Objekt
"Das neue Spiel"
Weitere Titel/Paralleltitel
Serientitel
Der Simpl: Kunst - Karikatur - Kritik
Sachbegriff/Objekttyp
Inschrift/Wasserzeichen
Aufbewahrung/Standort
Aufbewahrungsort/Standort (GND)
Inv. Nr./Signatur
G 5442-11-5 Folio RES
Objektbeschreibung
Maß-/Formatangaben
Auflage/Druckzustand
Werktitel/Werkverzeichnis
Herstellung/Entstehung
Künstler/Urheber/Hersteller (GND)
Entstehungsdatum
um 1947
Entstehungsdatum (normiert)
1942 - 1952
Entstehungsort (GND)
Auftrag
Publikation
Fund/Ausgrabung
Provenienz
Restaurierung
Sammlung Eingang
Ausstellung
Bearbeitung/Umgestaltung
Thema/Bildinhalt
Thema/Bildinhalt (GND)
Literaturangabe
Rechte am Objekt
Aufnahmen/Reproduktionen
Künstler/Urheber (GND)
Reproduktionstyp
Digitales Bild
Rechtsstatus
In Copyright (InC) / Urheberrechtsschutz
Creditline
Der Simpl, 2.1947, Nr. 12, S. 150.
Beziehungen
Erschließung
Lizenz
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Rechteinhaber
Universitätsbibliothek Heidelberg