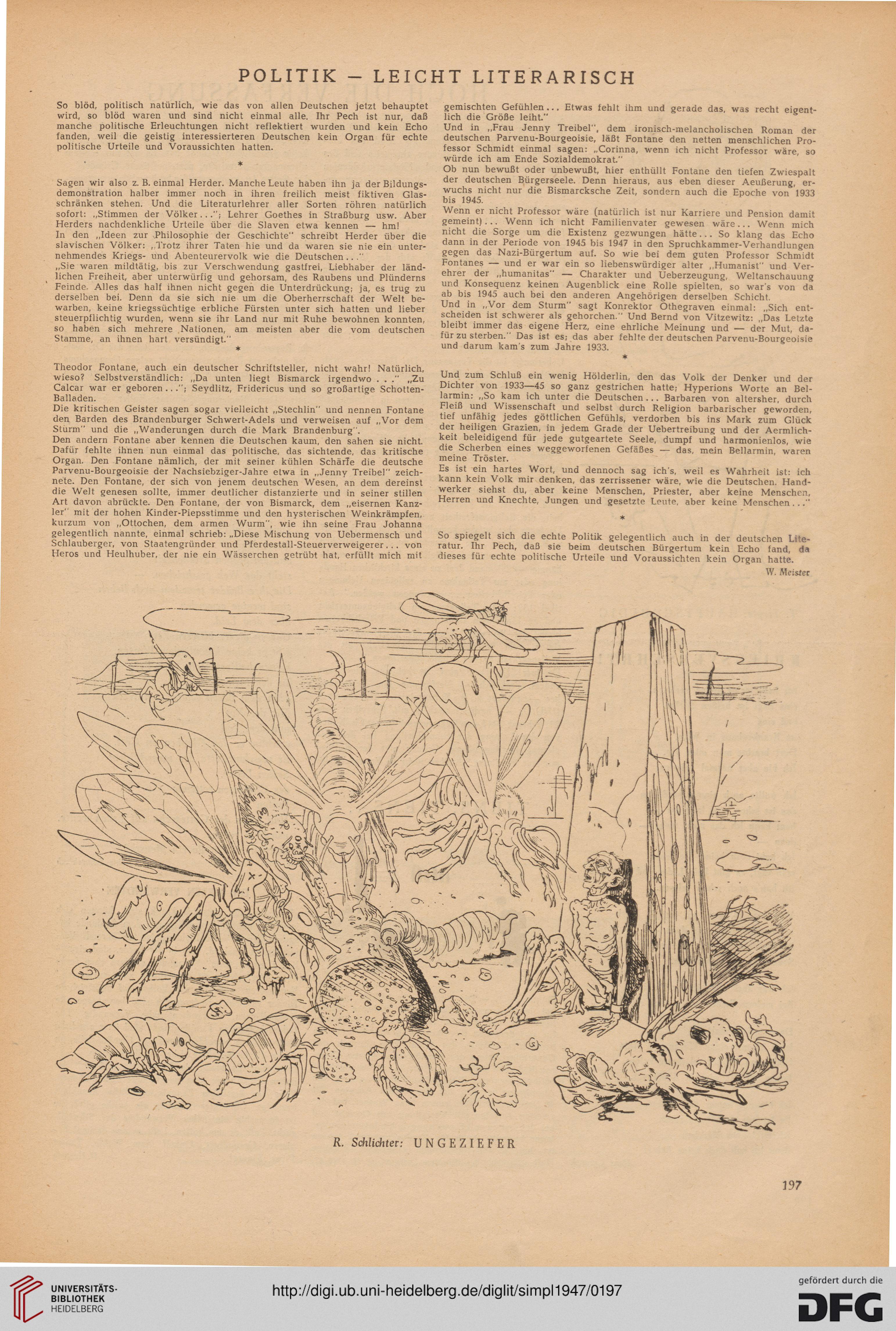POLITIK
- LEICHT LITERARISCH
So blöd, politisch natürlich, wie das von allen Deutschen jetzt behauptet
wird, so blöd waren und sind nicht einmal alle. Ihr Pech ist nur, daß
manche politische Erleuchtungen nicht reflektiert wurden und kein Echo
fanden, weil die geistig interessierteren Deutschen kein Organ für echte
politische Urteile und Voraussichten hatten.
*
Sagen wir also z. B. einmal Herder. Manche Leute haben ihn ja der Bildungs-
demonstration halber immer noch in ihren freilich meist fiktiven Glas-
schränken stehen. Und die Literaturlehrer aller Sorten röhren natürlich
sofort: .,Stimmen der Völker..."; Lehrer Goethes in Straßburg usw. Aber
Herders nachdenkliche Urteile über die Slaven etwa kennen — hm!
In den „Ideen zur Philosophie der Geschichte" schreibt Herder über die
slavischen Völker: . Trotz ihrer Taten hie und da waren sie nie ein unter-
nehmendes Kriegs- und Abenteurervolk wie die Deutschen..."
„Sie waren mildtätig, bis zur Verschwendung gastfrei, Liebhaber der länd-
lichen Freiheit, aber unterwürfig und gehorsam, des Raubens und Plünderns
Feinde. Alles das half ihnen nicht gegen die Unterdrückung; ja, es trug zu
derselben bei. Denn da sie sich nie um die Oberherrschaft der Welt be-
warben, keine kriegssüchtige erbliche Fürsten unter sich hatten und lieber
steuerpflichtig wurden, wenn sie ihr Land nur mit Ruhe bewohnen konnten,
so haben sich mehrere Nationen, am meisten aber die vom deutschen
Stamme, an ihnen hart versündigt."
*
Theodor Fontane, auch ein deutscher Schriftsteller, nicht wahr! Natürlich,
wieso? Selbstverständlich: „Da unten liegt Bismarck irgendwo . . ." „Zu
Calcar war er geboren..."; Seydlitz, Fridericus und so großartige Schotten-
Balladen.
Die kritischen Geister sagen sogar vielleicht „Stechlin" und nennen Fontane
den Barden des Brandenburger Schwert-Adels und verweisen auf „Vor dem
Sturm" und die „Wanderungen durch die Mark Brandenburg".
Den andern Fontane aber kennen die Deutschen kaum, den sahen sie nicht.
Dafür fehlte ihnen nun einmal das politische, das sichtende, das kritische
Organ. Den Fontane nämlich, der mit seiner kühlen Schärfe die deutsche
Parvenu-Bourgeoisie der Nachsiebziger-Jahre etwa in „Jenny Treibe!" zeich-
nete. Den Fontane, der sich von jenem deutschen Wesen, an dem dereinst
die Welt genesen sollte, immer deutlicher distanzierte und in seiner stillen
Art davon abrückte. Den Fontane, der von Bismarck, dem „eisernen Kanz-
ler" mit der hohen Kinder-Piepsstimme und den hysterischen Weinkrämpfen,
kurzum von „Ottochen, dem armen Wurm", wie ihn seine Frau Johanna
gelegentlich nannte, einmal schrieb: „Diese Mischung von Uebermensch und
Schlauberger, von Staatengründer und Pferdestall-Steuerverweigerer, . . von
Heros und Heulhuber, der nie ein Wässerchen getrübt hat, erfüllt mich mit
gemischten Gefühlen... Etwas fehlt ihm und gerade das, was recht eigent-
lich die Größe leiht."
Und in „Frau Jenny Treibel", dem ironisch-melancholischen Roman der
deutschen Parvenu-Bourgeoisie, läßt Fontane den netten menschlichen Pro-
fessor Schmidt einmal sagen: „Corinna, wenn ich nicht Professor wäre, so
würde ich am Ende Sozialdemokrat."
Ob nun bewußt oder unbewußt, hier enthüllt Fontane den tiefen Zwiespalt
der deutschen Bürgerseele. Denn hieraus, aus eben dieser Aeußerung, er-
wuchs nicht nur die Bismarcksche Zeit, sondern auch die Epoche von 1933
bis 1945.
Wenn er nicht Professor wäre (natürlich ist nur Karriere und Pension damit
gemeint) . .. Wenn ich nicht Familienvater gewesen wäre . .. Wenn mich
nicht die Sorge um die Existenz gezwungen hätte... So klang das Echo
dann in der Periode von 1945 bis 1947 in den Spruchkammer-Verhandlungen
gegen das Nazi-Bürgertum auf. So wie bei dem guten Professor Schmidt
Fontanes — und er war ein so liebenswürdiger alter „Humanist" und Ver-
ehrer der „humanitas" — Charakter und Ueberzeugung, Weltanschauung
und Konsequenz keinen Augenblick eine Rolle spielten, so war's von da
ab bis 1945 auch bei den anderen Angehörigen derselben Schicht.
Und in „Vor dem Sturm" sagt Konrektor Othegraven einmal: „Sich ent-
scheiden ist schwerer als gehorchen." Und Bernd von Vitzewitz: „Das Letzte
bleibt immer das eigene Herz, eine ehrliche Meinung und — der Mut, da-
für zu sterben." Das ist es; das aber fehlte der deutschen Parvenu-Bourgeoisie
und darum kam's zum Jahre 1933.
*
Und zum Schluß ein wenig Hölderlin, den das Volk der Denker und der
Dichter von 1933—45 so ganz gestrichen hatte,- Hyperions Worte an Bel-
larmin: „So kam ich unter die Deutschen... Barbaren von altersher, durch
Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden,
tief unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück
der heiligen Grazien, in jedem Grade der Uebertreibung und der Aermlich-
keit beleidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonienlos, wie
die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes — das, mein Bellarmin, waren
meine Tröster.
Es ist ein hartes Wort, und dennoch sag ich's, weil es Wahrheit ist: ich
kann kein Volk mir denken, das zerrissener wäre, wie die Deutschen. Hand-
werker siehst du, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen,
Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen . . ."
So spiegelt sich die echte Politik gelegentlich auch in der deutschen Lite-
ratur. Ihr Pech, daß sie beim deutschen Bürgertum kein Echo fand, da
dieses für echte politische Urteile und Voraussichten kein Organ hatte.
W. Meister
R. Schliditev. UNGEZIEFER
197
- LEICHT LITERARISCH
So blöd, politisch natürlich, wie das von allen Deutschen jetzt behauptet
wird, so blöd waren und sind nicht einmal alle. Ihr Pech ist nur, daß
manche politische Erleuchtungen nicht reflektiert wurden und kein Echo
fanden, weil die geistig interessierteren Deutschen kein Organ für echte
politische Urteile und Voraussichten hatten.
*
Sagen wir also z. B. einmal Herder. Manche Leute haben ihn ja der Bildungs-
demonstration halber immer noch in ihren freilich meist fiktiven Glas-
schränken stehen. Und die Literaturlehrer aller Sorten röhren natürlich
sofort: .,Stimmen der Völker..."; Lehrer Goethes in Straßburg usw. Aber
Herders nachdenkliche Urteile über die Slaven etwa kennen — hm!
In den „Ideen zur Philosophie der Geschichte" schreibt Herder über die
slavischen Völker: . Trotz ihrer Taten hie und da waren sie nie ein unter-
nehmendes Kriegs- und Abenteurervolk wie die Deutschen..."
„Sie waren mildtätig, bis zur Verschwendung gastfrei, Liebhaber der länd-
lichen Freiheit, aber unterwürfig und gehorsam, des Raubens und Plünderns
Feinde. Alles das half ihnen nicht gegen die Unterdrückung; ja, es trug zu
derselben bei. Denn da sie sich nie um die Oberherrschaft der Welt be-
warben, keine kriegssüchtige erbliche Fürsten unter sich hatten und lieber
steuerpflichtig wurden, wenn sie ihr Land nur mit Ruhe bewohnen konnten,
so haben sich mehrere Nationen, am meisten aber die vom deutschen
Stamme, an ihnen hart versündigt."
*
Theodor Fontane, auch ein deutscher Schriftsteller, nicht wahr! Natürlich,
wieso? Selbstverständlich: „Da unten liegt Bismarck irgendwo . . ." „Zu
Calcar war er geboren..."; Seydlitz, Fridericus und so großartige Schotten-
Balladen.
Die kritischen Geister sagen sogar vielleicht „Stechlin" und nennen Fontane
den Barden des Brandenburger Schwert-Adels und verweisen auf „Vor dem
Sturm" und die „Wanderungen durch die Mark Brandenburg".
Den andern Fontane aber kennen die Deutschen kaum, den sahen sie nicht.
Dafür fehlte ihnen nun einmal das politische, das sichtende, das kritische
Organ. Den Fontane nämlich, der mit seiner kühlen Schärfe die deutsche
Parvenu-Bourgeoisie der Nachsiebziger-Jahre etwa in „Jenny Treibe!" zeich-
nete. Den Fontane, der sich von jenem deutschen Wesen, an dem dereinst
die Welt genesen sollte, immer deutlicher distanzierte und in seiner stillen
Art davon abrückte. Den Fontane, der von Bismarck, dem „eisernen Kanz-
ler" mit der hohen Kinder-Piepsstimme und den hysterischen Weinkrämpfen,
kurzum von „Ottochen, dem armen Wurm", wie ihn seine Frau Johanna
gelegentlich nannte, einmal schrieb: „Diese Mischung von Uebermensch und
Schlauberger, von Staatengründer und Pferdestall-Steuerverweigerer, . . von
Heros und Heulhuber, der nie ein Wässerchen getrübt hat, erfüllt mich mit
gemischten Gefühlen... Etwas fehlt ihm und gerade das, was recht eigent-
lich die Größe leiht."
Und in „Frau Jenny Treibel", dem ironisch-melancholischen Roman der
deutschen Parvenu-Bourgeoisie, läßt Fontane den netten menschlichen Pro-
fessor Schmidt einmal sagen: „Corinna, wenn ich nicht Professor wäre, so
würde ich am Ende Sozialdemokrat."
Ob nun bewußt oder unbewußt, hier enthüllt Fontane den tiefen Zwiespalt
der deutschen Bürgerseele. Denn hieraus, aus eben dieser Aeußerung, er-
wuchs nicht nur die Bismarcksche Zeit, sondern auch die Epoche von 1933
bis 1945.
Wenn er nicht Professor wäre (natürlich ist nur Karriere und Pension damit
gemeint) . .. Wenn ich nicht Familienvater gewesen wäre . .. Wenn mich
nicht die Sorge um die Existenz gezwungen hätte... So klang das Echo
dann in der Periode von 1945 bis 1947 in den Spruchkammer-Verhandlungen
gegen das Nazi-Bürgertum auf. So wie bei dem guten Professor Schmidt
Fontanes — und er war ein so liebenswürdiger alter „Humanist" und Ver-
ehrer der „humanitas" — Charakter und Ueberzeugung, Weltanschauung
und Konsequenz keinen Augenblick eine Rolle spielten, so war's von da
ab bis 1945 auch bei den anderen Angehörigen derselben Schicht.
Und in „Vor dem Sturm" sagt Konrektor Othegraven einmal: „Sich ent-
scheiden ist schwerer als gehorchen." Und Bernd von Vitzewitz: „Das Letzte
bleibt immer das eigene Herz, eine ehrliche Meinung und — der Mut, da-
für zu sterben." Das ist es; das aber fehlte der deutschen Parvenu-Bourgeoisie
und darum kam's zum Jahre 1933.
*
Und zum Schluß ein wenig Hölderlin, den das Volk der Denker und der
Dichter von 1933—45 so ganz gestrichen hatte,- Hyperions Worte an Bel-
larmin: „So kam ich unter die Deutschen... Barbaren von altersher, durch
Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden,
tief unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück
der heiligen Grazien, in jedem Grade der Uebertreibung und der Aermlich-
keit beleidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonienlos, wie
die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes — das, mein Bellarmin, waren
meine Tröster.
Es ist ein hartes Wort, und dennoch sag ich's, weil es Wahrheit ist: ich
kann kein Volk mir denken, das zerrissener wäre, wie die Deutschen. Hand-
werker siehst du, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen,
Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen . . ."
So spiegelt sich die echte Politik gelegentlich auch in der deutschen Lite-
ratur. Ihr Pech, daß sie beim deutschen Bürgertum kein Echo fand, da
dieses für echte politische Urteile und Voraussichten kein Organ hatte.
W. Meister
R. Schliditev. UNGEZIEFER
197
Werk/Gegenstand/Objekt
Pool: UB Der Simpl
Titel
Titel/Objekt
"Ungeziefer"
Weitere Titel/Paralleltitel
Serientitel
Der Simpl: Kunst - Karikatur - Kritik
Sachbegriff/Objekttyp
Inschrift/Wasserzeichen
Aufbewahrung/Standort
Aufbewahrungsort/Standort (GND)
Inv. Nr./Signatur
G 5442-11-5 Folio RES
Objektbeschreibung
Maß-/Formatangaben
Auflage/Druckzustand
Werktitel/Werkverzeichnis
Herstellung/Entstehung
Künstler/Urheber/Hersteller (GND)
Entstehungsdatum
um 1947
Entstehungsdatum (normiert)
1942 - 1952
Entstehungsort (GND)
Auftrag
Publikation
Fund/Ausgrabung
Provenienz
Restaurierung
Sammlung Eingang
Ausstellung
Bearbeitung/Umgestaltung
Thema/Bildinhalt
Thema/Bildinhalt (GND)
Literaturangabe
Rechte am Objekt
Aufnahmen/Reproduktionen
Künstler/Urheber (GND)
Reproduktionstyp
Digitales Bild
Rechtsstatus
In Copyright (InC) / Urheberrechtsschutz
Creditline
Der Simpl, 2.1947, Nr. 16, S. 197.
Beziehungen
Erschließung
Lizenz
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Rechteinhaber
Universitätsbibliothek Heidelberg