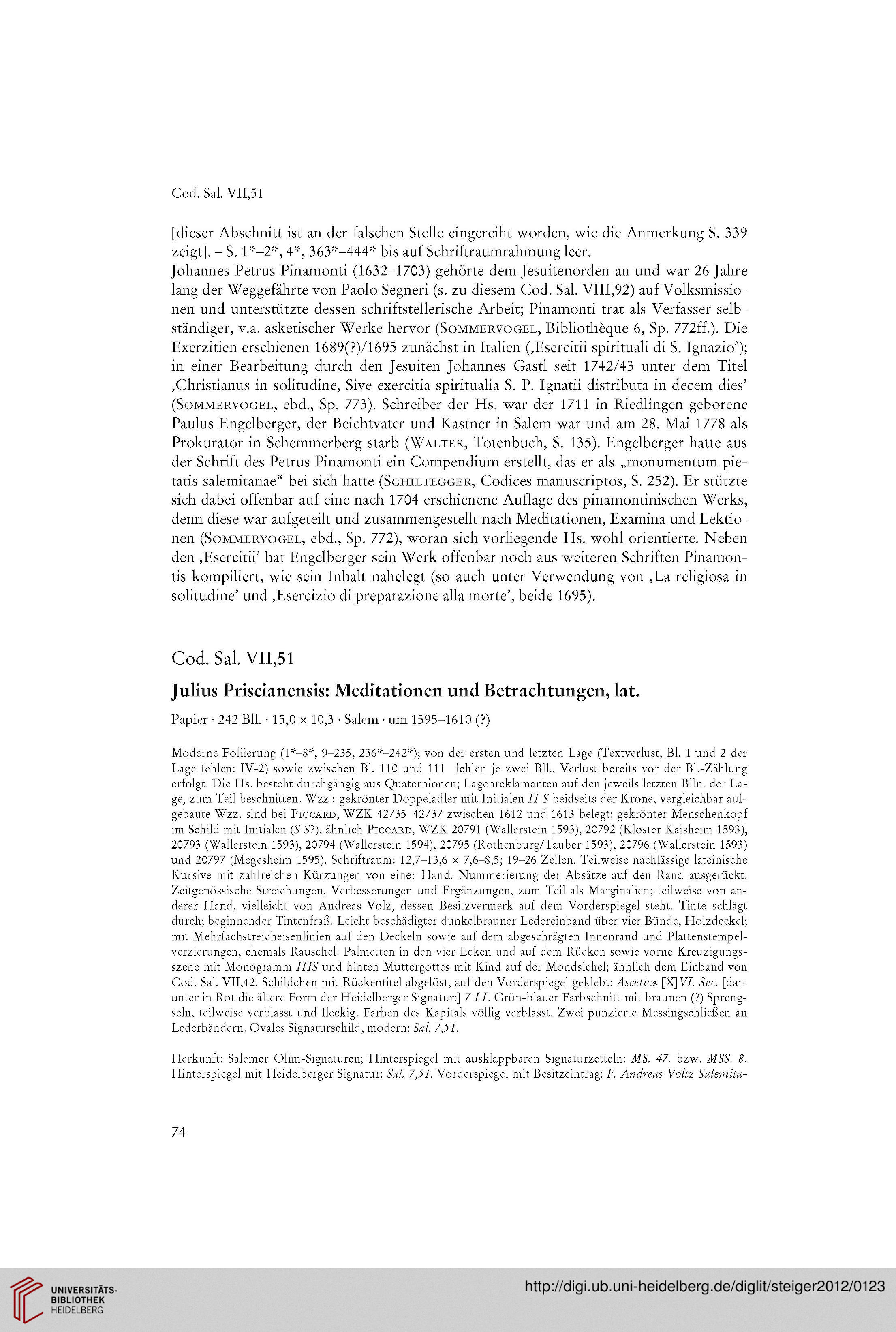Cod. Sal. VII,51
[dieser Abschnitt ist an der falschen Stelle eingereiht worden, wie die Anmerkung S. 339
zeigt]. - S. l*-2*, 4*, 363*—444* bis auf Schriftraumrahmung leer.
Johannes Petrus Pinamonti (1632-1703) gehörte dem Jesuitenorden an und war 26 Jahre
lang der Weggefährte von Paolo Segneri (s. zu diesem Cod. Sal. VIII,92) auf Volksmissio-
nen und unterstützte dessen schriftstellerische Arbeit; Pinamonti trat als Verfasser selb-
ständiger, v.a. asketischer Werke hervor (Sommervogel, Bibliotheque 6, Sp. 772ff.). Die
Exerzitien erschienen 1689(?)/1695 zunächst in Italien (,Esercitii spirituali di S. Ignazio’);
in einer Bearbeitung durch den Jesuiten Johannes Gastl seit 1742/43 unter dem Titel
,Christianus in solitudine, Sive exercitia spiritualia S. P. Ignatii distributa in decem dies’
(Sommervogel, ebd., Sp. 773). Schreiber der Hs. war der 1711 in Riedlingen geborene
Paulus Engelberger, der Beichtvater und Kästner in Salem war und am 28. Mai 1778 als
Prokurator in Schemmerberg starb (Walter, Totenbuch, S. 135). Engelberger hatte aus
der Schrift des Petrus Pinamonti ein Compendium erstellt, das er als „monumentum pie-
tatis salemitanae“ bei sich hatte (Schiltegger, Codices manuscriptos, S. 252). Er stützte
sich dabei offenbar auf eine nach 1704 erschienene Auflage des pinamontinischen Werks,
denn diese war aufgeteilt und zusammengestellt nach Meditationen, Examina und Lektio-
nen (Sommervogel, ebd., Sp. 772), woran sich vorliegende Hs. wohl orientierte. Neben
den ,Esercitii’ hat Engelberger sein Werk offenbar noch aus weiteren Schriften Pinamon-
tis kompiliert, wie sein Inhalt nahelegt (so auch unter Verwendung von ,La religiosa in
solitudine’ und ,Esercizio di preparazione alla morte’, beide 1695).
Cod. Sal. VII,51
Julius Priscianensis: Meditationen und Betrachtungen, lat.
Papier * 242 Bll. • 15,0 x 10,3 * Salem • um 1595-1610 (?)
Moderne Foliierung (1*—8*, 9-235, 236*—242*); von der ersten und letzten Lage (Textverlust, Bl. 1 und 2 der
Lage fehlen: IV-2) sowie zwischen Bl. 110 und 111 fehlen je zwei Bll., Verlust bereits vor der Bl.-Zählung
erfolgt. Die Hs. besteht durchgängig aus Quaternionen; Lagenreklamanten auf den jeweils letzten Blln. der La-
ge, zum Teil beschnitten. Wzz.: gekrönter Doppeladler mit Initialen H S beidseits der Krone, vergleichbar auf-
gebaute Wzz. sind bei Piccard, WZK 42735-42737 zwischen 1612 und 1613 belegt; gekrönter Menschenkopf
im Schild mit Initialen (S £?), ähnlich Piccard, WZK 20791 (Wallerstein 1593), 20792 (Kloster Kaisheim 1593),
20793 (Wallerstein 1593), 20794 (Wallerstein 1594), 20795 (Rothenburg/Tauber 1593), 20796 (Wallerstein 1593)
und 20797 (Megesheim 1595). Schriftraum: 12,7-13,6 x 7,6-8,5; 19-26 Zeilen. Teilweise nachlässige lateinische
Kursive mit zahlreichen Kürzungen von einer Hand. Nummerierung der Absätze auf den Rand ausgerückt.
Zeitgenössische Streichungen, Verbesserungen und Ergänzungen, zum Teil als Marginalien; teilweise von an-
derer Hand, vielleicht von Andreas Volz, dessen Besitzvermerk auf dem Vorderspiegel steht. Tinte schlägt
durch; beginnender Tintenfraß. Leicht beschädigter dunkelbrauner Ledereinband über vier Bünde, Holzdeckel;
mit Mehrfachstreicheisenlinien auf den Deckeln sowie auf dem abgeschrägten Innenrand und Plattenstempel-
verzierungen, ehemals Rauschei: Palmetten in den vier Ecken und auf dem Rücken sowie vorne Kreuzigungs-
szene mit Monogramm IHS und hinten Muttergottes mit Kind auf der Mondsichel; ähnlich dem Einband von
Cod. Sal. VII,42. Schildchen mit Rückentitel abgelöst, auf den Vorderspiegel geklebt: Ascetica [X] VI. Sec. [dar-
unter in Rot die ältere Form der Heidelberger Signatur:] 7 LI. Grün-blauer Farbschnitt mit braunen (?) Spreng-
seln, teilweise verblasst und fleckig. Farben des Kapitals völlig verblasst. Zwei punzierte Messingschließen an
Lederbändern. Ovales Signaturschild, modern: Sal. 7,51.
Herkunft: Salemer Ol im-Signaturen; Hinterspiegel mit aus klappbaren Signaturzetteln: MS. 47. bzw. MSS. 8.
Hinterspiegel mit Heidelberger Signatur: Sal. 7,51. Vorderspiegel mit Besitzeintrag: F. Andreas Voltz Salemita-
74
[dieser Abschnitt ist an der falschen Stelle eingereiht worden, wie die Anmerkung S. 339
zeigt]. - S. l*-2*, 4*, 363*—444* bis auf Schriftraumrahmung leer.
Johannes Petrus Pinamonti (1632-1703) gehörte dem Jesuitenorden an und war 26 Jahre
lang der Weggefährte von Paolo Segneri (s. zu diesem Cod. Sal. VIII,92) auf Volksmissio-
nen und unterstützte dessen schriftstellerische Arbeit; Pinamonti trat als Verfasser selb-
ständiger, v.a. asketischer Werke hervor (Sommervogel, Bibliotheque 6, Sp. 772ff.). Die
Exerzitien erschienen 1689(?)/1695 zunächst in Italien (,Esercitii spirituali di S. Ignazio’);
in einer Bearbeitung durch den Jesuiten Johannes Gastl seit 1742/43 unter dem Titel
,Christianus in solitudine, Sive exercitia spiritualia S. P. Ignatii distributa in decem dies’
(Sommervogel, ebd., Sp. 773). Schreiber der Hs. war der 1711 in Riedlingen geborene
Paulus Engelberger, der Beichtvater und Kästner in Salem war und am 28. Mai 1778 als
Prokurator in Schemmerberg starb (Walter, Totenbuch, S. 135). Engelberger hatte aus
der Schrift des Petrus Pinamonti ein Compendium erstellt, das er als „monumentum pie-
tatis salemitanae“ bei sich hatte (Schiltegger, Codices manuscriptos, S. 252). Er stützte
sich dabei offenbar auf eine nach 1704 erschienene Auflage des pinamontinischen Werks,
denn diese war aufgeteilt und zusammengestellt nach Meditationen, Examina und Lektio-
nen (Sommervogel, ebd., Sp. 772), woran sich vorliegende Hs. wohl orientierte. Neben
den ,Esercitii’ hat Engelberger sein Werk offenbar noch aus weiteren Schriften Pinamon-
tis kompiliert, wie sein Inhalt nahelegt (so auch unter Verwendung von ,La religiosa in
solitudine’ und ,Esercizio di preparazione alla morte’, beide 1695).
Cod. Sal. VII,51
Julius Priscianensis: Meditationen und Betrachtungen, lat.
Papier * 242 Bll. • 15,0 x 10,3 * Salem • um 1595-1610 (?)
Moderne Foliierung (1*—8*, 9-235, 236*—242*); von der ersten und letzten Lage (Textverlust, Bl. 1 und 2 der
Lage fehlen: IV-2) sowie zwischen Bl. 110 und 111 fehlen je zwei Bll., Verlust bereits vor der Bl.-Zählung
erfolgt. Die Hs. besteht durchgängig aus Quaternionen; Lagenreklamanten auf den jeweils letzten Blln. der La-
ge, zum Teil beschnitten. Wzz.: gekrönter Doppeladler mit Initialen H S beidseits der Krone, vergleichbar auf-
gebaute Wzz. sind bei Piccard, WZK 42735-42737 zwischen 1612 und 1613 belegt; gekrönter Menschenkopf
im Schild mit Initialen (S £?), ähnlich Piccard, WZK 20791 (Wallerstein 1593), 20792 (Kloster Kaisheim 1593),
20793 (Wallerstein 1593), 20794 (Wallerstein 1594), 20795 (Rothenburg/Tauber 1593), 20796 (Wallerstein 1593)
und 20797 (Megesheim 1595). Schriftraum: 12,7-13,6 x 7,6-8,5; 19-26 Zeilen. Teilweise nachlässige lateinische
Kursive mit zahlreichen Kürzungen von einer Hand. Nummerierung der Absätze auf den Rand ausgerückt.
Zeitgenössische Streichungen, Verbesserungen und Ergänzungen, zum Teil als Marginalien; teilweise von an-
derer Hand, vielleicht von Andreas Volz, dessen Besitzvermerk auf dem Vorderspiegel steht. Tinte schlägt
durch; beginnender Tintenfraß. Leicht beschädigter dunkelbrauner Ledereinband über vier Bünde, Holzdeckel;
mit Mehrfachstreicheisenlinien auf den Deckeln sowie auf dem abgeschrägten Innenrand und Plattenstempel-
verzierungen, ehemals Rauschei: Palmetten in den vier Ecken und auf dem Rücken sowie vorne Kreuzigungs-
szene mit Monogramm IHS und hinten Muttergottes mit Kind auf der Mondsichel; ähnlich dem Einband von
Cod. Sal. VII,42. Schildchen mit Rückentitel abgelöst, auf den Vorderspiegel geklebt: Ascetica [X] VI. Sec. [dar-
unter in Rot die ältere Form der Heidelberger Signatur:] 7 LI. Grün-blauer Farbschnitt mit braunen (?) Spreng-
seln, teilweise verblasst und fleckig. Farben des Kapitals völlig verblasst. Zwei punzierte Messingschließen an
Lederbändern. Ovales Signaturschild, modern: Sal. 7,51.
Herkunft: Salemer Ol im-Signaturen; Hinterspiegel mit aus klappbaren Signaturzetteln: MS. 47. bzw. MSS. 8.
Hinterspiegel mit Heidelberger Signatur: Sal. 7,51. Vorderspiegel mit Besitzeintrag: F. Andreas Voltz Salemita-
74