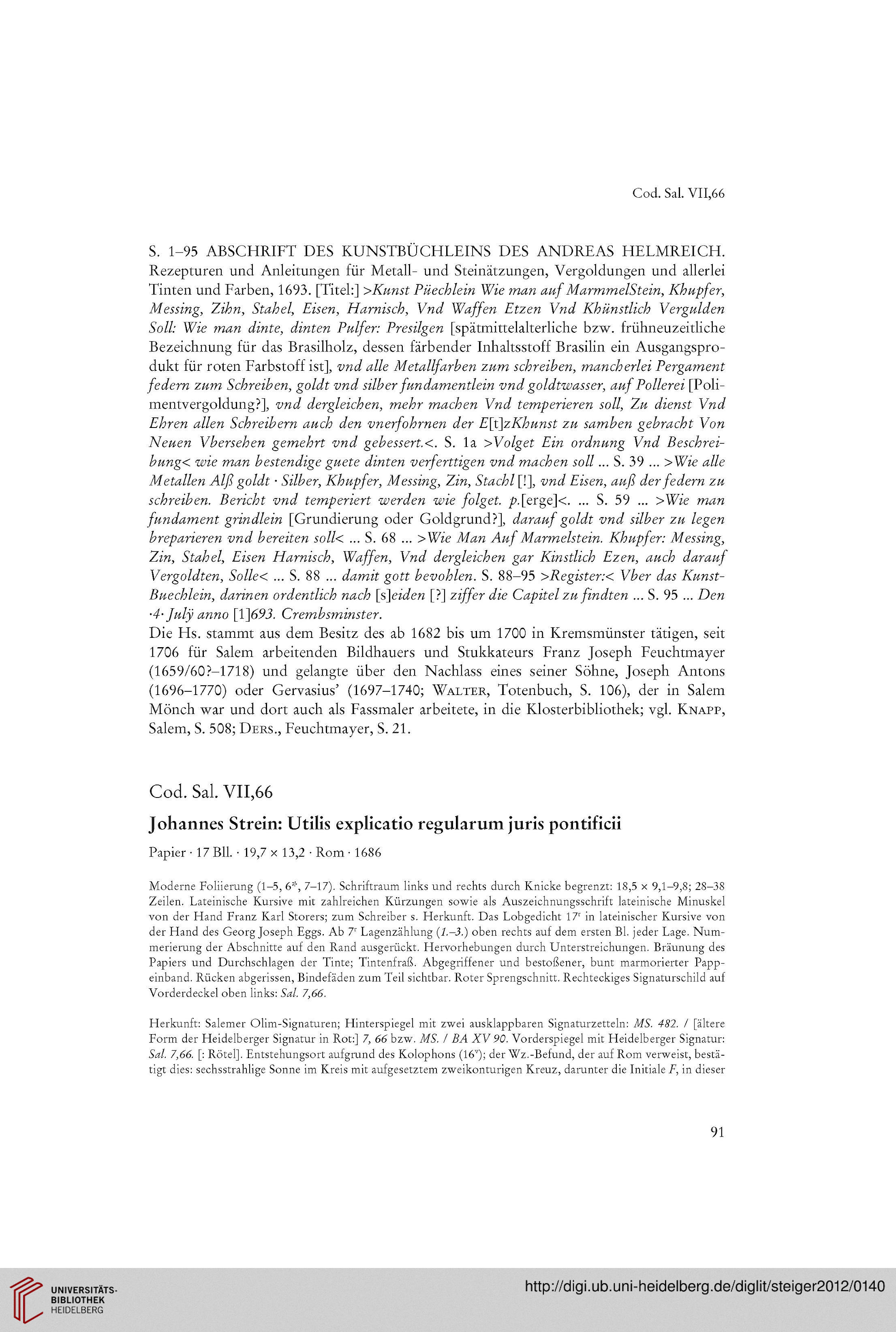Cod. Sal. VII,66
S. 1-95 ABSCHRIFT DES KUNSTBÜCHLEINS DES ANDREAS HELMREICH.
Rezepturen und Anleitungen für Metall- und Steinätzungen, Vergoldungen und allerlei
Tinten und Farben, 1693. [Titel:] >Kunst Piiechlein Wie man auf MarmmelStein, Khupfer,
Messing, Zihn, Stahel, Eisen, Harnisch, Vnd Waffen Etzen Vnd Khiinstlich Vergulden
Soll: Wie man dinte, dinten Pulfer: Presilgen [spätmittelalterliche bzw. frühneuzeitliche
Bezeichnung für das Brasilholz, dessen färbender Inhaltsstoff Brasilin ein Ausgangspro-
dukt für roten Farbstoff ist], vnd alle Metallfarben zum schreiben, mancherlei Pergament
federn zum Schreiben, goldt vnd silber fundamentlein vnd goldtwasser, auf Pollerei [Poli-
mentvergoldung?], vnd dergleichen, mehr machen Vnd temperieren soll, Zu dienst Vnd
Ehren allen Schreibern auch den vnerfohrnen der E[t]zKhunst zu samben gebracht Von
Neuen Vbersehen gemehrt vnd gebesserte. S. la >Volget Ein Ordnung Vnd Beschrei-
bung< wie man bestendige guete dinten verferttigen vnd machen soll... S. 39 ... >Wie alle
Metallen Alf goldt ■ Silber, Khupfer, Messing, Zin, Stachl [!], vnd Eisen, auf der federn zu
schreiben. Bericht vnd temperiert werden wie folget. />.[erge]<. ... S. 59 ... >Wie man
fundament grindlein [Grundierung oder Goldgrund?], darauf goldt vnd silber zu legen
breparieren vnd bereiten soll< ... S. 68 ... >Wie Man Auf Marmelstein. Khupfer: Messing,
Zin, Stahel, Eisen Harnisch, Waffen, Vnd dergleichen gar Kinstlich Ezen, auch darauf
Vergoldten, Solle< ... S. 88 ... damit gott bevohlen. S. 88-95 >Register:< Vber das Kunst-
Buechlein, darinen ordentlich nach [s]eiden [?] Ziffer die Capitel zufindten ... S. 95 ... Den
■4- July anno [1 ]69J. Crembsminster.
Die Hs. stammt aus dem Besitz des ab 1682 bis um 1700 in Kremsmünster tätigen, seit
1706 für Salem arbeitenden Bildhauers und Stukkateurs Franz Joseph Feuchtmayer
(1659/60?—1718) und gelangte über den Nachlass eines seiner Söhne, Joseph Antons
(1696-1770) oder Gervasius’ (1697-1740; Walter, Totenbuch, S. 106), der in Salem
Mönch war und dort auch als Fassmaler arbeitete, in die Klosterbibliothek; vgl. Knapp,
Salem, S. 508; Ders., Feuchtmayer, S. 21.
Cod. Sal. VII,66
Johannes Strein: Utilis explicatio regularum juris pontificii
Papier • 17 Bll. • 19,7 x 13,2 • Rom • 1686
Moderne Foliierung (1-5, 6*, 7-17). Schriftraum links und rechts durch Knicke begrenzt: 18,5 x 9,1-9,8; 28-38
Zeilen. Lateinische Kursive mit zahlreichen Kürzungen sowie als Auszeichnungsschrift lateinische Minuskel
von der Hand Franz Karl Störers; zum Schreiber s. Herkunft. Das Lobgedicht 17r in lateinischer Kursive von
der Hand des Georg Joseph Eggs. Ab 7r Lagenzählung (1.-3.) oben rechts auf dem ersten Bl. jeder Lage. Num-
merierung der Abschnitte auf den Rand ausgerückt. Hervorhebungen durch Unterstreichungen. Bräunung des
Papiers und Durchschlagen der Tinte; Tintenfraß. Abgegriffener und bestoßener, bunt marmorierter Papp-
einband. Rücken abgerissen, Bindefäden zum Teil sichtbar. Roter Sprengschnitt. Rechteckiges Signaturschild auf
Vorderdeckel oben links: Sal. 7,66.
Herkunft: Salemer Olim-Signaturen; Hinterspiegel mit zwei ausklappbaren Signaturzetteln: MS. 482. / [ältere
Form der Heidelberger Signatur in Rot:] 7, 66 bzw. MS. / BA XV 90. Vorderspiegel mit Heidelberger Signatur:
Sal. 7,66. [: Rötel]. Entstehungsort aufgrund des Kolophons (16v); der Wz.-Befund, der auf Rom verweist, bestä-
tigt dies: sechsstrahlige Sonne im Kreis mit aufgesetztem zweikonturigen Kreuz, darunter die Initiale F, in dieser
91
S. 1-95 ABSCHRIFT DES KUNSTBÜCHLEINS DES ANDREAS HELMREICH.
Rezepturen und Anleitungen für Metall- und Steinätzungen, Vergoldungen und allerlei
Tinten und Farben, 1693. [Titel:] >Kunst Piiechlein Wie man auf MarmmelStein, Khupfer,
Messing, Zihn, Stahel, Eisen, Harnisch, Vnd Waffen Etzen Vnd Khiinstlich Vergulden
Soll: Wie man dinte, dinten Pulfer: Presilgen [spätmittelalterliche bzw. frühneuzeitliche
Bezeichnung für das Brasilholz, dessen färbender Inhaltsstoff Brasilin ein Ausgangspro-
dukt für roten Farbstoff ist], vnd alle Metallfarben zum schreiben, mancherlei Pergament
federn zum Schreiben, goldt vnd silber fundamentlein vnd goldtwasser, auf Pollerei [Poli-
mentvergoldung?], vnd dergleichen, mehr machen Vnd temperieren soll, Zu dienst Vnd
Ehren allen Schreibern auch den vnerfohrnen der E[t]zKhunst zu samben gebracht Von
Neuen Vbersehen gemehrt vnd gebesserte. S. la >Volget Ein Ordnung Vnd Beschrei-
bung< wie man bestendige guete dinten verferttigen vnd machen soll... S. 39 ... >Wie alle
Metallen Alf goldt ■ Silber, Khupfer, Messing, Zin, Stachl [!], vnd Eisen, auf der federn zu
schreiben. Bericht vnd temperiert werden wie folget. />.[erge]<. ... S. 59 ... >Wie man
fundament grindlein [Grundierung oder Goldgrund?], darauf goldt vnd silber zu legen
breparieren vnd bereiten soll< ... S. 68 ... >Wie Man Auf Marmelstein. Khupfer: Messing,
Zin, Stahel, Eisen Harnisch, Waffen, Vnd dergleichen gar Kinstlich Ezen, auch darauf
Vergoldten, Solle< ... S. 88 ... damit gott bevohlen. S. 88-95 >Register:< Vber das Kunst-
Buechlein, darinen ordentlich nach [s]eiden [?] Ziffer die Capitel zufindten ... S. 95 ... Den
■4- July anno [1 ]69J. Crembsminster.
Die Hs. stammt aus dem Besitz des ab 1682 bis um 1700 in Kremsmünster tätigen, seit
1706 für Salem arbeitenden Bildhauers und Stukkateurs Franz Joseph Feuchtmayer
(1659/60?—1718) und gelangte über den Nachlass eines seiner Söhne, Joseph Antons
(1696-1770) oder Gervasius’ (1697-1740; Walter, Totenbuch, S. 106), der in Salem
Mönch war und dort auch als Fassmaler arbeitete, in die Klosterbibliothek; vgl. Knapp,
Salem, S. 508; Ders., Feuchtmayer, S. 21.
Cod. Sal. VII,66
Johannes Strein: Utilis explicatio regularum juris pontificii
Papier • 17 Bll. • 19,7 x 13,2 • Rom • 1686
Moderne Foliierung (1-5, 6*, 7-17). Schriftraum links und rechts durch Knicke begrenzt: 18,5 x 9,1-9,8; 28-38
Zeilen. Lateinische Kursive mit zahlreichen Kürzungen sowie als Auszeichnungsschrift lateinische Minuskel
von der Hand Franz Karl Störers; zum Schreiber s. Herkunft. Das Lobgedicht 17r in lateinischer Kursive von
der Hand des Georg Joseph Eggs. Ab 7r Lagenzählung (1.-3.) oben rechts auf dem ersten Bl. jeder Lage. Num-
merierung der Abschnitte auf den Rand ausgerückt. Hervorhebungen durch Unterstreichungen. Bräunung des
Papiers und Durchschlagen der Tinte; Tintenfraß. Abgegriffener und bestoßener, bunt marmorierter Papp-
einband. Rücken abgerissen, Bindefäden zum Teil sichtbar. Roter Sprengschnitt. Rechteckiges Signaturschild auf
Vorderdeckel oben links: Sal. 7,66.
Herkunft: Salemer Olim-Signaturen; Hinterspiegel mit zwei ausklappbaren Signaturzetteln: MS. 482. / [ältere
Form der Heidelberger Signatur in Rot:] 7, 66 bzw. MS. / BA XV 90. Vorderspiegel mit Heidelberger Signatur:
Sal. 7,66. [: Rötel]. Entstehungsort aufgrund des Kolophons (16v); der Wz.-Befund, der auf Rom verweist, bestä-
tigt dies: sechsstrahlige Sonne im Kreis mit aufgesetztem zweikonturigen Kreuz, darunter die Initiale F, in dieser
91