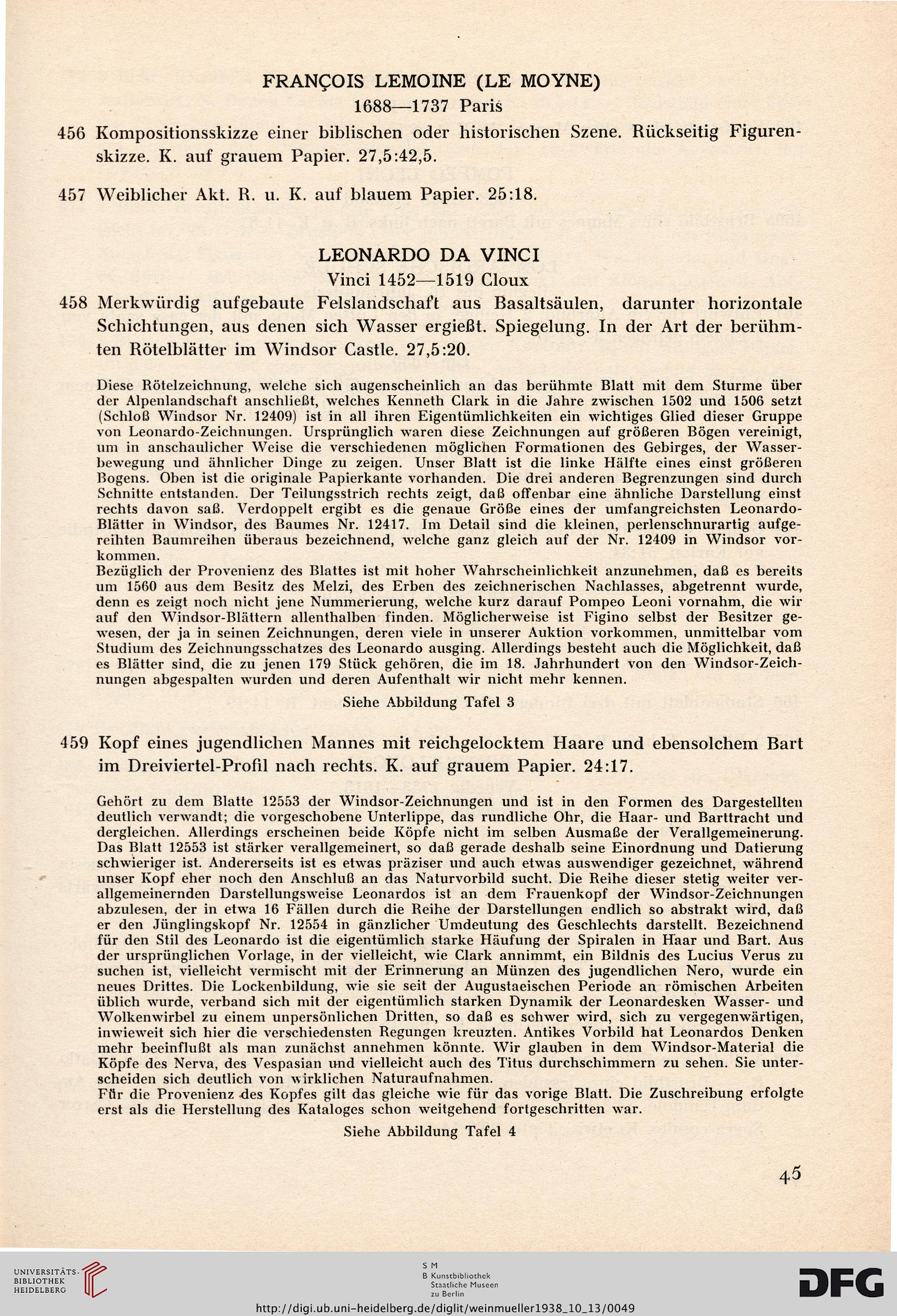FRANCOIS LEMOINE (LE MOYNE)
1688—1737 Paris
456 Konipositionsskizze einer biblischen oder historischen Szene. Rückseitig Figuren-
skizze. K. auf grauem Papier. 27,5:42,5.
457 Weiblicher Akt. R. u. K. auf blauem Papier. 25:18.
LEONARDO DA VINCI
Vinci 1452—1519 Cloux
458 Merkwürdig aufgebaute Felslandschaft aus Basaltsäulen, darunter horizontale
Schichtungen, aus denen sich Wasser ergießt. Spiegelung. In der Art der berühm-
ten Rötelblätter im Windsor Castle. 27,5:20.
Diese Rötelzeichnung, welche sich augenscheinlich an das berühmte Blatt mit dem Sturme über
der Alpenlandschaft anschließt, welches Kenrieth Clark in die Jahre zwischen 1502 und 1506 setzt
(Schloß Windsor Nr. 12409) ist in all ihren Eigentümlichkeiten ein wichtiges Glied dieser Gruppe
von Leonardo-Zeichnungen. Ursprünglich waren diese Zeichnungen auf größeren Bögen vereinigt,
um in anschaulicher Weise die verschiedenen möglichen Formationen des Gebirges, der Wasser-
bewegung und ähnlicher Dinge zu zeigen. Unser Blatt ist die linke Hälfte eines einst größeren
Bogens. Oben ist die originale Papierkante vorhanden. Die drei anderen Begrenzungen sind durch
Schnitte entstanden. Der Teilungsstrich rechts zeigt, daß offenbar eine ähnliche Darstellung einst
rechts davon saß. Verdoppelt ergibt es die genaue Größe eines der umfangreichsten Leonardo-
Blätter in Windsor, des Baumes Nr. 12417. Im Detail sind die kleinen, perlenschnurartig aufge-
reihten Baumreihen überaus bezeichnend, welche ganz gleich auf der Nr. 12409 in Windsor vor-
kommen.
Bezüglich der Provenienz des Blattes ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß es bereits
um 1560 aus dem Besitz des Melzi, des Erben des zeichnerischen Nachlasses, abgetrennt wurde,
denn es zeigt noch nicht jene Nummerierung, welche kurz darauf Pompeo Leoni vornahm, die wir
auf den Windsor-Blättern allenthalben finden. Möglicherweise ist Figino selbst der Besitzer ge-
wesen, der ja in seinen Zeichnungen, deren viele in unserer Auktion vorkommen, unmittelbar vom
Studium des Zeichnungsschatzes des Leonardo ausging. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, daß
es Blätter sind, die zu jenen 179 Stück gehören, die im 18. Jahrhundert von den Windsor-Zeich-
nungen abgespalten wurden und deren Aufenthalt wir nicht mehr kennen.
Siehe Abbildung Tafel 3
159 Kopf eines jugendlichen Mannes mit reichgelocktem Haare und ebensolchem Bart
im Dreiviertel-Profil nach rechts. K. auf grauem Papier. 24:17.
Gehört zu dem Blatte 12553 der Windsor-Zeichnungen und ist in den Formen des Dargestellten
deutlich verwandt; die vorgeschobene Unterlippe, das rundliche Ohr, die Haar- und Barttracht und
dergleichen. Allerdings erscheinen beide Köpfe nicht im selben Ausmaße der Verallgemeinerung.
Das Blatt 12553 ist stärker verallgemeinert, so daß gerade deshalb seine Einordnung und Datierung
schwieriger ist. Andererseits ist es etwas präziser und auch etwas auswendiger gezeichnet, während
unser Kopf eher noch den Anschluß an das Naturvorbild sucht. Die Reihe dieser stetig weiter ver-
allgemeinernden Darstellungsweise Leonardos ist an dem Frauenkopf der Windsor-Zeichnungen
abzulesen, der in etwa 16 Fällen durch die Reihe der Darstellungen endlich so abstrakt wird, daß
er den Jünglingskopf Nr. 12554 in gänzlicher Umdeutung des Geschlechts darstellt. Bezeichnend
für den Stil des Leonardo ist die eigentümlich starke Häufung der Spiralen in Haar und Bart. Aus
der ursprünglichen Vorlage, in der vielleicht, wie Clark annimmt, ein Bildnis des Lucius Verus zu
suchen ist, vielleicht vermischt mit der Erinnerung an Münzen des jugendlichen Nero, wurde ein
neues Drittes. Die Lockenbildung, wie sie seit der Augustaeischen Periode an römischen Arbeiten
üblich wurde, verband sich mit der eigentümlich starken Dynamik der Leonardesken Wasser- und
Wolkenwirbel zu einem unpersönlichen Dritten, so daß es schwer wird, sich zu vergegenwärtigen,
inwieweit sich hier die verschiedensten Regungen kreuzten. Antikes Vorbild hat Leonardos Denken
mehr beeinflußt als man zunächst annehmen könnte. Wir glauben in dem Windsor-Material die
Köpfe des Nerva, des Vespasian und vielleicht auch des Titus durchschimmern zu sehen. Sie unter-
scheiden sich deutlich von wirklichen Naturaufnahmen.
Für die Provenienz des Kopfes gilt das gleiche wie für das vorige Blatt. Die Zuschreibung erfolgte
erst als die Herstellung des Kataloges schon weitgehend fortgeschritten war.
Siehe Abbildung Tafel 4
45
1688—1737 Paris
456 Konipositionsskizze einer biblischen oder historischen Szene. Rückseitig Figuren-
skizze. K. auf grauem Papier. 27,5:42,5.
457 Weiblicher Akt. R. u. K. auf blauem Papier. 25:18.
LEONARDO DA VINCI
Vinci 1452—1519 Cloux
458 Merkwürdig aufgebaute Felslandschaft aus Basaltsäulen, darunter horizontale
Schichtungen, aus denen sich Wasser ergießt. Spiegelung. In der Art der berühm-
ten Rötelblätter im Windsor Castle. 27,5:20.
Diese Rötelzeichnung, welche sich augenscheinlich an das berühmte Blatt mit dem Sturme über
der Alpenlandschaft anschließt, welches Kenrieth Clark in die Jahre zwischen 1502 und 1506 setzt
(Schloß Windsor Nr. 12409) ist in all ihren Eigentümlichkeiten ein wichtiges Glied dieser Gruppe
von Leonardo-Zeichnungen. Ursprünglich waren diese Zeichnungen auf größeren Bögen vereinigt,
um in anschaulicher Weise die verschiedenen möglichen Formationen des Gebirges, der Wasser-
bewegung und ähnlicher Dinge zu zeigen. Unser Blatt ist die linke Hälfte eines einst größeren
Bogens. Oben ist die originale Papierkante vorhanden. Die drei anderen Begrenzungen sind durch
Schnitte entstanden. Der Teilungsstrich rechts zeigt, daß offenbar eine ähnliche Darstellung einst
rechts davon saß. Verdoppelt ergibt es die genaue Größe eines der umfangreichsten Leonardo-
Blätter in Windsor, des Baumes Nr. 12417. Im Detail sind die kleinen, perlenschnurartig aufge-
reihten Baumreihen überaus bezeichnend, welche ganz gleich auf der Nr. 12409 in Windsor vor-
kommen.
Bezüglich der Provenienz des Blattes ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß es bereits
um 1560 aus dem Besitz des Melzi, des Erben des zeichnerischen Nachlasses, abgetrennt wurde,
denn es zeigt noch nicht jene Nummerierung, welche kurz darauf Pompeo Leoni vornahm, die wir
auf den Windsor-Blättern allenthalben finden. Möglicherweise ist Figino selbst der Besitzer ge-
wesen, der ja in seinen Zeichnungen, deren viele in unserer Auktion vorkommen, unmittelbar vom
Studium des Zeichnungsschatzes des Leonardo ausging. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, daß
es Blätter sind, die zu jenen 179 Stück gehören, die im 18. Jahrhundert von den Windsor-Zeich-
nungen abgespalten wurden und deren Aufenthalt wir nicht mehr kennen.
Siehe Abbildung Tafel 3
159 Kopf eines jugendlichen Mannes mit reichgelocktem Haare und ebensolchem Bart
im Dreiviertel-Profil nach rechts. K. auf grauem Papier. 24:17.
Gehört zu dem Blatte 12553 der Windsor-Zeichnungen und ist in den Formen des Dargestellten
deutlich verwandt; die vorgeschobene Unterlippe, das rundliche Ohr, die Haar- und Barttracht und
dergleichen. Allerdings erscheinen beide Köpfe nicht im selben Ausmaße der Verallgemeinerung.
Das Blatt 12553 ist stärker verallgemeinert, so daß gerade deshalb seine Einordnung und Datierung
schwieriger ist. Andererseits ist es etwas präziser und auch etwas auswendiger gezeichnet, während
unser Kopf eher noch den Anschluß an das Naturvorbild sucht. Die Reihe dieser stetig weiter ver-
allgemeinernden Darstellungsweise Leonardos ist an dem Frauenkopf der Windsor-Zeichnungen
abzulesen, der in etwa 16 Fällen durch die Reihe der Darstellungen endlich so abstrakt wird, daß
er den Jünglingskopf Nr. 12554 in gänzlicher Umdeutung des Geschlechts darstellt. Bezeichnend
für den Stil des Leonardo ist die eigentümlich starke Häufung der Spiralen in Haar und Bart. Aus
der ursprünglichen Vorlage, in der vielleicht, wie Clark annimmt, ein Bildnis des Lucius Verus zu
suchen ist, vielleicht vermischt mit der Erinnerung an Münzen des jugendlichen Nero, wurde ein
neues Drittes. Die Lockenbildung, wie sie seit der Augustaeischen Periode an römischen Arbeiten
üblich wurde, verband sich mit der eigentümlich starken Dynamik der Leonardesken Wasser- und
Wolkenwirbel zu einem unpersönlichen Dritten, so daß es schwer wird, sich zu vergegenwärtigen,
inwieweit sich hier die verschiedensten Regungen kreuzten. Antikes Vorbild hat Leonardos Denken
mehr beeinflußt als man zunächst annehmen könnte. Wir glauben in dem Windsor-Material die
Köpfe des Nerva, des Vespasian und vielleicht auch des Titus durchschimmern zu sehen. Sie unter-
scheiden sich deutlich von wirklichen Naturaufnahmen.
Für die Provenienz des Kopfes gilt das gleiche wie für das vorige Blatt. Die Zuschreibung erfolgte
erst als die Herstellung des Kataloges schon weitgehend fortgeschritten war.
Siehe Abbildung Tafel 4
45