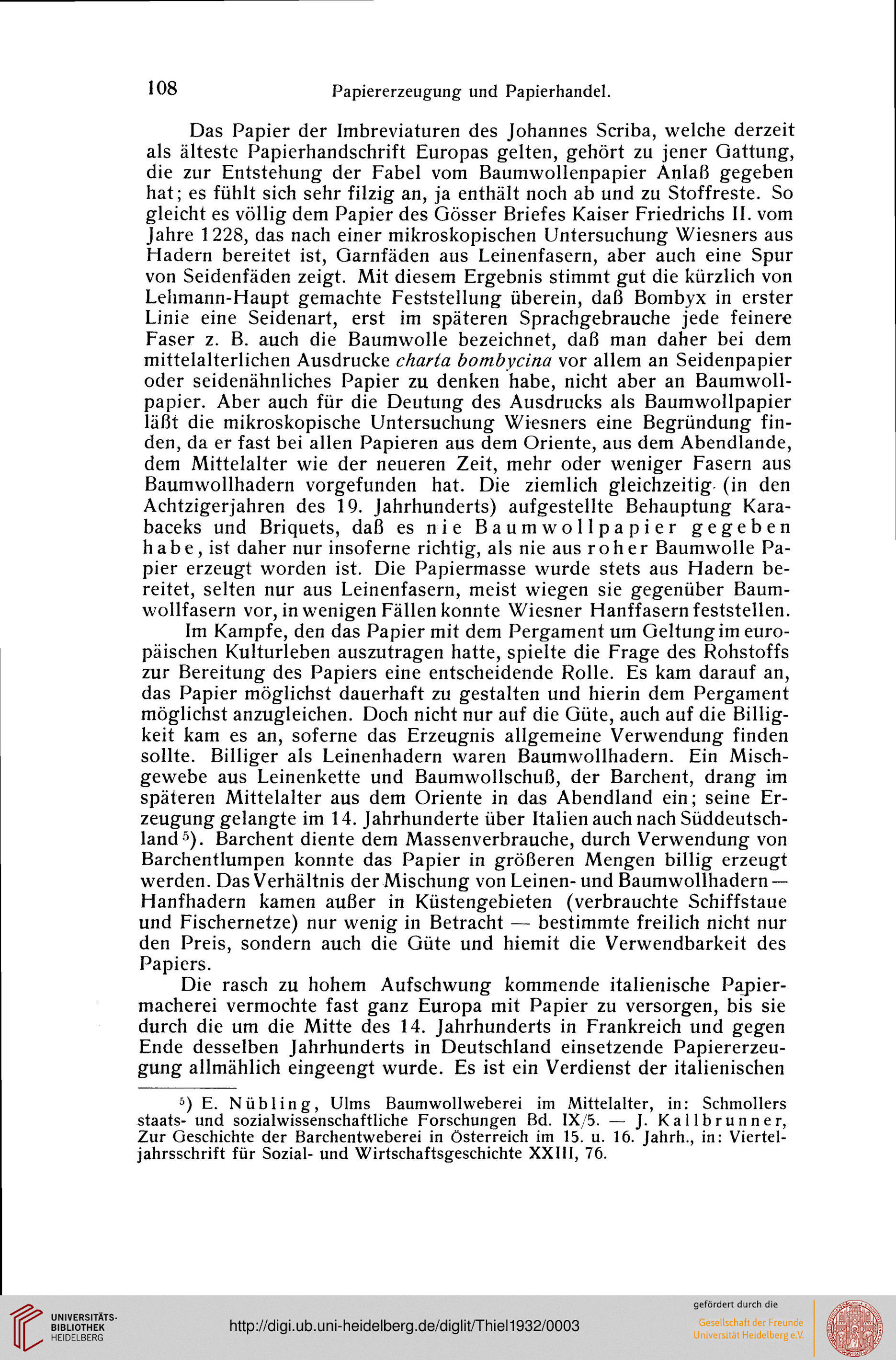108 Papiererzeugung und Papierhandel.
Das Papier der Imbreviaturen des Johannes Scriba, welche derzeit
als älteste Papierhandschrift Europas gelten, gehört zu jener Gattung,
die zur Entstehung der Fabel vom Baumwollenpapier Anlaß gegeben
hat; es fühlt sich sehr filzig an, ja enthält noch ab und zu Stoffreste. So
gleicht es völlig dem Papier des Gösser Briefes Kaiser Friedrichs II. vom
Jahre 1228, das nach einer mikroskopischen Untersuchung Wiesners aus
Hadern bereitet ist, Garnfäden aus Leinenfasern, aber auch eine Spur
von Seidenfäden zeigt. Mit diesem Ergebnis stimmt gut die kürzlich von
Lehmann-Haupt gemachte Feststellung überein, daß Bombyx in erster
Linie eine Seidenart, erst im späteren Sprachgebrauche jede feinere
Faser z. B. auch die Baumwolle bezeichnet, daß man daher bei dem
mittelalterlichen Ausdrucke Charta botnbycina vor allem an Seidenpapier
oder seidenähnliches Papier zu denken habe, nicht aber an Baumwoll-
papier. Aber auch für die Deutung des Ausdrucks als Baumwollpapier
läßt die mikroskopische Untersuchung Wiesners eine Begründung fin-
den, da er fast bei allen Papieren aus dem Oriente, aus dem Abendlande,
dem Mittelalter wie der neueren Zeit, mehr oder weniger Fasern aus
Baumwollhadern vorgefunden hat. Die ziemlich gleichzeitig (in den
Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts) aufgestellte Behauptung Kara-
baceks und Briquets, daß es nie Baumwollpapier gegeben
habe, ist daher nur insoferne richtig, als nie aus roher Baumwolle Pa-
pier erzeugt worden ist. Die Papiermasse wurde stets aus Hadern be-
reitet, selten nur aus Leinenfasern, meist wiegen sie gegenüber Baum-
wollfasern vor, in wenigen Fällen konnte Wiesner Hanffasern feststellen.
Im Kampfe, den das Papier mit dem Pergament um Geltung im euro-
päischen Kulturleben auszutragen hatte, spielte die Frage des Rohstoffs
zur Bereitung des Papiers eine entscheidende Rolle. Es kam darauf an,
das Papier möglichst dauerhaft zu gestalten und hierin dem Pergament
möglichst anzugleichen. Doch nicht nur auf die Güte, auch auf die Billig-
keit kam es an, soferne das Erzeugnis allgemeine Verwendung finden
sollte. Billiger als Leinenhadern waren Baumwollhadern. Ein Misch-
gewebe aus Leinenkette und Baumwollschuß, der Barchent, drang im
späteren Mittelalter aus dem Oriente in das Abendland ein; seine Er-
zeugunggelangte im 14. Jahrhunderte über Italien auch nach Süddeutsch-
land5). Barchent diente dem Massenverbrauche, durch Verwendung von
Barchentlumpen konnte das Papier in größeren Mengen billig erzeugt
werden. Das Verhältnis der Mischung von Leinen-und Baumwollhadern —
Hanfhadern kamen außer in Küstengebieten (verbrauchte Schiffstaue
und Fischernetze) nur wenig in Betracht — bestimmte freilich nicht nur
den Preis, sondern auch die Güte und hiemit die Verwendbarkeit des
Papiers.
Die rasch zu hohem Aufschwung kommende italienische Papier-
macherei vermochte fast ganz Europa mit Papier zu versorgen, bis sie
durch die um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Frankreich und gegen
Ende desselben Jahrhunderts in Deutschland einsetzende Papiererzeu-
gung allmählich eingeengt wurde. Es ist ein Verdienst der italienischen
5) E. Nübling, Ulms Baumwollweberei im Mittelalter, in: Schmollers
Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen Bd. IX/5. — J. Kallbrunner,
Zur Geschichte der Barchentweberei in Österreich im 15. u. 16. Jahrh., in: Viertel-
jahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte XXIII, 76.
Das Papier der Imbreviaturen des Johannes Scriba, welche derzeit
als älteste Papierhandschrift Europas gelten, gehört zu jener Gattung,
die zur Entstehung der Fabel vom Baumwollenpapier Anlaß gegeben
hat; es fühlt sich sehr filzig an, ja enthält noch ab und zu Stoffreste. So
gleicht es völlig dem Papier des Gösser Briefes Kaiser Friedrichs II. vom
Jahre 1228, das nach einer mikroskopischen Untersuchung Wiesners aus
Hadern bereitet ist, Garnfäden aus Leinenfasern, aber auch eine Spur
von Seidenfäden zeigt. Mit diesem Ergebnis stimmt gut die kürzlich von
Lehmann-Haupt gemachte Feststellung überein, daß Bombyx in erster
Linie eine Seidenart, erst im späteren Sprachgebrauche jede feinere
Faser z. B. auch die Baumwolle bezeichnet, daß man daher bei dem
mittelalterlichen Ausdrucke Charta botnbycina vor allem an Seidenpapier
oder seidenähnliches Papier zu denken habe, nicht aber an Baumwoll-
papier. Aber auch für die Deutung des Ausdrucks als Baumwollpapier
läßt die mikroskopische Untersuchung Wiesners eine Begründung fin-
den, da er fast bei allen Papieren aus dem Oriente, aus dem Abendlande,
dem Mittelalter wie der neueren Zeit, mehr oder weniger Fasern aus
Baumwollhadern vorgefunden hat. Die ziemlich gleichzeitig (in den
Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts) aufgestellte Behauptung Kara-
baceks und Briquets, daß es nie Baumwollpapier gegeben
habe, ist daher nur insoferne richtig, als nie aus roher Baumwolle Pa-
pier erzeugt worden ist. Die Papiermasse wurde stets aus Hadern be-
reitet, selten nur aus Leinenfasern, meist wiegen sie gegenüber Baum-
wollfasern vor, in wenigen Fällen konnte Wiesner Hanffasern feststellen.
Im Kampfe, den das Papier mit dem Pergament um Geltung im euro-
päischen Kulturleben auszutragen hatte, spielte die Frage des Rohstoffs
zur Bereitung des Papiers eine entscheidende Rolle. Es kam darauf an,
das Papier möglichst dauerhaft zu gestalten und hierin dem Pergament
möglichst anzugleichen. Doch nicht nur auf die Güte, auch auf die Billig-
keit kam es an, soferne das Erzeugnis allgemeine Verwendung finden
sollte. Billiger als Leinenhadern waren Baumwollhadern. Ein Misch-
gewebe aus Leinenkette und Baumwollschuß, der Barchent, drang im
späteren Mittelalter aus dem Oriente in das Abendland ein; seine Er-
zeugunggelangte im 14. Jahrhunderte über Italien auch nach Süddeutsch-
land5). Barchent diente dem Massenverbrauche, durch Verwendung von
Barchentlumpen konnte das Papier in größeren Mengen billig erzeugt
werden. Das Verhältnis der Mischung von Leinen-und Baumwollhadern —
Hanfhadern kamen außer in Küstengebieten (verbrauchte Schiffstaue
und Fischernetze) nur wenig in Betracht — bestimmte freilich nicht nur
den Preis, sondern auch die Güte und hiemit die Verwendbarkeit des
Papiers.
Die rasch zu hohem Aufschwung kommende italienische Papier-
macherei vermochte fast ganz Europa mit Papier zu versorgen, bis sie
durch die um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Frankreich und gegen
Ende desselben Jahrhunderts in Deutschland einsetzende Papiererzeu-
gung allmählich eingeengt wurde. Es ist ein Verdienst der italienischen
5) E. Nübling, Ulms Baumwollweberei im Mittelalter, in: Schmollers
Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen Bd. IX/5. — J. Kallbrunner,
Zur Geschichte der Barchentweberei in Österreich im 15. u. 16. Jahrh., in: Viertel-
jahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte XXIII, 76.