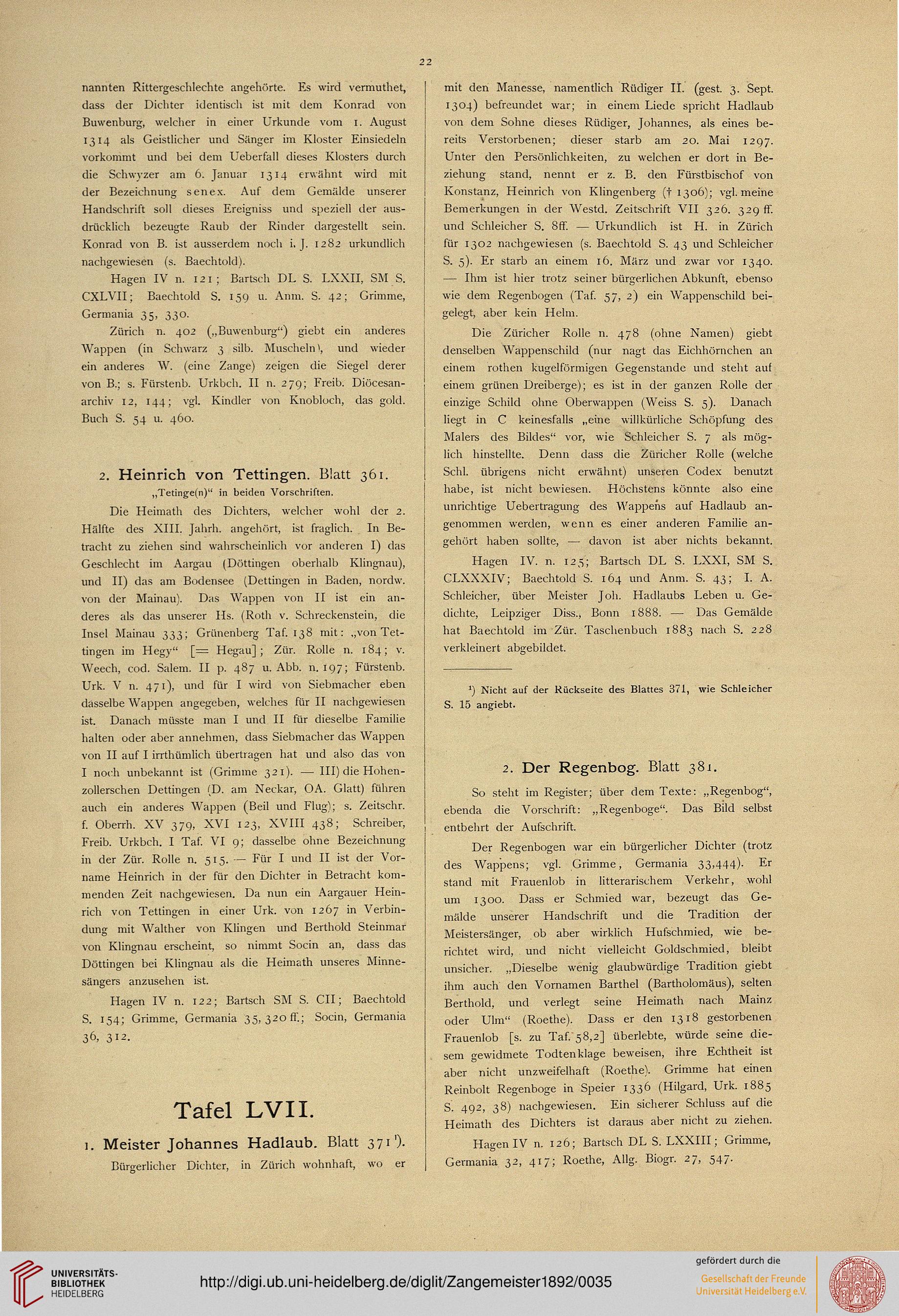22
nannten Rittergesclilechte angehörte. Es wird vermuthet,
dass der Dichter identisch ist mit dem Konrad von
Buwenburg, welcher in einer Urkunde vom i. August
1314 als Geistlicher und Sänger im Kloster Einsiedeln
vorkommt und bei dem Ueberfall dieses Klosters durch
die Schwyzer am 6. Januar 1314 erwähnt wird mit
der Bezeichnung senex. Auf dem Gemälde unserer
Handschrift soll dieses Ereigniss und speziell der aus-
drücklich bezeugte Raub der Rinder dargestellt sein.
Konrad von B. ist ausserdem noch i. J. 1282 urkundlich
nachgewiesen (s. Baechtold).
Hagen IV n. 121; Bartsch DL S. LXXII, SM S.
CXLVII; Baechtold S. 159 u. Anm. S. 42; Grimme,
Germania 35, 330.
Zürich n. 402 („Buwenburg") giebt ein anderes
Wappen (in Schwarz 3 silb. Muscheln*, und wieder
ein anderes W. (eine Zange) zeigen die Siegel derer
von B.; s. Fürstenb. Urkbch. II n. 279; Freib. Diöcesan-
archiv 12, 144; vgl. Kindler von Knobloch, das gold.
Buch S. 54 u. 460.
2. Heinrich von Tettingen. Blatt 361.
„Tetinge(n)" in beiden Vorschriften.
Die Heimath des Dichters, welcher wohl der 2.
Hälfte des XIII. Jahrh. angehört, ist fraglich. In Be-
tracht zu ziehen sind wahrscheinlich vor anderen I) das
Geschlecht im Aargau (Döttingen oberhalb Klingnau),
und II) das am Bodensee (Dettingen in Baden, nordw.
von der Mainau). Das Wappen von II ist ein an-
deres als das unserer Hs. (Roth v. Schreckenstein, die
Insel Mainau 333; Grünenberg Taf. 138 mit: ,,von Tet-
tingen im Hegy" [= Hegau] ; Zur. Rolle n. 184; v.
Weech, cod. Salem. II p. 487 u. Abb. n. 197; Fürstenb.
Urk. V n. 471), und für I wird von Siebmacher eben
dasselbe Wappen angegeben, welches für II nachgewiesen
ist. Danach müsste man I und II für dieselbe Familie
halten oder aber annehmen, dass Siebmacher das Wappen
von II auf I irrthümlich übertragen hat und also das von
I noch unbekannt ist (Grimme 321). — III) die Hohen-
zollerschen Dettingen (D. am Neckar, OA. Glatt) führen
auch ein anderes Wappen (Beil und Flug); s. Zeitschr.
f. Oberrh. XV 379, XVI 123, XVIII 438; Schreiber,
Freib. Urkbch. I Taf. VI 9; dasselbe ohne Bezeichnung
in der Zur. Rolle n. 515. — Für I und II ist der Vor-
name Heinrich in der für den Dichter in Betracht kom-
menden Zeit nachgewiesen. Da nun ein Aargauer Hein-
rich von Tettingen in einer Urk. von 1267 in Verbin-
dung mit Walther von Klingen und Berthold Steinmar
von Klingnau erscheint, so nimmt Socin an, dass das
Döttingen bei Klingnau als die Heimath unseres Minne-
sängers anzusehen ist.
Hagen IV n. 122; Bartsch SM S. CII; Baechtold
S. 154; Grimme, Germania 35, 320 fr.; Socin, Germania
36, 312.
Tafel LVIL
1. Meister Johannes Hadlaub. Blatt 371')-
Bürgerlicher Dichter, in Zürich wohnhaft, wo er
mit den Manesse, namentlich Rüdiger It. (gest. 3. Sept.
1304) befreundet war; in einem Liede spricht Hadlaub
von dem Sohne dieses Rüdiger, Johannes, als eines be-
reits Verstorbenen; dieser starb am 20. Mai 1297.
Unter den Persönlichkeiten, zu welchen er dort in Be-
ziehung stand, nennt er z. B. den Fürstbischof von
Konstanz, Heinrich von Klingenberg (t 1306); vgl. meine
Bemerkungen in der Westd. Zeitschrift VII 326. 329 fr.
und Schleicher S. 8ff. — Urkundlich ist H. in Zürich
für 1302 nachgewiesen (s. Baechtold S. 43 und Schleicher
S. 5). Er starb an einem 16. März und zwar vor 1340.
— Ihm ist hier trotz seiner bürgerlichen Abkunft, ebenso
wie dem Regenbogen (Taf. 57, 2) ein Wappenschild bei-
gelegt, aber kein Helm.
Die Züricher Rolle n. 478 (ohne Namen) giebt
denselben Wappenschild (nur nagt das Eichhörnchen an
einem rothen kugelförmigen Gegenstände und steht auf
einem grünen Dreiberge); es ist in der ganzen Rolle der
einzige Schild ohne Oberwappen (Weiss S. 5). Danach
liegt in C keinesfalls „eine willkürliche Schöpfung des
Malers des Bildes" vor, wie Schleicher S. 7 als mög-
lich hinstellte. Denn dass die Züricher Rolle (welche
Schi, übrigens nicht erwähnt) unseren Codex benutzt
habe, ist nicht bewiesen. Höchstens könnte also eine
unrichtige Uebertragung des Wappens auf Hadlaub an-
genommen werden, wenn es einer anderen Familie an-
gehört haben sollte, — davon ist aber nichts bekannt.
Hagen IV. n. 125; Bartsch DL S. LXXI, SM S.
CLXXXIV; Baechtold S. 164 und Anm. S. 43; I. A.
Schleicher, über Meister Joh. Hadlaubs Leben u. Ge-
dichte, Leipziger Diss., Bonn 1888. — Das Gemälde
hat Baechtold im Zur. Taschenbuch 1883 nach S. 228
verkleinert abgebildet.
*) Nicht auf der Rückseite des Blattes 371, wie Schleicher
S. 15 angiebt.
2. Der Regenbog. Blatt 38t.
So steht im Register; über dem Texte: „Regenbog",
ebenda die Vorschrift: „Regenboge". Das Bild selbst
entbehrt der Aufschrift.
Der Regenbogen war ein bürgerlicher Dichter (trotz
des Wappens; vgl. Grimme, Germania 33,444). Er
stand mit Frauenlob in litterarischem Verkehr, wohl
um 1300. Dass er Schmied war, bezeugt das Ge-
mälde unserer Handschrift und die Tradition der
Meistersänger, ob aber wirklich Hufschmied, wie be-
richtet wird, und nicht vielleicht Goldschmied, bleibt
unsicher. „Dieselbe wenig glaubwürdige Tradition giebt
ihm auch den Vornamen Barthel (Bartholomäus), selten
Berthold, und verlegt seine Heimath nach Mainz
oder Ulm" (Roethe). Dass er den 1318 gestorbenen
Frauenlob [s. zu Taf. 58,2] überlebte, würde seine die-
sem gewidmete Todten klage beweisen, ihre Echtheit ist
aber nicht unzweifelhaft (Roethe). Grimme hat einen
Reinbolt Regenboge in Speier 1336 (Hilgard, Urk. 1885
S. 492, 38) nachgewiesen. Ein sicherer Schluss auf die
Heimath des Dichters ist daraus aber nicht zu ziehen.
Hagen IV n. 126; Bartsch DL S. LXXIII; Grimme,
Germania 32, 417; Roethe, Allg. Biogr. 2J, 547.
nannten Rittergesclilechte angehörte. Es wird vermuthet,
dass der Dichter identisch ist mit dem Konrad von
Buwenburg, welcher in einer Urkunde vom i. August
1314 als Geistlicher und Sänger im Kloster Einsiedeln
vorkommt und bei dem Ueberfall dieses Klosters durch
die Schwyzer am 6. Januar 1314 erwähnt wird mit
der Bezeichnung senex. Auf dem Gemälde unserer
Handschrift soll dieses Ereigniss und speziell der aus-
drücklich bezeugte Raub der Rinder dargestellt sein.
Konrad von B. ist ausserdem noch i. J. 1282 urkundlich
nachgewiesen (s. Baechtold).
Hagen IV n. 121; Bartsch DL S. LXXII, SM S.
CXLVII; Baechtold S. 159 u. Anm. S. 42; Grimme,
Germania 35, 330.
Zürich n. 402 („Buwenburg") giebt ein anderes
Wappen (in Schwarz 3 silb. Muscheln*, und wieder
ein anderes W. (eine Zange) zeigen die Siegel derer
von B.; s. Fürstenb. Urkbch. II n. 279; Freib. Diöcesan-
archiv 12, 144; vgl. Kindler von Knobloch, das gold.
Buch S. 54 u. 460.
2. Heinrich von Tettingen. Blatt 361.
„Tetinge(n)" in beiden Vorschriften.
Die Heimath des Dichters, welcher wohl der 2.
Hälfte des XIII. Jahrh. angehört, ist fraglich. In Be-
tracht zu ziehen sind wahrscheinlich vor anderen I) das
Geschlecht im Aargau (Döttingen oberhalb Klingnau),
und II) das am Bodensee (Dettingen in Baden, nordw.
von der Mainau). Das Wappen von II ist ein an-
deres als das unserer Hs. (Roth v. Schreckenstein, die
Insel Mainau 333; Grünenberg Taf. 138 mit: ,,von Tet-
tingen im Hegy" [= Hegau] ; Zur. Rolle n. 184; v.
Weech, cod. Salem. II p. 487 u. Abb. n. 197; Fürstenb.
Urk. V n. 471), und für I wird von Siebmacher eben
dasselbe Wappen angegeben, welches für II nachgewiesen
ist. Danach müsste man I und II für dieselbe Familie
halten oder aber annehmen, dass Siebmacher das Wappen
von II auf I irrthümlich übertragen hat und also das von
I noch unbekannt ist (Grimme 321). — III) die Hohen-
zollerschen Dettingen (D. am Neckar, OA. Glatt) führen
auch ein anderes Wappen (Beil und Flug); s. Zeitschr.
f. Oberrh. XV 379, XVI 123, XVIII 438; Schreiber,
Freib. Urkbch. I Taf. VI 9; dasselbe ohne Bezeichnung
in der Zur. Rolle n. 515. — Für I und II ist der Vor-
name Heinrich in der für den Dichter in Betracht kom-
menden Zeit nachgewiesen. Da nun ein Aargauer Hein-
rich von Tettingen in einer Urk. von 1267 in Verbin-
dung mit Walther von Klingen und Berthold Steinmar
von Klingnau erscheint, so nimmt Socin an, dass das
Döttingen bei Klingnau als die Heimath unseres Minne-
sängers anzusehen ist.
Hagen IV n. 122; Bartsch SM S. CII; Baechtold
S. 154; Grimme, Germania 35, 320 fr.; Socin, Germania
36, 312.
Tafel LVIL
1. Meister Johannes Hadlaub. Blatt 371')-
Bürgerlicher Dichter, in Zürich wohnhaft, wo er
mit den Manesse, namentlich Rüdiger It. (gest. 3. Sept.
1304) befreundet war; in einem Liede spricht Hadlaub
von dem Sohne dieses Rüdiger, Johannes, als eines be-
reits Verstorbenen; dieser starb am 20. Mai 1297.
Unter den Persönlichkeiten, zu welchen er dort in Be-
ziehung stand, nennt er z. B. den Fürstbischof von
Konstanz, Heinrich von Klingenberg (t 1306); vgl. meine
Bemerkungen in der Westd. Zeitschrift VII 326. 329 fr.
und Schleicher S. 8ff. — Urkundlich ist H. in Zürich
für 1302 nachgewiesen (s. Baechtold S. 43 und Schleicher
S. 5). Er starb an einem 16. März und zwar vor 1340.
— Ihm ist hier trotz seiner bürgerlichen Abkunft, ebenso
wie dem Regenbogen (Taf. 57, 2) ein Wappenschild bei-
gelegt, aber kein Helm.
Die Züricher Rolle n. 478 (ohne Namen) giebt
denselben Wappenschild (nur nagt das Eichhörnchen an
einem rothen kugelförmigen Gegenstände und steht auf
einem grünen Dreiberge); es ist in der ganzen Rolle der
einzige Schild ohne Oberwappen (Weiss S. 5). Danach
liegt in C keinesfalls „eine willkürliche Schöpfung des
Malers des Bildes" vor, wie Schleicher S. 7 als mög-
lich hinstellte. Denn dass die Züricher Rolle (welche
Schi, übrigens nicht erwähnt) unseren Codex benutzt
habe, ist nicht bewiesen. Höchstens könnte also eine
unrichtige Uebertragung des Wappens auf Hadlaub an-
genommen werden, wenn es einer anderen Familie an-
gehört haben sollte, — davon ist aber nichts bekannt.
Hagen IV. n. 125; Bartsch DL S. LXXI, SM S.
CLXXXIV; Baechtold S. 164 und Anm. S. 43; I. A.
Schleicher, über Meister Joh. Hadlaubs Leben u. Ge-
dichte, Leipziger Diss., Bonn 1888. — Das Gemälde
hat Baechtold im Zur. Taschenbuch 1883 nach S. 228
verkleinert abgebildet.
*) Nicht auf der Rückseite des Blattes 371, wie Schleicher
S. 15 angiebt.
2. Der Regenbog. Blatt 38t.
So steht im Register; über dem Texte: „Regenbog",
ebenda die Vorschrift: „Regenboge". Das Bild selbst
entbehrt der Aufschrift.
Der Regenbogen war ein bürgerlicher Dichter (trotz
des Wappens; vgl. Grimme, Germania 33,444). Er
stand mit Frauenlob in litterarischem Verkehr, wohl
um 1300. Dass er Schmied war, bezeugt das Ge-
mälde unserer Handschrift und die Tradition der
Meistersänger, ob aber wirklich Hufschmied, wie be-
richtet wird, und nicht vielleicht Goldschmied, bleibt
unsicher. „Dieselbe wenig glaubwürdige Tradition giebt
ihm auch den Vornamen Barthel (Bartholomäus), selten
Berthold, und verlegt seine Heimath nach Mainz
oder Ulm" (Roethe). Dass er den 1318 gestorbenen
Frauenlob [s. zu Taf. 58,2] überlebte, würde seine die-
sem gewidmete Todten klage beweisen, ihre Echtheit ist
aber nicht unzweifelhaft (Roethe). Grimme hat einen
Reinbolt Regenboge in Speier 1336 (Hilgard, Urk. 1885
S. 492, 38) nachgewiesen. Ein sicherer Schluss auf die
Heimath des Dichters ist daraus aber nicht zu ziehen.
Hagen IV n. 126; Bartsch DL S. LXXIII; Grimme,
Germania 32, 417; Roethe, Allg. Biogr. 2J, 547.