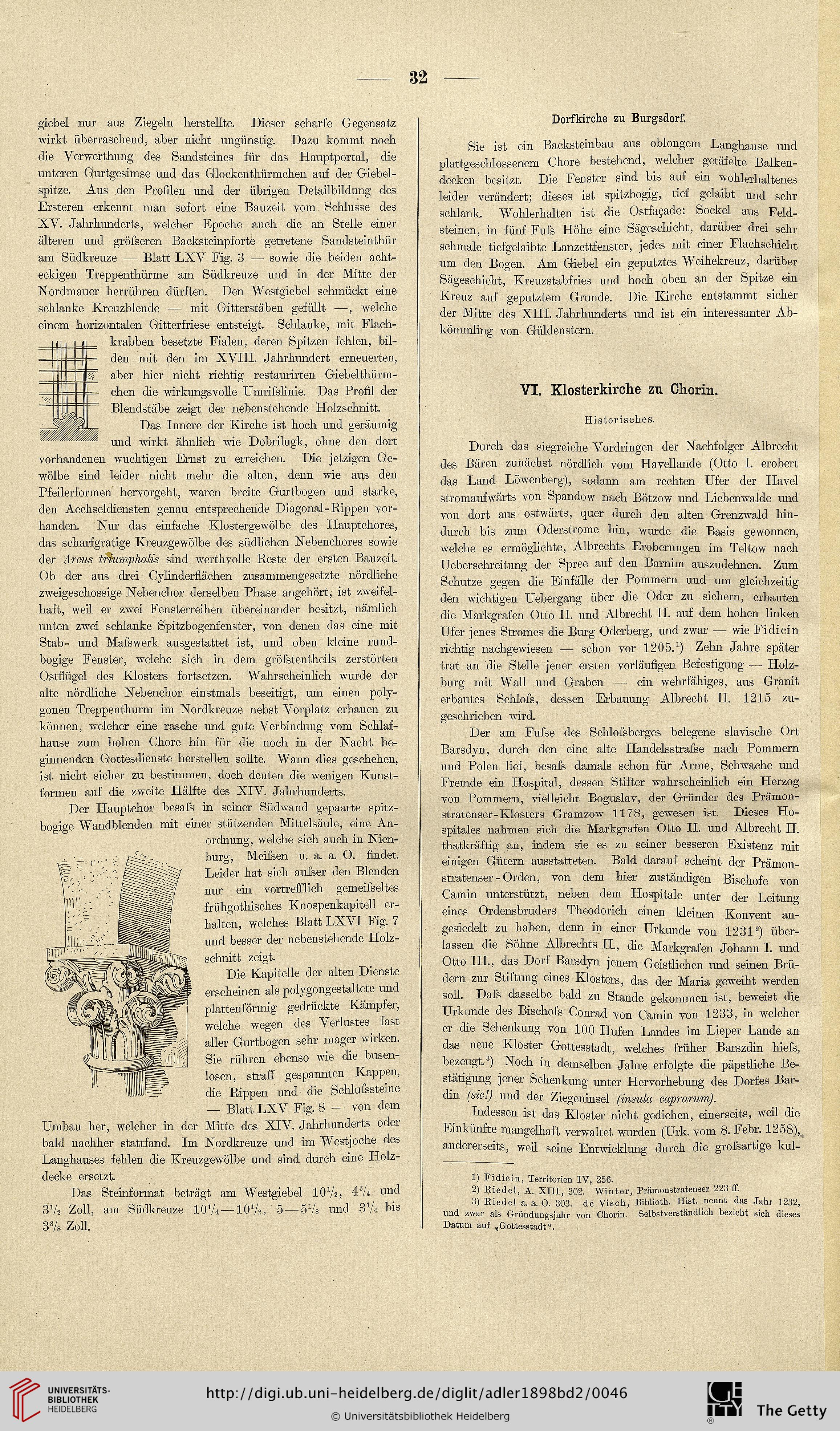82
giebel nur aus Ziegeln herstellte. Dieser scharfe Gegensatz
wirkt überraschend, aher nicht ungünstig. Dazu kommt noch
die Verwerthung des Sandsteines für das Hauptportal, die
unteren Gurtgesimse und das Glockenthürmchen auf der Giebel-
spitze. Aus den Profilen und der übrigen Detailbildung des
Ersteren erkennt man sofort eine Bauzeit vom Schlusse des
XV. Jahrhunderts, welcher Epoche auch die an Stelle einer
älteren und gröfseren Backsteinpforte getretene Sandsteinthür
am Stidkreuze — Blatt LXV Fig. 3 — sowie die beiden acht-
eckigen Treppenthiirme am Südkreuze und in der Mitte der
K ordmauer herrühren dürften. Den Westgiebel schmückt eine
schlanke Kreuzblende — mit Gitterstäben gefiillt —, welche
einem horizontalen Gitterfriese entsteigt. Sclilanke, mit Flach-
krahben besetzte Fialen, deren Spitzen fehlen, hil-
den mit den im XVIII. Jahrhundert erneuerten,
=i
j
j
1
'<% i
J
■
w
aher hier nicht richtig restaurirten Giehelthürm-
chen die wirkungsvolle Umrifslinie.
Das Profil der
Blendstäbe zeigt der nebenstehende Holzschnitt.
Das Innere der Kirche ist hoch und geräumig
und wirkt ähnlich wie Dobrilugk, ohne den dort
vorhandenen wuchtigen Ernst zu erreichen. Die jetzigen Ge-
wölbe sind leider nicht mehr die alten, denn wie aus den
Pfeilerformen hervorgeht, waren breite Gurtbogen und starke,
den Aecliseldiensten genau entsprecliende Diagonal-Bippen vor-
handen. Xur das einfache Klostergewölbe des Hauptchores,
das scharfgratige Kreuzgewölbe des südhchen Nebenchores sowie
der Arcus triumphalis sind werthvolle Reste der ersten Bauzeit.
Ob der aus drei Cylinderflächen zusammengesetzte nördliche
zweigeschossige Nehenchor derselben Pliase angehört, ist zweifel-
haft, weil er zwei Fensterreihen übereinander besitzt, nämlich
unten zwei schlanke Spitzhogenfenster, von denen das eine mit
Stab- und Mafswerk ausgestattet ist, und oben kleine rund-
bogige Fenster, welche sich in dem gröfstentheils zerstörten
Ostflügel des Klosters fortsetzen. Wahrscheinlicli wurde der
alte nördliche Nebenchor einstmals beseitigt, um einen poly-
gonen Treppenthurm im Nordkreuze nebst Vorplatz erbauen zu
können, welcher eine rasche und gute Verbindung vom Schlaf-
hause zum holxen Chore hin für die noch in der Nacht be-
ginnenden Gottesdienste herstellen sollte. Wann dies geschelien,
ist nicht sicher zu bestimmen, docli deuten die wenigen Kunst-
formen auf die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts.
Der Hauptchor besafs in seiner Südwand gepaarte spitz-
bogige Wandblenden mit einer stützenden Mittelsäule, eine An-
ordnung, welclie siclx auch in Nien-
burg, Meifsen u. a. a. O. findet.
Leider hat sicli aufser den Blenden
nur ein vortrefflich gemeifseltes
frühgothisches Knospenkapitell er-
halten, welclies Blatt LXVI Fig. 7
und besser der nebenstehende Holz-
sclinitt zeigt.
Die Kapitelle der alten Dienste
erscheinen als polygongestaltete und
plattenförmig gedrückte Kämpfer,
welche wegen des Verlustes fast
aller Gurtbogen sehr mager wirken.
Sie rüliren ebenso wie die busen-
losen, straff gespannten Kappen,
die Rippen und die Schlufssteine
— Blatt LXV Fig. 8 — von dem
Umbau her, welcher in der Mitte des XIV. Jahrhunderts oder
bald nachlier stattfand. Im Nordkreuze und im Westjoclie des
Langhauses felilen die Kreuzgewölbe und sind durch eine Holz-
decke ersetzt.
Das Steinformat heträgt am Westgiebel UPA, 4 3A 11114
3V2 Zoll, am Südkreuze 10Vi — IOV2, 5 — 5Vs und 3Vi bis
3 3/s Zoll.
Dorfkirche zu Burgsdorf.
Sie ist ein Backsteinbau aus oblongem Langhause und
plattgeschlossenem Chore bestehend, welcher getäfelte Balken-
decken besitzt. Die Fenster sind bis auf ein wolilerhaltenes
leider verändert; dieses ist spitzbogig, tief gelaibt und selir
schlank. Wohlerhalten ist die Ostfacade: Sockel aus Feld-
steinen, in fünf Fufs Höhe eine Sägescliicht, darüber drei sehr
schmale tiefgelaibte Lanzettfenster, jedes mit einer Flachschicht
um den Bogen. Am Giebel ein geputztes Weihekreuz, darüber
Sägesehicht, Kreuzstabfries und hoch ohen an der Spitze ein
Kreuz auf geputztem Grunde. Die Kirche entstämmt sicher
der Mitte des XIII. Jahrhunderts und ist ein interessanter Ab-
kömmling von Güldenstern.
VI. Klosterkirclie zu Chorin.
Historisches.
Durch das siegreiche Vordringen der Nachfolger Albrecht
des Bären zunächst nördlicli vom Havellande (Otto I. erobert
das Land Löwenherg), sodann am rechten Ufer der Havel
stromaufwärts von Spandow nach Bötzow und Liebenwalde und
von dort aus ostwärts, quer durcli den alten Grenzwald liin-
durch bis zum Oderstrome liin, wurde die Basis gewonnen,
welche es ermöglichte, Albrechts Eroberungen im Teltow nacli
Ueherschreitung der Spree auf den Barnim auszudehnen. Zuin
Schutze gegen die Einfälle der Pommern und um gleichzeitig
den wichtigen Uebergang iiber die Oder zu sichern, erbauten
die Markgrafen Otto II. und Albrecht II. auf dem liohen linken
Ufer jenes Stromes die Burg Oderberg, und zwar — wie Fidicin
richtig nacbgewiesen — sclion vor 1205.') Zelin Jahre später
trat an die Stelle jener ersten vorläufigen Befestigimg — IIolz-
burg mit Wall imd Graben — ein wehrfähiges, aus Granit
erbautes Scldofs, dessen Erbauung Albreclit II. 1215 zu-
gescliriehen wird.
Der am Fufse des Schlofsberges belegene slavische Ort
Barsdyn, durch den eine alte Handelsstrafse nach Pommern
und Polen lief, besafs damals schon für Arme, Schwache und
Fremde ein Hospital, dessen Stifter wahrscheiulicli ein Herzog
von Pommern, vielleicht Boguslav, der Gründer des Prämon-
stratenser-Klosters Gramzow 1178, gewesen ist. Dieses Ho-
spitales nahrnen sich die Markgrafen Otto II. und Albreclit II.
thatkräftig an, indem sie es zu seiner besseren Existenz mit
einigen Gütern ausstatteten. Bald darauf scheint der Prämon-
stratenser- Orden, von dem liier zuständigen Bischofe von
Camin miterstützt, neben dem Hospitale imter der Leitung
eines Ordensbruders Theodorich einen ldeinen Konvent an-
gesiedelt zu haben, deim in einer Urkunde von 12 31 2) über-
lassen die Söhne Albiechts II., die Markgrafen Johann I. und
Otto III., das Doif Barsdyn jenem Geistlichen und seinen Brü-
dern zur Stiftung eines Klosters, das der Maria geweiht werden
soh. Dafs dasselbe bald zu Stande gekommen ist, beweist die
Urkunde des Bischofs Conrad von Camin von 1233, in welcher
er die Schenkung von 100 Hufen Landes im Lieper Lande an
das neue Kloster Gottesstadt, welches friiher Barszdin hiels,
bezeugt. 3) Noch in demselben Jahre erfolgte die päpstliche Be-
stätigung jener Schenkung unter Hervorhebung des Dorfes Bar-
din (sic!) und der Ziegeninsel (insula caprarum).
Indessen ist das Kloster nicht gediehen, einerseits, weil die
Einkünfte mangelhaft verwaltet wurden (Urk. vom 8. Febr. 1258),
andererseits, weil seine Entwicklung dmch die grofsartige kul-
1) Fidicin, Territorien IV, 256.
2) Eiedel, A. XIII, 302. Winter, Prämonstratenser 223 ff.
3) Eiedei a. a. O. 303. de Visch, Biblioth. Hist. nennt das Jahr 1232,
und zwar als Gründungsjahr von Chorin. Selbstverständlich bezieht sich dieses
Datum auf „Gottesstadt“.
giebel nur aus Ziegeln herstellte. Dieser scharfe Gegensatz
wirkt überraschend, aher nicht ungünstig. Dazu kommt noch
die Verwerthung des Sandsteines für das Hauptportal, die
unteren Gurtgesimse und das Glockenthürmchen auf der Giebel-
spitze. Aus den Profilen und der übrigen Detailbildung des
Ersteren erkennt man sofort eine Bauzeit vom Schlusse des
XV. Jahrhunderts, welcher Epoche auch die an Stelle einer
älteren und gröfseren Backsteinpforte getretene Sandsteinthür
am Stidkreuze — Blatt LXV Fig. 3 — sowie die beiden acht-
eckigen Treppenthiirme am Südkreuze und in der Mitte der
K ordmauer herrühren dürften. Den Westgiebel schmückt eine
schlanke Kreuzblende — mit Gitterstäben gefiillt —, welche
einem horizontalen Gitterfriese entsteigt. Sclilanke, mit Flach-
krahben besetzte Fialen, deren Spitzen fehlen, hil-
den mit den im XVIII. Jahrhundert erneuerten,
=i
j
j
1
'<% i
J
■
w
aher hier nicht richtig restaurirten Giehelthürm-
chen die wirkungsvolle Umrifslinie.
Das Profil der
Blendstäbe zeigt der nebenstehende Holzschnitt.
Das Innere der Kirche ist hoch und geräumig
und wirkt ähnlich wie Dobrilugk, ohne den dort
vorhandenen wuchtigen Ernst zu erreichen. Die jetzigen Ge-
wölbe sind leider nicht mehr die alten, denn wie aus den
Pfeilerformen hervorgeht, waren breite Gurtbogen und starke,
den Aecliseldiensten genau entsprecliende Diagonal-Bippen vor-
handen. Xur das einfache Klostergewölbe des Hauptchores,
das scharfgratige Kreuzgewölbe des südhchen Nebenchores sowie
der Arcus triumphalis sind werthvolle Reste der ersten Bauzeit.
Ob der aus drei Cylinderflächen zusammengesetzte nördliche
zweigeschossige Nehenchor derselben Pliase angehört, ist zweifel-
haft, weil er zwei Fensterreihen übereinander besitzt, nämlich
unten zwei schlanke Spitzhogenfenster, von denen das eine mit
Stab- und Mafswerk ausgestattet ist, und oben kleine rund-
bogige Fenster, welche sich in dem gröfstentheils zerstörten
Ostflügel des Klosters fortsetzen. Wahrscheinlicli wurde der
alte nördliche Nebenchor einstmals beseitigt, um einen poly-
gonen Treppenthurm im Nordkreuze nebst Vorplatz erbauen zu
können, welcher eine rasche und gute Verbindung vom Schlaf-
hause zum holxen Chore hin für die noch in der Nacht be-
ginnenden Gottesdienste herstellen sollte. Wann dies geschelien,
ist nicht sicher zu bestimmen, docli deuten die wenigen Kunst-
formen auf die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts.
Der Hauptchor besafs in seiner Südwand gepaarte spitz-
bogige Wandblenden mit einer stützenden Mittelsäule, eine An-
ordnung, welclie siclx auch in Nien-
burg, Meifsen u. a. a. O. findet.
Leider hat sicli aufser den Blenden
nur ein vortrefflich gemeifseltes
frühgothisches Knospenkapitell er-
halten, welclies Blatt LXVI Fig. 7
und besser der nebenstehende Holz-
sclinitt zeigt.
Die Kapitelle der alten Dienste
erscheinen als polygongestaltete und
plattenförmig gedrückte Kämpfer,
welche wegen des Verlustes fast
aller Gurtbogen sehr mager wirken.
Sie rüliren ebenso wie die busen-
losen, straff gespannten Kappen,
die Rippen und die Schlufssteine
— Blatt LXV Fig. 8 — von dem
Umbau her, welcher in der Mitte des XIV. Jahrhunderts oder
bald nachlier stattfand. Im Nordkreuze und im Westjoclie des
Langhauses felilen die Kreuzgewölbe und sind durch eine Holz-
decke ersetzt.
Das Steinformat heträgt am Westgiebel UPA, 4 3A 11114
3V2 Zoll, am Südkreuze 10Vi — IOV2, 5 — 5Vs und 3Vi bis
3 3/s Zoll.
Dorfkirche zu Burgsdorf.
Sie ist ein Backsteinbau aus oblongem Langhause und
plattgeschlossenem Chore bestehend, welcher getäfelte Balken-
decken besitzt. Die Fenster sind bis auf ein wolilerhaltenes
leider verändert; dieses ist spitzbogig, tief gelaibt und selir
schlank. Wohlerhalten ist die Ostfacade: Sockel aus Feld-
steinen, in fünf Fufs Höhe eine Sägescliicht, darüber drei sehr
schmale tiefgelaibte Lanzettfenster, jedes mit einer Flachschicht
um den Bogen. Am Giebel ein geputztes Weihekreuz, darüber
Sägesehicht, Kreuzstabfries und hoch ohen an der Spitze ein
Kreuz auf geputztem Grunde. Die Kirche entstämmt sicher
der Mitte des XIII. Jahrhunderts und ist ein interessanter Ab-
kömmling von Güldenstern.
VI. Klosterkirclie zu Chorin.
Historisches.
Durch das siegreiche Vordringen der Nachfolger Albrecht
des Bären zunächst nördlicli vom Havellande (Otto I. erobert
das Land Löwenherg), sodann am rechten Ufer der Havel
stromaufwärts von Spandow nach Bötzow und Liebenwalde und
von dort aus ostwärts, quer durcli den alten Grenzwald liin-
durch bis zum Oderstrome liin, wurde die Basis gewonnen,
welche es ermöglichte, Albrechts Eroberungen im Teltow nacli
Ueherschreitung der Spree auf den Barnim auszudehnen. Zuin
Schutze gegen die Einfälle der Pommern und um gleichzeitig
den wichtigen Uebergang iiber die Oder zu sichern, erbauten
die Markgrafen Otto II. und Albrecht II. auf dem liohen linken
Ufer jenes Stromes die Burg Oderberg, und zwar — wie Fidicin
richtig nacbgewiesen — sclion vor 1205.') Zelin Jahre später
trat an die Stelle jener ersten vorläufigen Befestigimg — IIolz-
burg mit Wall imd Graben — ein wehrfähiges, aus Granit
erbautes Scldofs, dessen Erbauung Albreclit II. 1215 zu-
gescliriehen wird.
Der am Fufse des Schlofsberges belegene slavische Ort
Barsdyn, durch den eine alte Handelsstrafse nach Pommern
und Polen lief, besafs damals schon für Arme, Schwache und
Fremde ein Hospital, dessen Stifter wahrscheiulicli ein Herzog
von Pommern, vielleicht Boguslav, der Gründer des Prämon-
stratenser-Klosters Gramzow 1178, gewesen ist. Dieses Ho-
spitales nahrnen sich die Markgrafen Otto II. und Albreclit II.
thatkräftig an, indem sie es zu seiner besseren Existenz mit
einigen Gütern ausstatteten. Bald darauf scheint der Prämon-
stratenser- Orden, von dem liier zuständigen Bischofe von
Camin miterstützt, neben dem Hospitale imter der Leitung
eines Ordensbruders Theodorich einen ldeinen Konvent an-
gesiedelt zu haben, deim in einer Urkunde von 12 31 2) über-
lassen die Söhne Albiechts II., die Markgrafen Johann I. und
Otto III., das Doif Barsdyn jenem Geistlichen und seinen Brü-
dern zur Stiftung eines Klosters, das der Maria geweiht werden
soh. Dafs dasselbe bald zu Stande gekommen ist, beweist die
Urkunde des Bischofs Conrad von Camin von 1233, in welcher
er die Schenkung von 100 Hufen Landes im Lieper Lande an
das neue Kloster Gottesstadt, welches friiher Barszdin hiels,
bezeugt. 3) Noch in demselben Jahre erfolgte die päpstliche Be-
stätigung jener Schenkung unter Hervorhebung des Dorfes Bar-
din (sic!) und der Ziegeninsel (insula caprarum).
Indessen ist das Kloster nicht gediehen, einerseits, weil die
Einkünfte mangelhaft verwaltet wurden (Urk. vom 8. Febr. 1258),
andererseits, weil seine Entwicklung dmch die grofsartige kul-
1) Fidicin, Territorien IV, 256.
2) Eiedel, A. XIII, 302. Winter, Prämonstratenser 223 ff.
3) Eiedei a. a. O. 303. de Visch, Biblioth. Hist. nennt das Jahr 1232,
und zwar als Gründungsjahr von Chorin. Selbstverständlich bezieht sich dieses
Datum auf „Gottesstadt“.