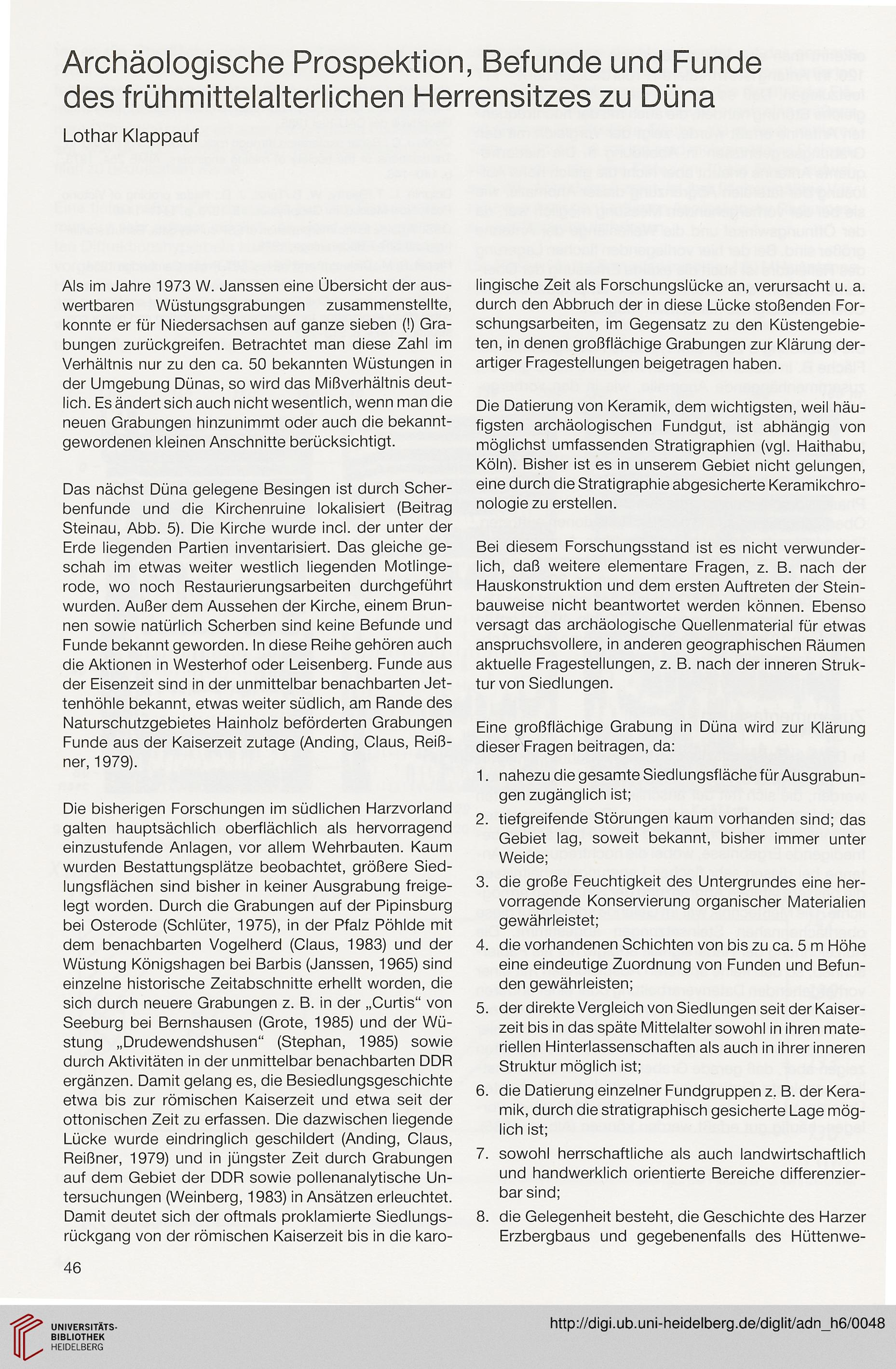Archäologische Prospektion, Befunde und Funde
des frühmittelalterlichen Herrensitzes zu Düna
Lothar Klappauf
Als im Jahre 1973 W. Janssen eine Übersicht der aus-
wertbaren Wüstungsgrabungen zusammenstellte,
konnte er für Niedersachsen auf ganze sieben (!) Gra-
bungen zurückgreifen. Betrachtet man diese Zahl im
Verhältnis nur zu den ca. 50 bekannten Wüstungen in
der Umgebung Dünas, so wird das Mißverhältnis deut-
lich. Es ändert sich auch nicht wesentlich, wenn man die
neuen Grabungen hinzunimmt oder auch die bekannt-
gewordenen kleinen Anschnitte berücksichtigt.
Das nächst Düna gelegene Besingen ist durch Scher-
benfunde und die Kirchenruine lokalisiert (Beitrag
Steinau, Abb. 5). Die Kirche wurde incl. der unter der
Erde liegenden Partien inventarisiert. Das gleiche ge-
schah im etwas weiter westlich liegenden Motlinge-
rode, wo noch Restaurierungsarbeiten durchgeführt
wurden. Außer dem Aussehen der Kirche, einem Brun-
nen sowie natürlich Scherben sind keine Befunde und
Funde bekannt geworden. In diese Reihe gehören auch
die Aktionen in Westerhof oder Leisenberg. Funde aus
der Eisenzeit sind in der unmittelbar benachbarten Jet-
tenhöhle bekannt, etwas weiter südlich, am Rande des
Naturschutzgebietes Hainholz beförderten Grabungen
Funde aus der Kaiserzeit zutage (Anding, Claus, Reiß-
ner, 1979).
Die bisherigen Forschungen im südlichen Harzvorland
galten hauptsächlich oberflächlich als hervorragend
einzustufende Anlagen, vor allem Wehrbauten. Kaum
wurden Bestattungsplätze beobachtet, größere Sied-
lungsflächen sind bisher in keiner Ausgrabung freige-
legt worden. Durch die Grabungen auf der Pipinsburg
bei Osterode (Schlüter, 1975), in der Pfalz Pöhlde mit
dem benachbarten Vogelherd (Claus, 1983) und der
Wüstung Königshagen bei Barbis (Janssen, 1965) sind
einzelne historische Zeitabschnitte erhellt worden, die
sich durch neuere Grabungen z. B. in der „Curtis“ von
Seeburg bei Bernshausen (Grote, 1985) und der Wü-
stung „Drudewendshusen“ (Stephan, 1985) sowie
durch Aktivitäten in der unmittelbar benachbarten DDR
ergänzen. Damit gelang es, die Besiedlungsgeschichte
etwa bis zur römischen Kaiserzeit und etwa seit der
ottonischen Zeit zu erfassen. Die dazwischen liegende
Lücke wurde eindringlich geschildert (Anding, Claus,
Reißner, 1979) und in jüngster Zeit durch Grabungen
auf dem Gebiet der DDR sowie pollenanalytische Un-
tersuchungen (Weinberg, 1983) in Ansätzen erleuchtet.
Damit deutet sich der oftmals proklamierte Siedlungs-
rückgang von der römischen Kaiserzeit bis in die karo-
lingische Zeit als Forschungslücke an, verursacht u. a.
durch den Abbruch der in diese Lücke stoßenden For-
schungsarbeiten, im Gegensatz zu den Küstengebie-
ten, in denen großflächige Grabungen zur Klärung der-
artiger Fragestellungen beigetragen haben.
Die Datierung von Keramik, dem wichtigsten, weil häu-
figsten archäologischen Fundgut, ist abhängig von
möglichst umfassenden Stratigraphien (vgl. Haithabu,
Köln). Bisher ist es in unserem Gebiet nicht gelungen,
eine durch die Stratigraphie abgesicherte Keramikchro-
nologie zu erstellen.
Bei diesem Forschungsstand ist es nicht verwunder-
lich, daß weitere elementare Fragen, z. B. nach der
Hauskonstruktion und dem ersten Auftreten der Stein-
bauweise nicht beantwortet werden können. Ebenso
versagt das archäologische Quellenmaterial für etwas
anspruchsvollere, in anderen geographischen Räumen
aktuelle Fragestellungen, z. B. nach der inneren Struk-
tur von Siedlungen.
Eine großflächige Grabung in Düna wird zur Klärung
dieser Fragen beitragen, da:
1. nahezu die gesamte Siedlungsfläche für Ausgrabun-
gen zugänglich ist;
2. tiefgreifende Störungen kaum vorhanden sind; das
Gebiet lag, soweit bekannt, bisher immer unter
Weide;
3. die große Feuchtigkeit des Untergrundes eine her-
vorragende Konservierung organischer Materialien
gewährleistet;
4. die vorhandenen Schichten von bis zu ca. 5 m Höhe
eine eindeutige Zuordnung von Funden und Befun-
den gewährleisten;
5. der direkte Vergleich von Siedlungen seit der Kaiser-
zeit bis in das späte Mittelalter sowohl in ihren mate-
riellen Hinterlassenschaften als auch in ihrer inneren
Struktur möglich ist;
6. die Datierung einzelner Fundgruppen z. B. der Kera-
mik, durch die stratigraphisch gesicherte Lage mög-
lich ist;
7. sowohl herrschaftliche als auch landwirtschaftlich
und handwerklich orientierte Bereiche differenzier-
bar sind;
8. die Gelegenheit besteht, die Geschichte des Harzer
Erzbergbaus und gegebenenfalls des Hüttenwe-
46
des frühmittelalterlichen Herrensitzes zu Düna
Lothar Klappauf
Als im Jahre 1973 W. Janssen eine Übersicht der aus-
wertbaren Wüstungsgrabungen zusammenstellte,
konnte er für Niedersachsen auf ganze sieben (!) Gra-
bungen zurückgreifen. Betrachtet man diese Zahl im
Verhältnis nur zu den ca. 50 bekannten Wüstungen in
der Umgebung Dünas, so wird das Mißverhältnis deut-
lich. Es ändert sich auch nicht wesentlich, wenn man die
neuen Grabungen hinzunimmt oder auch die bekannt-
gewordenen kleinen Anschnitte berücksichtigt.
Das nächst Düna gelegene Besingen ist durch Scher-
benfunde und die Kirchenruine lokalisiert (Beitrag
Steinau, Abb. 5). Die Kirche wurde incl. der unter der
Erde liegenden Partien inventarisiert. Das gleiche ge-
schah im etwas weiter westlich liegenden Motlinge-
rode, wo noch Restaurierungsarbeiten durchgeführt
wurden. Außer dem Aussehen der Kirche, einem Brun-
nen sowie natürlich Scherben sind keine Befunde und
Funde bekannt geworden. In diese Reihe gehören auch
die Aktionen in Westerhof oder Leisenberg. Funde aus
der Eisenzeit sind in der unmittelbar benachbarten Jet-
tenhöhle bekannt, etwas weiter südlich, am Rande des
Naturschutzgebietes Hainholz beförderten Grabungen
Funde aus der Kaiserzeit zutage (Anding, Claus, Reiß-
ner, 1979).
Die bisherigen Forschungen im südlichen Harzvorland
galten hauptsächlich oberflächlich als hervorragend
einzustufende Anlagen, vor allem Wehrbauten. Kaum
wurden Bestattungsplätze beobachtet, größere Sied-
lungsflächen sind bisher in keiner Ausgrabung freige-
legt worden. Durch die Grabungen auf der Pipinsburg
bei Osterode (Schlüter, 1975), in der Pfalz Pöhlde mit
dem benachbarten Vogelherd (Claus, 1983) und der
Wüstung Königshagen bei Barbis (Janssen, 1965) sind
einzelne historische Zeitabschnitte erhellt worden, die
sich durch neuere Grabungen z. B. in der „Curtis“ von
Seeburg bei Bernshausen (Grote, 1985) und der Wü-
stung „Drudewendshusen“ (Stephan, 1985) sowie
durch Aktivitäten in der unmittelbar benachbarten DDR
ergänzen. Damit gelang es, die Besiedlungsgeschichte
etwa bis zur römischen Kaiserzeit und etwa seit der
ottonischen Zeit zu erfassen. Die dazwischen liegende
Lücke wurde eindringlich geschildert (Anding, Claus,
Reißner, 1979) und in jüngster Zeit durch Grabungen
auf dem Gebiet der DDR sowie pollenanalytische Un-
tersuchungen (Weinberg, 1983) in Ansätzen erleuchtet.
Damit deutet sich der oftmals proklamierte Siedlungs-
rückgang von der römischen Kaiserzeit bis in die karo-
lingische Zeit als Forschungslücke an, verursacht u. a.
durch den Abbruch der in diese Lücke stoßenden For-
schungsarbeiten, im Gegensatz zu den Küstengebie-
ten, in denen großflächige Grabungen zur Klärung der-
artiger Fragestellungen beigetragen haben.
Die Datierung von Keramik, dem wichtigsten, weil häu-
figsten archäologischen Fundgut, ist abhängig von
möglichst umfassenden Stratigraphien (vgl. Haithabu,
Köln). Bisher ist es in unserem Gebiet nicht gelungen,
eine durch die Stratigraphie abgesicherte Keramikchro-
nologie zu erstellen.
Bei diesem Forschungsstand ist es nicht verwunder-
lich, daß weitere elementare Fragen, z. B. nach der
Hauskonstruktion und dem ersten Auftreten der Stein-
bauweise nicht beantwortet werden können. Ebenso
versagt das archäologische Quellenmaterial für etwas
anspruchsvollere, in anderen geographischen Räumen
aktuelle Fragestellungen, z. B. nach der inneren Struk-
tur von Siedlungen.
Eine großflächige Grabung in Düna wird zur Klärung
dieser Fragen beitragen, da:
1. nahezu die gesamte Siedlungsfläche für Ausgrabun-
gen zugänglich ist;
2. tiefgreifende Störungen kaum vorhanden sind; das
Gebiet lag, soweit bekannt, bisher immer unter
Weide;
3. die große Feuchtigkeit des Untergrundes eine her-
vorragende Konservierung organischer Materialien
gewährleistet;
4. die vorhandenen Schichten von bis zu ca. 5 m Höhe
eine eindeutige Zuordnung von Funden und Befun-
den gewährleisten;
5. der direkte Vergleich von Siedlungen seit der Kaiser-
zeit bis in das späte Mittelalter sowohl in ihren mate-
riellen Hinterlassenschaften als auch in ihrer inneren
Struktur möglich ist;
6. die Datierung einzelner Fundgruppen z. B. der Kera-
mik, durch die stratigraphisch gesicherte Lage mög-
lich ist;
7. sowohl herrschaftliche als auch landwirtschaftlich
und handwerklich orientierte Bereiche differenzier-
bar sind;
8. die Gelegenheit besteht, die Geschichte des Harzer
Erzbergbaus und gegebenenfalls des Hüttenwe-
46