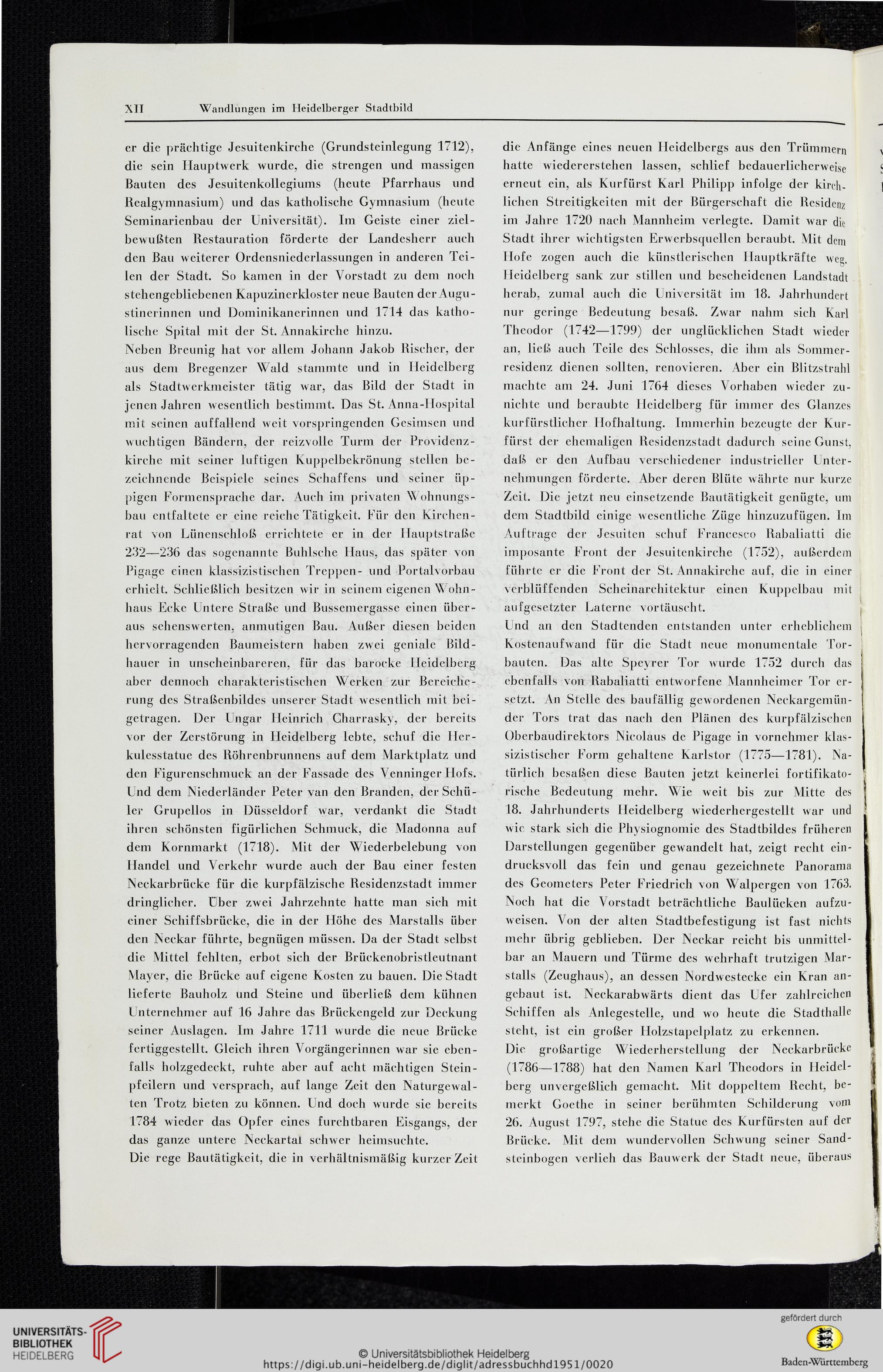XII
Wandlungen im Heidelberger Stadtbild
er die prächtige Jesuitenkirche (Grundsteinlegung 1712),
die sein Hauptwerk wurde, die strengen und massigen
Bauten des Jesuitenkollegiums (heute Pfarrhaus und
Realgymnasium) und das katholische Gymnasium (heute
Seminarienbau der Universität). Im Geiste einer ziel-
bewußten Restauration förderte der Landesherr auch
den Bau weiterer Ordensniederlassungen in anderen Tei-
len der Stadt. So kamen in der Vorstadt zu dem noch
stehengebliebenen Kapuzinerkloster neue Bauten der Augu-
stinerinnen und Dominikanerinnen und 1714 das katho-
lische Spital mit der St. Annakirche hinzu.
Neben Breunig hat vor allem Johann Jakob Rischer, der
aus dem Bregenzer Wald stammte und in Heidelberg
als Stadtwerkmeister tätig war, das Bild der Stadt in
jenen Jahren wesentlich bestimmt. Das St. Anna-Hospital
mit seinen auffallend weit vorspringenden Gesimsen und
wuchtigen Bändern, der reizvolle Turm der Providenz-
kirche mit seiner luftigen Kuppelbekrönung stellen be-
zeichnende Beispiele seines Schaffens und seiner üp-
pigen Formensprache dar. Auch im privaten Wohnungs-
bau entfaltete er eine reiche Tätigkeit. Für den Kirchen-
rat von Lünenschloß errichtete er in der Hauptstraße
232—236 das sogenannte Bübische Haus, das später von
Pigage einen klassizistischen Treppen- und Portalvorbau
erhielt. Schließlich besitzen wir in seinem eigenen Wohn-
haus Ecke Untere Straße und Bussemergasse einen über-
aus sehenswerten, anmutigen Bau. Außer diesen beiden
hervorragenden Baumeistern haben zwei geniale Bild-
hauer in unscheinbareren, für das barocke Heidelberg
aber dennoch charakteristischen Werken zur Bereiche-
rung des Straßenbildes unserer Stadt wesentlich mit bei-
getragen. Der Ungar Heinrich Gharrasky, der bereits
vor der Zerstörung in Heidelberg lebte, schuf die Her-
kulesstatue des Röhrenbrunnens auf dem Marktplatz und
den Figurenschmuck an der Fassade des Venninger Hofs.
Und dem Niederländer Peter van den Branden, der Schü-
ler Grupellos in Düsseldorf war, verdankt die Stadt
ihren schönsten figürlichen Schmuck, die Madonna auf
dem Kornmarkt (1718). Mit der Wiederbelebung von
Handel und Verkehr wurde auch der Bau einer festen
Neckarbrücke für die kurpfälzische Residenzstadt immer
dringlicher, über zwei Jahrzehnte hatte man sich mit
einer Schiffsbrücke, die in der Höhe des Marstalls über
den Neckar führte, begnügen müssen. Da der Stadt selbst
die Mittel fehlten, erbot sich der Brückenobristleutnant
Mayer, die Brücke auf eigene Kosten zu bauen. Die Stadt
lieferte Bauholz und Steine und überließ dem kühnen
Unternehmer auf 16 Jahre das Brückengeld zur Deckung
seiner Auslagen. Im Jahre 1711 wurde die neue Brücke
fertiggestellt. Gleich ihren Vorgängerinnen war sie eben-
falls holzgedeckt, ruhte aber auf acht mächtigen Stein-
pfeilern und versprach, auf lange Zeit den Naturgewal-
ten Trotz bieten zu können. Und doch wurde sie bereits
1784 wieder das Opfer eines furchtbaren Eisgangs, der
das ganze untere Neckartal schwer heimsuchte.
Die rege Bautätigkeit, die in verhältnismäßig kurzer Zeit
die Anfänge eines neuen Heidelbergs aus den Trümmern
hatte wiedererstehen lassen, schlief bedauerlicherweise
erneut ein, als Kurfürst Karl Philipp infolge der kirch-
lichen Streitigkeiten mit der Bürgerschaft die Residenz
im Jahre 1720 nach Mannheim verlegte. Damit war die
Stadt ihrer wichtigsten Erwerbsquellen beraubt. Mit dem
Hofe zogen auch die künstlerischen Hauptkräfte weg.
Heidelberg sank zur stillen und bescheidenen Landstadt
herab, zumal auch die Universität im 18. Jahrhundert
nur geringe Bedeutung besaß. Zwar nahm sich Karl
Theodor (1742—1799) der unglücklichen Stadt wieder
an, ließ auch Teile des Schlosses, die ihm als Sommer-
residenz dienen sollten, renovieren. Aber ein Blitzstrahl
machte am 24. Juni 1764 dieses Vorhaben wieder zu-
nichte und beraubte Heidelberg für immer des Glanzes
kurfürstlicher Hofhaltung. Immerhin bezeugte der Kur-
fürst der ehemaligen Residenzstadt dadurch seine Gunst,
daß er den Aufbau verschiedener industrieller Unter-
nehmungen förderte. Aber deren Blüte währte nur kurze
Zeit. Die jetzt neu einsetzende Bautätigkeit genügte, um
dem Stadtbild einige wesentliche Züge hinzuzufügen. Im
Auftrage der Jesuiten schuf Francesco Rabaliatti die
imposante Front der Jesuitenkirche (1752), außerdem
führte er die Front der St. Annakirche auf, die in einer
verblüffenden Scheinarchitektur einen Kuppelbau mit
aufgesetzter Laterne vortäuscht.
Und an den Stadtenden entstanden unter erheblichem
Kostenaufwand für die Stadt neue monumentale Tor-
bauten. Das alte Speyrer Tor wurde 1752 durch das
ebenfalls von Rabaliatti entworfene Mannheimer Tor er-
setzt. An Stelle des baufällig gewordenen Neckargemün-
der Tors trat das nach den Plänen des kurpfälzischen
Oberbaudirektors Nicolaus de Pigage in vornehmer klas-
sizistischer Form gehaltene Karlstor (1775—1781). Na-
türlich besaßen diese Bauten jetzt keinerlei fortifikato-
rische Bedeutung mehr. Wie weit bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts Heidelberg wiederhergestellt war und
wie stark sich die Physiognomie des Stadtbildes früheren
Darstellungen gegenüber gewandelt hat, zeigt recht ein-
drucksvoll das fein und genau gezeichnete Panorama
des Geometers Peter Friedrich von Walpergen von 1763.
Noch hat die Vorstadt beträchtliche Baulücken aufzu-
weisen. Von der alten Stadtbefestigung ist fast nichts
mehr übrig geblieben. Der Neckar reicht bis unmittel-
bar an Mauern und Türme des wehrhaft trutzigen Mar-
stalls (Zeughaus), an dessen Nordwestecke ein Kran an-
gebaut ist. Neckarabwärts dient das Ufer zahlreichen
Schiffen als Anlegestelle, und wo heute die Stadthalle
steht, ist ein großer Holzstapelplatz zu erkennen.
Die großartige Wiederherstellung der Neckarbrücke
(1786—1788) hat den Namen Karl Theodors in Heidel-
berg unvergeßlich gemacht. Mit doppeltem Recht, be-
merkt Goethe in seiner berühmten Schilderung vom
26. August 1797, stehe die Statue des Kurfürsten auf der
Brücke. Mit dem wundervollen Schwung seiner Sand-
steinbogen verlieh das Bauwerk der Stadt neue, überaus
Wandlungen im Heidelberger Stadtbild
er die prächtige Jesuitenkirche (Grundsteinlegung 1712),
die sein Hauptwerk wurde, die strengen und massigen
Bauten des Jesuitenkollegiums (heute Pfarrhaus und
Realgymnasium) und das katholische Gymnasium (heute
Seminarienbau der Universität). Im Geiste einer ziel-
bewußten Restauration förderte der Landesherr auch
den Bau weiterer Ordensniederlassungen in anderen Tei-
len der Stadt. So kamen in der Vorstadt zu dem noch
stehengebliebenen Kapuzinerkloster neue Bauten der Augu-
stinerinnen und Dominikanerinnen und 1714 das katho-
lische Spital mit der St. Annakirche hinzu.
Neben Breunig hat vor allem Johann Jakob Rischer, der
aus dem Bregenzer Wald stammte und in Heidelberg
als Stadtwerkmeister tätig war, das Bild der Stadt in
jenen Jahren wesentlich bestimmt. Das St. Anna-Hospital
mit seinen auffallend weit vorspringenden Gesimsen und
wuchtigen Bändern, der reizvolle Turm der Providenz-
kirche mit seiner luftigen Kuppelbekrönung stellen be-
zeichnende Beispiele seines Schaffens und seiner üp-
pigen Formensprache dar. Auch im privaten Wohnungs-
bau entfaltete er eine reiche Tätigkeit. Für den Kirchen-
rat von Lünenschloß errichtete er in der Hauptstraße
232—236 das sogenannte Bübische Haus, das später von
Pigage einen klassizistischen Treppen- und Portalvorbau
erhielt. Schließlich besitzen wir in seinem eigenen Wohn-
haus Ecke Untere Straße und Bussemergasse einen über-
aus sehenswerten, anmutigen Bau. Außer diesen beiden
hervorragenden Baumeistern haben zwei geniale Bild-
hauer in unscheinbareren, für das barocke Heidelberg
aber dennoch charakteristischen Werken zur Bereiche-
rung des Straßenbildes unserer Stadt wesentlich mit bei-
getragen. Der Ungar Heinrich Gharrasky, der bereits
vor der Zerstörung in Heidelberg lebte, schuf die Her-
kulesstatue des Röhrenbrunnens auf dem Marktplatz und
den Figurenschmuck an der Fassade des Venninger Hofs.
Und dem Niederländer Peter van den Branden, der Schü-
ler Grupellos in Düsseldorf war, verdankt die Stadt
ihren schönsten figürlichen Schmuck, die Madonna auf
dem Kornmarkt (1718). Mit der Wiederbelebung von
Handel und Verkehr wurde auch der Bau einer festen
Neckarbrücke für die kurpfälzische Residenzstadt immer
dringlicher, über zwei Jahrzehnte hatte man sich mit
einer Schiffsbrücke, die in der Höhe des Marstalls über
den Neckar führte, begnügen müssen. Da der Stadt selbst
die Mittel fehlten, erbot sich der Brückenobristleutnant
Mayer, die Brücke auf eigene Kosten zu bauen. Die Stadt
lieferte Bauholz und Steine und überließ dem kühnen
Unternehmer auf 16 Jahre das Brückengeld zur Deckung
seiner Auslagen. Im Jahre 1711 wurde die neue Brücke
fertiggestellt. Gleich ihren Vorgängerinnen war sie eben-
falls holzgedeckt, ruhte aber auf acht mächtigen Stein-
pfeilern und versprach, auf lange Zeit den Naturgewal-
ten Trotz bieten zu können. Und doch wurde sie bereits
1784 wieder das Opfer eines furchtbaren Eisgangs, der
das ganze untere Neckartal schwer heimsuchte.
Die rege Bautätigkeit, die in verhältnismäßig kurzer Zeit
die Anfänge eines neuen Heidelbergs aus den Trümmern
hatte wiedererstehen lassen, schlief bedauerlicherweise
erneut ein, als Kurfürst Karl Philipp infolge der kirch-
lichen Streitigkeiten mit der Bürgerschaft die Residenz
im Jahre 1720 nach Mannheim verlegte. Damit war die
Stadt ihrer wichtigsten Erwerbsquellen beraubt. Mit dem
Hofe zogen auch die künstlerischen Hauptkräfte weg.
Heidelberg sank zur stillen und bescheidenen Landstadt
herab, zumal auch die Universität im 18. Jahrhundert
nur geringe Bedeutung besaß. Zwar nahm sich Karl
Theodor (1742—1799) der unglücklichen Stadt wieder
an, ließ auch Teile des Schlosses, die ihm als Sommer-
residenz dienen sollten, renovieren. Aber ein Blitzstrahl
machte am 24. Juni 1764 dieses Vorhaben wieder zu-
nichte und beraubte Heidelberg für immer des Glanzes
kurfürstlicher Hofhaltung. Immerhin bezeugte der Kur-
fürst der ehemaligen Residenzstadt dadurch seine Gunst,
daß er den Aufbau verschiedener industrieller Unter-
nehmungen förderte. Aber deren Blüte währte nur kurze
Zeit. Die jetzt neu einsetzende Bautätigkeit genügte, um
dem Stadtbild einige wesentliche Züge hinzuzufügen. Im
Auftrage der Jesuiten schuf Francesco Rabaliatti die
imposante Front der Jesuitenkirche (1752), außerdem
führte er die Front der St. Annakirche auf, die in einer
verblüffenden Scheinarchitektur einen Kuppelbau mit
aufgesetzter Laterne vortäuscht.
Und an den Stadtenden entstanden unter erheblichem
Kostenaufwand für die Stadt neue monumentale Tor-
bauten. Das alte Speyrer Tor wurde 1752 durch das
ebenfalls von Rabaliatti entworfene Mannheimer Tor er-
setzt. An Stelle des baufällig gewordenen Neckargemün-
der Tors trat das nach den Plänen des kurpfälzischen
Oberbaudirektors Nicolaus de Pigage in vornehmer klas-
sizistischer Form gehaltene Karlstor (1775—1781). Na-
türlich besaßen diese Bauten jetzt keinerlei fortifikato-
rische Bedeutung mehr. Wie weit bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts Heidelberg wiederhergestellt war und
wie stark sich die Physiognomie des Stadtbildes früheren
Darstellungen gegenüber gewandelt hat, zeigt recht ein-
drucksvoll das fein und genau gezeichnete Panorama
des Geometers Peter Friedrich von Walpergen von 1763.
Noch hat die Vorstadt beträchtliche Baulücken aufzu-
weisen. Von der alten Stadtbefestigung ist fast nichts
mehr übrig geblieben. Der Neckar reicht bis unmittel-
bar an Mauern und Türme des wehrhaft trutzigen Mar-
stalls (Zeughaus), an dessen Nordwestecke ein Kran an-
gebaut ist. Neckarabwärts dient das Ufer zahlreichen
Schiffen als Anlegestelle, und wo heute die Stadthalle
steht, ist ein großer Holzstapelplatz zu erkennen.
Die großartige Wiederherstellung der Neckarbrücke
(1786—1788) hat den Namen Karl Theodors in Heidel-
berg unvergeßlich gemacht. Mit doppeltem Recht, be-
merkt Goethe in seiner berühmten Schilderung vom
26. August 1797, stehe die Statue des Kurfürsten auf der
Brücke. Mit dem wundervollen Schwung seiner Sand-
steinbogen verlieh das Bauwerk der Stadt neue, überaus