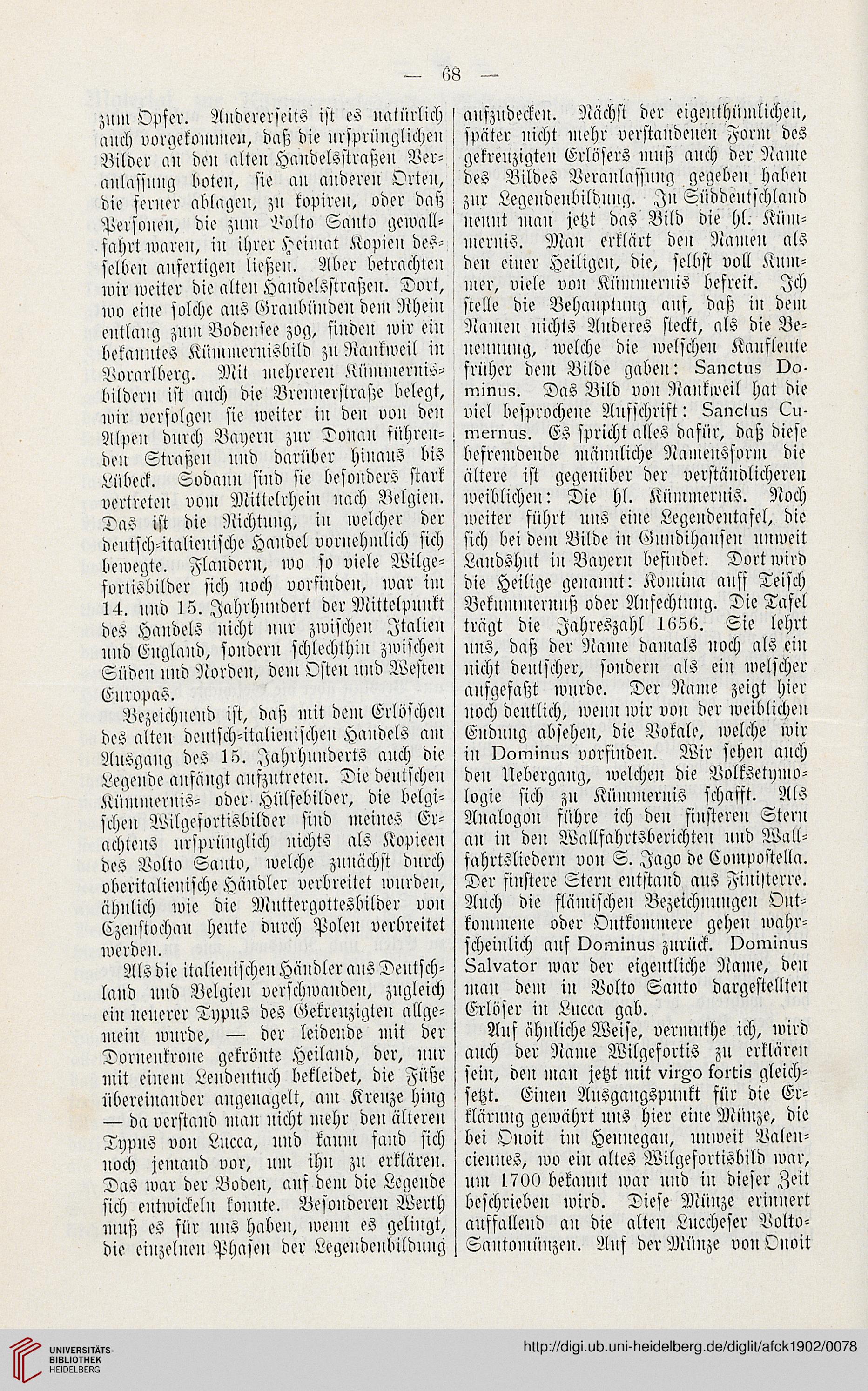zum Opfer. Andererseits ist es natürlich
auch vorgekommen, das; die ursprünglichen
Bilder an den alten Handelsstraßen Ver-
anlassung boten, sie an anderen Orten,
die ferner oblagen, zu kopiren, oder daß
Personen, die zum Volto Santo gewall-
fahrt waren, in ihrer Heimat Kopien des-
selben anfertigen ließen. Aber betrachten
wir weiter die alten Handelsstraßen. Dort,
nw eine solche aus Granbünden dem Rhein
entlang znm Bodensee zog, finden wir ein
bekanntes Kümmernisbild zu Rankweil in
Vorarlberg. Mit mehreren Kümmernis-
bildern ist auch die Brennerstraße belegt,
nur verfolgen sie weiter in den von den
Alpen durch Bayern zur Donau führen-
den Straßen und darüber hinaus bis
Lübeck. Sodann sind sie besonders stark
vertreten vom Mittelrhein nach Belgien.
Das ist die Richtung, in welcher der
deutsch-italienische Handel vornehmlich sich
bewegte. Flandern, wo so viele Wilge-
fortisbilder sich noch vorfinden, war im
14. und 15. Jahrhundert der Mittelpunkt
des Handels nicht nur zwischen Italien
und England, sondern schlechthin zwischen
Süden und Norden, dem Osten und Westen
Europas.
Bezeichnend ist, daß mit bem Erlöschen
des alten dentsch-italienischcn Handels am
Ausgang des 15. Jahrhunderts auch die
Legende anfängt anfzutreten. Die deutschen
Kümmernis- oder- Hülfebilder, die belgi-
schen Wilgefortisbilder sind meines Er-
achtens ursprünglich nichts als Kopieen
des Volto Santo, welche zunächst durch
oberitalienische Händler verbreitet wurden,
ähnlich wie die Mnttergottesbilder von
Ezenstochau heute durch Polen verbreitet
werden.
Als die italienischen Händler ans Deutsch-
land und Belgien verschwanden, zugleich
ein neuerer Typus des Gekreuzigten allge-
niein wurde, — der leidende mit der
Dornenkrone gekrönte Heiland, der, nur
mit einem Lendentuch bekleidet, die Füße
übereinander angenagelt, am Kreuze hing
— da verstand man nicht mehr den älteren
Typus von Lucca, und kaum fand sich
noch jemand vor, um ihn zu erklären.
Das war der Boden, auf dem die Legende
sich entwickeln konnte. Besonderen Werth
muß es für uns haben, wenn es gelingt,
die einzelnen Phasen der Legendenbildung
I anfzndecken. Nächst der eigenthümlichen,
I später nicht mehr verstandenen Form des
gekreuzigten Erlösers muß auch der N'aine
des Bildes Veranlassung gegeben haben
zur Legendenbildnng. In Süddeutschland
nennt man jetzt das Bild die hl. Küm-
mernis. Man erklärt den Namen als
den einer Heiligen, die, selbst voll Kum-
mer, viele von Kümmernis befreit. Ich
stelle die Behauptung ans, daß in dem
Namen nichts Anderes steckt, als die Be-
nennung, welche die welschen Kauflente
früher deni Bilde gaben: Sanctus Do-
minus. Das Bild von Rankweil hat die
viel besprochene Aufschrift: Sanctus Cu-
meraus. Es spricht alles dafür, daß diese
befremdende männliche Namensform die
ältere ist gegenüber der verständlicheren
weiblichen: Die hl. Kümmernis. Noch
weiter führt uns eine Legendentafel, die
sich bei dem Bilde in Gnndihansen unweit
Landshnt in Bayern befindet. Dort wird
die Heilige genannt: Komina aufs Teisch
Beknmmernnß oder Anfechtung. Die Tafel
trägt die Jahreszahl 1656. Sie lehrt
uns, daß der Name damals noch als ein
nicht deutscher, sondern als ein welscher
aufgefaßt wurde. Der Name zeigt hier
noch deutlich, wenn wir von der weiblichen
Endung absehen, die Vokale, welche wir
in Dominus vorfinden. Wir sehen auch
den liebergang, welchen die Volksetymo-
logie sich zu Kümmernis schafft. Als
Analogon führe ich den finsteren Stern
an in den Wallfahrtsberichten und Wall-
fahrtsliedern von S. Jago de Compostella.
Der finstere Stern entstand aus Finisterre.
Auch die flämischen Bezeichnungen Ont-
kommene oder Ontkommere gehen wahr-
scheinlich auf Dominus zurück. Dominus
Salvator war der eigentliche Name, den
man dem in Volto Santo dargestellten
Erlöser in Lncca gab.
Ans ähnliche Weise, vermnthe ich, wird
auch der Name Wilgefortis zu erklären
sein, den man jetzt mit virgo fortis gleich-
setzt. Einen Ausgangspunkt für die Er-
klärung gewährt uns hier eine Münze, die
bei Onoit im Hennegan, unweit Valen-
ciennes, wo ein altes Wilgefortisbild war,
um 1700 bekannt war und in dieser Zeit
beschrieben wird. Diese Münze erinnert
auffallend an die alten Luccheser Volto-
Santomünzen. Ans der Münze von Onoit
auch vorgekommen, das; die ursprünglichen
Bilder an den alten Handelsstraßen Ver-
anlassung boten, sie an anderen Orten,
die ferner oblagen, zu kopiren, oder daß
Personen, die zum Volto Santo gewall-
fahrt waren, in ihrer Heimat Kopien des-
selben anfertigen ließen. Aber betrachten
wir weiter die alten Handelsstraßen. Dort,
nw eine solche aus Granbünden dem Rhein
entlang znm Bodensee zog, finden wir ein
bekanntes Kümmernisbild zu Rankweil in
Vorarlberg. Mit mehreren Kümmernis-
bildern ist auch die Brennerstraße belegt,
nur verfolgen sie weiter in den von den
Alpen durch Bayern zur Donau führen-
den Straßen und darüber hinaus bis
Lübeck. Sodann sind sie besonders stark
vertreten vom Mittelrhein nach Belgien.
Das ist die Richtung, in welcher der
deutsch-italienische Handel vornehmlich sich
bewegte. Flandern, wo so viele Wilge-
fortisbilder sich noch vorfinden, war im
14. und 15. Jahrhundert der Mittelpunkt
des Handels nicht nur zwischen Italien
und England, sondern schlechthin zwischen
Süden und Norden, dem Osten und Westen
Europas.
Bezeichnend ist, daß mit bem Erlöschen
des alten dentsch-italienischcn Handels am
Ausgang des 15. Jahrhunderts auch die
Legende anfängt anfzutreten. Die deutschen
Kümmernis- oder- Hülfebilder, die belgi-
schen Wilgefortisbilder sind meines Er-
achtens ursprünglich nichts als Kopieen
des Volto Santo, welche zunächst durch
oberitalienische Händler verbreitet wurden,
ähnlich wie die Mnttergottesbilder von
Ezenstochau heute durch Polen verbreitet
werden.
Als die italienischen Händler ans Deutsch-
land und Belgien verschwanden, zugleich
ein neuerer Typus des Gekreuzigten allge-
niein wurde, — der leidende mit der
Dornenkrone gekrönte Heiland, der, nur
mit einem Lendentuch bekleidet, die Füße
übereinander angenagelt, am Kreuze hing
— da verstand man nicht mehr den älteren
Typus von Lucca, und kaum fand sich
noch jemand vor, um ihn zu erklären.
Das war der Boden, auf dem die Legende
sich entwickeln konnte. Besonderen Werth
muß es für uns haben, wenn es gelingt,
die einzelnen Phasen der Legendenbildung
I anfzndecken. Nächst der eigenthümlichen,
I später nicht mehr verstandenen Form des
gekreuzigten Erlösers muß auch der N'aine
des Bildes Veranlassung gegeben haben
zur Legendenbildnng. In Süddeutschland
nennt man jetzt das Bild die hl. Küm-
mernis. Man erklärt den Namen als
den einer Heiligen, die, selbst voll Kum-
mer, viele von Kümmernis befreit. Ich
stelle die Behauptung ans, daß in dem
Namen nichts Anderes steckt, als die Be-
nennung, welche die welschen Kauflente
früher deni Bilde gaben: Sanctus Do-
minus. Das Bild von Rankweil hat die
viel besprochene Aufschrift: Sanctus Cu-
meraus. Es spricht alles dafür, daß diese
befremdende männliche Namensform die
ältere ist gegenüber der verständlicheren
weiblichen: Die hl. Kümmernis. Noch
weiter führt uns eine Legendentafel, die
sich bei dem Bilde in Gnndihansen unweit
Landshnt in Bayern befindet. Dort wird
die Heilige genannt: Komina aufs Teisch
Beknmmernnß oder Anfechtung. Die Tafel
trägt die Jahreszahl 1656. Sie lehrt
uns, daß der Name damals noch als ein
nicht deutscher, sondern als ein welscher
aufgefaßt wurde. Der Name zeigt hier
noch deutlich, wenn wir von der weiblichen
Endung absehen, die Vokale, welche wir
in Dominus vorfinden. Wir sehen auch
den liebergang, welchen die Volksetymo-
logie sich zu Kümmernis schafft. Als
Analogon führe ich den finsteren Stern
an in den Wallfahrtsberichten und Wall-
fahrtsliedern von S. Jago de Compostella.
Der finstere Stern entstand aus Finisterre.
Auch die flämischen Bezeichnungen Ont-
kommene oder Ontkommere gehen wahr-
scheinlich auf Dominus zurück. Dominus
Salvator war der eigentliche Name, den
man dem in Volto Santo dargestellten
Erlöser in Lncca gab.
Ans ähnliche Weise, vermnthe ich, wird
auch der Name Wilgefortis zu erklären
sein, den man jetzt mit virgo fortis gleich-
setzt. Einen Ausgangspunkt für die Er-
klärung gewährt uns hier eine Münze, die
bei Onoit im Hennegan, unweit Valen-
ciennes, wo ein altes Wilgefortisbild war,
um 1700 bekannt war und in dieser Zeit
beschrieben wird. Diese Münze erinnert
auffallend an die alten Luccheser Volto-
Santomünzen. Ans der Münze von Onoit