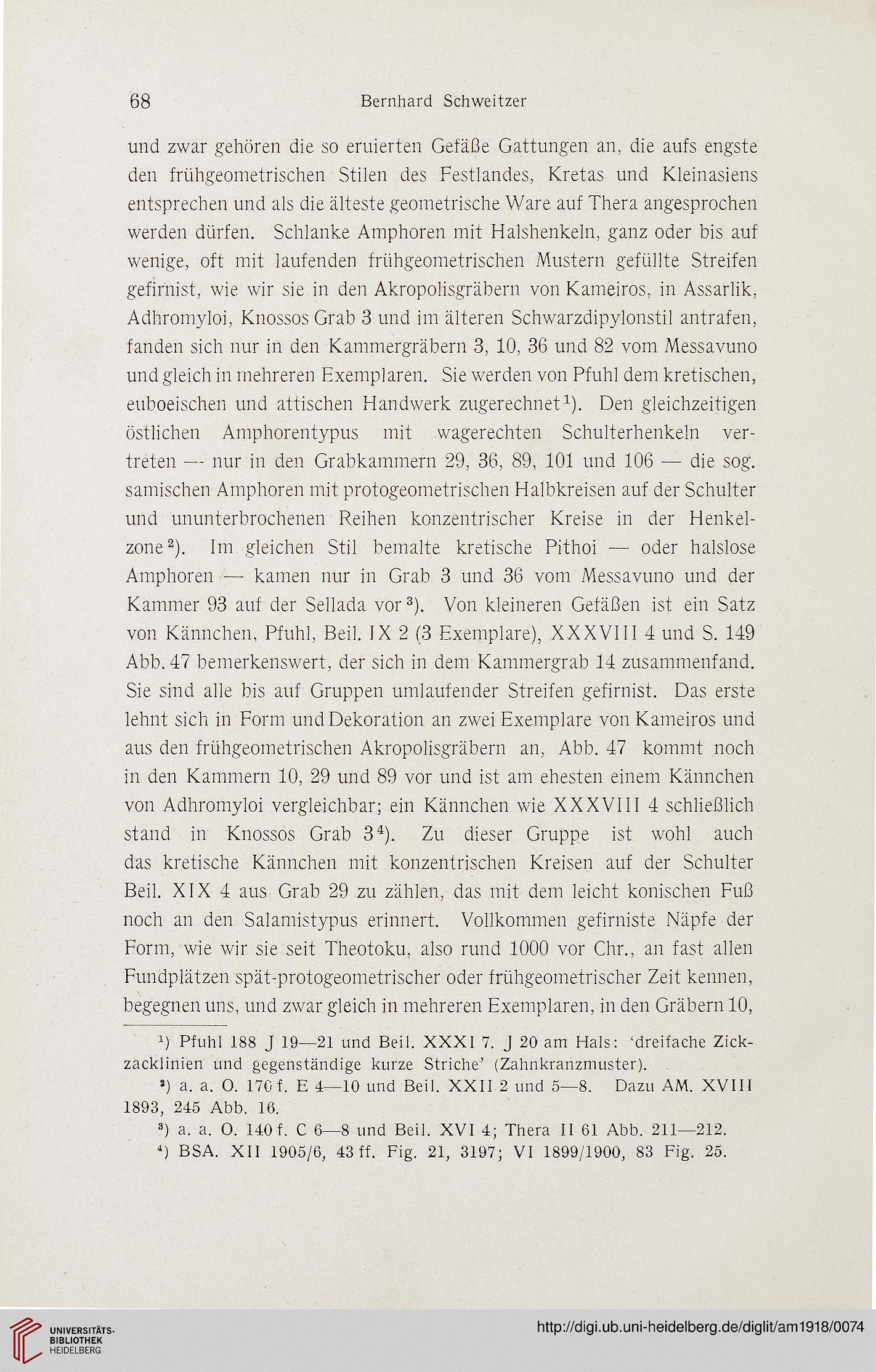68
Bernhard Schweitzer
und zwar gehören die so eruierten Gefäße Gattungen an, die aufs engste
den frühgeometrischen Stiien des Festlandes, Kretas und Kleinasiens
entsprechen und als die älteste geometrische Ware auf Thera angesprochen
werden dürfen. Schlanke Amphoren mit Halshenkeln, ganz oder bis auf
wenige, oft mit laufenden frühgeometrischen Mustern gefüllte Streifen
gefirnist, wie wir sie in den Akropolisgräbern von Kameiros, in Assarlik,
Adhromyloi, Knossos Grab 3 und im älteren Schwarzdipylonstil antrafen,
fanden sich nur in den Kammergräbern 3, 10, 36 und 82 vom Messavuno
und gleich in mehreren Exemplaren. Sie werden von Pfuhl dem kretischen,
euboeischen und attischen Handwerk zugerechnet^). Den gleichzeitigen
östlichen Amphorentypus mit wagerechten Schulterhenkeln ver-
treten — nur in den Grabkammern 29, 36, 89, 101 und 106 — die sog.
samischen Amphoren mit protogeometrischen Halbkreisen auf der Schulter
und ununterbrochenen Reihen konzentrischer Kreise in der Henkel-
zone 2). Im gleichen Stil bemalte kretische Pithoi —- oder halslose
Amphoren —- kamen nur in Grab 3 und 36 vom Messavuno und der
Kammer 93 auf der Sellada vor 3). Von kleineren Gefäßen ist ein Satz
von Kännchen, Pfuhl, Beil. JX 2 (3 Exemplare), XXXVI11 4 und S. 149
Abb.47 bemerkenswert, der sich in dem Kammergrab 14 zusammenfand.
Sie sind alle bis auf Gruppen umlaufender Streifen gefirnist. Das erste
lehnt sich in Form und Dekoration an zwei Exemplare von Kameiros und
aus den frühgeometrischen Akropolisgräbern an, Abb. 47 kommt noch
in den Kammern 10, 29 und 89 vor und ist am ehesten einem Kännchen
von Adhromyloi vergleichbar; ein Kännchen wie XXXVH1 4 schließlich
stand in Knossos Grab 3^). Zu dieser Gruppe ist wohl auch
das kretische Kännchen mit konzentrischen Kreisen auf der Schulter
Beil. XIX 4 aus Grab 29 zu zählen, das mit dem leicht konischen Fuß
noch an den Salamistypus erinnert. Vollkommen gefirniste Näpfe der
Form, wie wir sie seit Theotoku, also rund 1000 vor Chr., an fast allen
Fundplätzen spät-protogeometrischer oder frühgeometrischer Zeit kennen,
begegnen uns, und zwar gleich in mehreren Exemplaren, in den Gräbern 10,
b Pfuhl 188 J 19—21 und Beil. XXXI 7. J 20 am Hals: 'dreifache Zick-
zacklinien und gegenständige kurze Striche' (Zahnkranzmuster).
b a. a. O. 170 f. E 4—10 und Beil. XXII 2 und 5—8. Dazu AM. XVI11
1893, 245 Abb. 16.
b a. a. O. 140f. C 6—8 und Beil. XVI 4; Thera II 61 Abb. 211—212.
V BSA. XII 1905/6, 43 ff. Fig. 21, 3197; VI 1899/1900, 83 Fig. 25.
Bernhard Schweitzer
und zwar gehören die so eruierten Gefäße Gattungen an, die aufs engste
den frühgeometrischen Stiien des Festlandes, Kretas und Kleinasiens
entsprechen und als die älteste geometrische Ware auf Thera angesprochen
werden dürfen. Schlanke Amphoren mit Halshenkeln, ganz oder bis auf
wenige, oft mit laufenden frühgeometrischen Mustern gefüllte Streifen
gefirnist, wie wir sie in den Akropolisgräbern von Kameiros, in Assarlik,
Adhromyloi, Knossos Grab 3 und im älteren Schwarzdipylonstil antrafen,
fanden sich nur in den Kammergräbern 3, 10, 36 und 82 vom Messavuno
und gleich in mehreren Exemplaren. Sie werden von Pfuhl dem kretischen,
euboeischen und attischen Handwerk zugerechnet^). Den gleichzeitigen
östlichen Amphorentypus mit wagerechten Schulterhenkeln ver-
treten — nur in den Grabkammern 29, 36, 89, 101 und 106 — die sog.
samischen Amphoren mit protogeometrischen Halbkreisen auf der Schulter
und ununterbrochenen Reihen konzentrischer Kreise in der Henkel-
zone 2). Im gleichen Stil bemalte kretische Pithoi —- oder halslose
Amphoren —- kamen nur in Grab 3 und 36 vom Messavuno und der
Kammer 93 auf der Sellada vor 3). Von kleineren Gefäßen ist ein Satz
von Kännchen, Pfuhl, Beil. JX 2 (3 Exemplare), XXXVI11 4 und S. 149
Abb.47 bemerkenswert, der sich in dem Kammergrab 14 zusammenfand.
Sie sind alle bis auf Gruppen umlaufender Streifen gefirnist. Das erste
lehnt sich in Form und Dekoration an zwei Exemplare von Kameiros und
aus den frühgeometrischen Akropolisgräbern an, Abb. 47 kommt noch
in den Kammern 10, 29 und 89 vor und ist am ehesten einem Kännchen
von Adhromyloi vergleichbar; ein Kännchen wie XXXVH1 4 schließlich
stand in Knossos Grab 3^). Zu dieser Gruppe ist wohl auch
das kretische Kännchen mit konzentrischen Kreisen auf der Schulter
Beil. XIX 4 aus Grab 29 zu zählen, das mit dem leicht konischen Fuß
noch an den Salamistypus erinnert. Vollkommen gefirniste Näpfe der
Form, wie wir sie seit Theotoku, also rund 1000 vor Chr., an fast allen
Fundplätzen spät-protogeometrischer oder frühgeometrischer Zeit kennen,
begegnen uns, und zwar gleich in mehreren Exemplaren, in den Gräbern 10,
b Pfuhl 188 J 19—21 und Beil. XXXI 7. J 20 am Hals: 'dreifache Zick-
zacklinien und gegenständige kurze Striche' (Zahnkranzmuster).
b a. a. O. 170 f. E 4—10 und Beil. XXII 2 und 5—8. Dazu AM. XVI11
1893, 245 Abb. 16.
b a. a. O. 140f. C 6—8 und Beil. XVI 4; Thera II 61 Abb. 211—212.
V BSA. XII 1905/6, 43 ff. Fig. 21, 3197; VI 1899/1900, 83 Fig. 25.