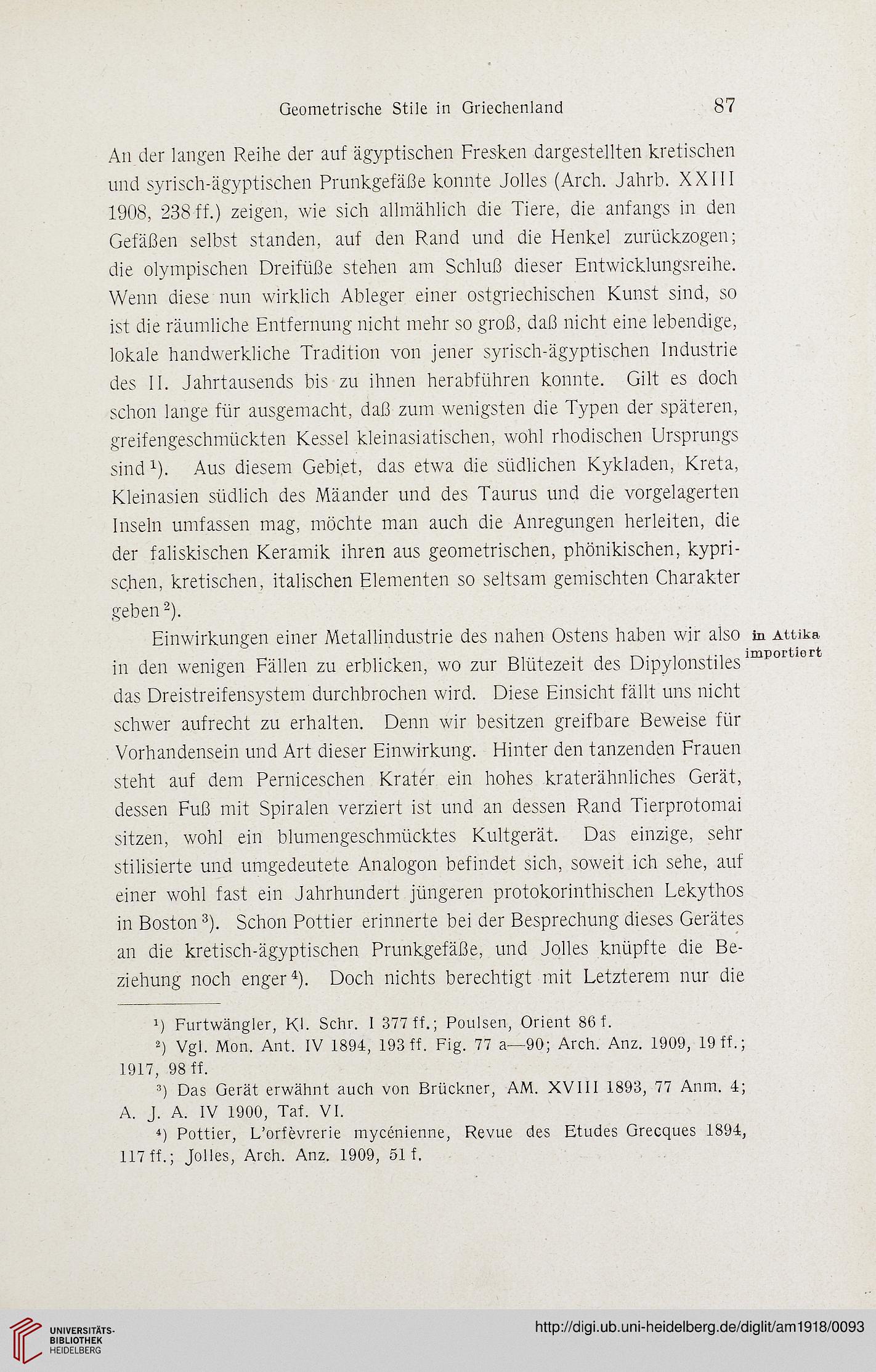Geometrische Stiie in Griecheniand
87
An der langen Reihe der auf ägyptischen Fresken dargestellten kretischen
und syrisch-ägyptischen Prunkgefäße konnte Jolles (Arch. Jahrb. XXII!
1908, 238 ff.) zeigen, wie sich allmählich die Tiere, die anfangs in den
Gefäßen selbst standen, auf den Rand und die Henkel zurückzogen;
die olympischen Dreifüße stehen am Schluß dieser Entwicklungsreihe.
Wenn diese nun wirklich Ableger einer ostgriechischen Kunst sind, so
ist die räumliche Entfernung nicht mehr so groß, daß nicht eine lebendige,
lokale handwerkliche Tradition von jener syrisch-ägyptischen Industrie
des 11. Jahrtausends bis zu ihnen herabführen konnte. Gilt es doch
schon lange für ausgemacht, daß zum wenigsten die Typen der späteren,
greifengeschmückten Kessel kleinasiatischen, wohl rhodischen Ursprungs
sind i). Aus diesem Gebi.et, das etwa die südlichen Kykladen, Kreta,
Kleinasien südlich des Mäander und des Taurus und die vorgelagerten
Inseln umfassen mag, möchte man auch die Anregungen herleiten, die
der faliskischen Keramik ihren aus geometrischen, phönikischen, kypri-
sc.hen, kretischen, italischen Elementen so seltsam gemischten Charakter
geben -).
Einwirkungen einer Metallindustrie des nahen Ostens haben wir also in Attika,
in den wenigen Fällen zu erblicken, wo zur Blütezeit des Dipylonstiles'^°^^°^
das Dreistreifensystem durchbrochen wird. Diese Einsicht fällt uns nicht
schwer aufrecht zu erhalten. Denn wir besitzen greifbare Beweise für
Vorhandensein und Art dieser Einwirkung. Hinter den tanzenden Frauen
steht auf dem Perniceschen Krater ein hohes kraterähnliches Gerät,
dessen Fuß mit Spiralen verziert ist und an dessen Rand Tierprotomai
sitzen, wohl ein blumengeschmücktes Kultgerät. Das einzige, sehr
stilisierte und umgedeutete Analogon befindet sich, soweit ich sehe, auf
einer wohl fast ein Jahrhundert jüngeren protokorinthischen Lekythos
in Boston 3). Schon Pottier erinnerte bei der Besprechung dieses Gerätes
an die kretisch-ägyptischen Prunkgefäße, und Jolles knüpfte die Be-
ziehung noch enger 4). Doch nichts berechtigt mit Letzterem nur die
1) Furtwängier, R). Sehr, I 377 ff.; Poutsen, Orient 86 f.
2) Vgt. Mon. Ant. IV 1894, 193 ff. Fig. 77 a—90; Arch. Anz. 1909, 19 ff.;
1917, 98 ff.
h Das Gerät erwähnt auch von Brückner, AM. XV iH 1893, 77 Anm. 4;
A. J. A. IV 1900, Taf. VI.
*) Pottier, L'orfevrerie mycenienne, Revue des Etudes Grecques 1894,
117 ff.; Jolles, Arch. Anz. 1909, 51 f.
87
An der langen Reihe der auf ägyptischen Fresken dargestellten kretischen
und syrisch-ägyptischen Prunkgefäße konnte Jolles (Arch. Jahrb. XXII!
1908, 238 ff.) zeigen, wie sich allmählich die Tiere, die anfangs in den
Gefäßen selbst standen, auf den Rand und die Henkel zurückzogen;
die olympischen Dreifüße stehen am Schluß dieser Entwicklungsreihe.
Wenn diese nun wirklich Ableger einer ostgriechischen Kunst sind, so
ist die räumliche Entfernung nicht mehr so groß, daß nicht eine lebendige,
lokale handwerkliche Tradition von jener syrisch-ägyptischen Industrie
des 11. Jahrtausends bis zu ihnen herabführen konnte. Gilt es doch
schon lange für ausgemacht, daß zum wenigsten die Typen der späteren,
greifengeschmückten Kessel kleinasiatischen, wohl rhodischen Ursprungs
sind i). Aus diesem Gebi.et, das etwa die südlichen Kykladen, Kreta,
Kleinasien südlich des Mäander und des Taurus und die vorgelagerten
Inseln umfassen mag, möchte man auch die Anregungen herleiten, die
der faliskischen Keramik ihren aus geometrischen, phönikischen, kypri-
sc.hen, kretischen, italischen Elementen so seltsam gemischten Charakter
geben -).
Einwirkungen einer Metallindustrie des nahen Ostens haben wir also in Attika,
in den wenigen Fällen zu erblicken, wo zur Blütezeit des Dipylonstiles'^°^^°^
das Dreistreifensystem durchbrochen wird. Diese Einsicht fällt uns nicht
schwer aufrecht zu erhalten. Denn wir besitzen greifbare Beweise für
Vorhandensein und Art dieser Einwirkung. Hinter den tanzenden Frauen
steht auf dem Perniceschen Krater ein hohes kraterähnliches Gerät,
dessen Fuß mit Spiralen verziert ist und an dessen Rand Tierprotomai
sitzen, wohl ein blumengeschmücktes Kultgerät. Das einzige, sehr
stilisierte und umgedeutete Analogon befindet sich, soweit ich sehe, auf
einer wohl fast ein Jahrhundert jüngeren protokorinthischen Lekythos
in Boston 3). Schon Pottier erinnerte bei der Besprechung dieses Gerätes
an die kretisch-ägyptischen Prunkgefäße, und Jolles knüpfte die Be-
ziehung noch enger 4). Doch nichts berechtigt mit Letzterem nur die
1) Furtwängier, R). Sehr, I 377 ff.; Poutsen, Orient 86 f.
2) Vgt. Mon. Ant. IV 1894, 193 ff. Fig. 77 a—90; Arch. Anz. 1909, 19 ff.;
1917, 98 ff.
h Das Gerät erwähnt auch von Brückner, AM. XV iH 1893, 77 Anm. 4;
A. J. A. IV 1900, Taf. VI.
*) Pottier, L'orfevrerie mycenienne, Revue des Etudes Grecques 1894,
117 ff.; Jolles, Arch. Anz. 1909, 51 f.